- forum+, Neuerscheinungen, Politik
Krise über Krise: „Le temps des crises“ von J.-J. Rommes & M.-E. Ruben
(von Pierre Lorang)
Jedes Buch der Welt, jede Zeitung und jedes Magazin, die in waagerechter rechtsläufiger Schrift nach lateinischem Alphabet gedruckt sind, folgt einem System der Pagina, wonach die Seitenzahl auf der rechtsliegenden Vorderseite ungerade, auf der linksliegenden Rückseite gerade ist. Nicht so Le temps des crises, das unlängst im Selbstverlag des Institut Grand-Ducal unter der Ägide der Section des sciences morales et politiques erschienen ist. Wollten die Herausgeber damit augenzwinkernd den nonkonformistischen, zuweil ikonoklastischen Charakter des Buches andeuten? Oder war hier bloß handwerkliche Schludrigkeit am Werk? Dazu später mehr.
Tatsache ist: Die beiden Autoren, Jean-Jacques Rommes und Michel-Edouard Ruben, sind ein ungleiches, um nicht zu sagen asymmetrisches Paar. Ersterer zählt zur Kategorie – wir bitten um Verzeihung! – der alten weißen Männer, ein klassischer Vertreter der lokalen Boomergeneration: Rechtsstudium, langjähriger Banken- und Wirtschaftslobbyist mit Posten im korporatistischen Gremiendschungel, bestens verankert und vernetzt im Establishment des Vieux Luxembourg. Letzterer (nochmals Verzeihung!): eigentlich ein Underdog. Person of Color mit karibischen Wurzeln und offenkundigen Sprachdefiziten, was ihn, bei oberflächlicher Betrachtung, nicht unbedingt für einen hochqualifizierten Job beim Luxemburger Parastaat befähigt. In Le temps des crises gibt es dazu ein Hitchcock-Moment zwecks Beschreibung eines (von vielen) nationalen Missständen (S. 96): „Il y a cependant une injustice structurelle qu’il faudra absolument corriger ; c’est celle qui fait qu’un Caraïbéen qui vivait en France puisse venir travailler au Grand-Duché dans un think tank comme économiste sans parler un mot d’allemand ni de luxembourgeois, alors qu’un enfant né dans le pays, d’un père belge et d’une mère portugaise, risque de ne jamais pouvoir y travailler comme économiste car il aura foiré sa scolarité parce qu’il ne maîtrisait pas assez bien l’allemand et le luxembourgeois.“ Im Klartext: Michel-Edouard Ruben arbeitet als Wirtschaftswissenschaftler für die Fondation Idea, eine rührige Denkfabrik unter dem Dach der Handelskammer.
Rommes und Ruben also bündeln auf weniger als 200 Taschenbuchseiten die Quintessenz all dessen, was die krisengeschüttelte Menschheit und das erstaunlich krisenresiliente Luxemburg in diesen Post-Lockdown-Tagen – aber noch vor Russlands Angriff auf die Ukraine – beschäftigt: Wie kommt es, dass eine Börsen-, Immobilien-, Finanz- und Schuldenkrise die nächste jagt und Luxemburg sie allesamt glimpflich übersteht? Selbst die Coronapandemie hat, so die Autoren, nicht die verheerenden wirtschaftlichen und sozialen Schäden angerichtet, die man zurecht hätte befürchten können. Die Versuche zur Beantwortung dieser für das Land existenziellen Fragen folgen einer didaktisch stringenten makro- und mikroökonomischen Analyse, um in fine dann doch bei der Metaphysik zu landen (S. 37): „Les miracles ont pris l’habitude de s’abattre sur le Luxembourg avec une régularité qui permet d’affirmer qu’il est béni des cieux.“ Wobei die Luxemburger („Lucky Lux“) ihre Stellung als quasi auserwähltes Volk der Neuzeit inzwischen wie ein unabänderliches und unveräußerliches Recht hinnähmen (S. 39): „Les Luxembourgeois acceptent cette tradition de providence avec un flegme à faire passer les stoïciens pour des excités sous redbull [sic] – Vum Schaffen ass nach kee räich ginn! – et n’ont été qu’à moitié étonné [sic] que le Grand-Duché ait de nouveau eu, dans le malheur que constitue la pandémie, énormément de chance.“
Die Zitate illustrieren den Grundtenor des Buches: Die Autoren bedienen sich nicht des knochentrockenen Juristen- und Ökonomenfranzösisch, das die spezialisierte Literatur zur Thematik für den Laien oft unverdaulich macht. Ihre Sprache ist leicht zugänglich, die Argumentation stets nachvollziehbar, die in zahlreichen Fußnoten zitierten Referenzen von höchster Qualität. Hinzu kommt: Rommes und Ruben haben Lust auf Provokation und Polemik, hantieren mit Wortspielen, würzen den Text mit Lebensweisheiten und Kalauern auf Moselfränkisch. Ihr eigentümlicher Humor hat etwas von… Boris Johnson. Und so bekommen diese und jene Zeitgenossen ihr Fett weg: Exminister Dan Kersch, linksgrünes Hipstertum, Luxemburgs Schlaraffenlandmentalität, Wachstums- und Globalisierungsgegner, Multimilliardäre im Weltraum, unverantwortliche Social-Media-Konzerne…
Aller Spöttelei zum Trotz – in der Mitte des Bandes angereichert durch ein satirisches Intermezzo über Steuergerechtigkeit – wollen die Verfasser keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Anliegen aufkommen lassen. Insbesondere im zweiten Teil des Buches („Penser les crises“) geht es an die Substanz dessen, was die jüngeren Generationen in nur wenigen Jahrzehnten erwarten wird (bzw. könnte): Seuchen, Energieknappheit, technologische Verwundbarkeit, Wirtschafts- und Finanzkrisen, identitäre Abschottung und Verschwörungsdenken, Bevölkerungsexplosion und Überalterung, Klimawandel und Artensterben…
Rommes und Ruben zweifeln keine Sekunde daran, dass die Marktwirtschaft („le capitalisme“), das einzige Wirtschaftssystem, das in der Lage sei, nachweislich Wohlstand für alle zu schaffen, die notwendige Wandlungsfähigkeit besitzt, um auf nachhaltige, ökologisch und sozial verantwortliche Weise den Krisen und Katastrophen der Zukunft zu begegnen. Allerdings, so die Autoren, bräuchte es dafür nichts weniger als eine neue Weltordnung, global verbindliche Regeln und die dafür zuständigen Institutionen unter voluntaristischer Federführung von EU und USA. Ob man solch revolutionäre Überlegungen teilt oder nicht, jeder der skizzierten Vorschläge hat das Zeug, auf ein Neues ganze Bibliotheksregale zu füllen. Schade nur, dass Le temps des crises riskiert, darin unwiederbringlich verloren zu gehen, weil man schlicht vergessen hat, Titel und Autoren auf dem Buchrücken kenntlich zu machen.
Überhaupt: Warum nur hat sich das altehrwürdige Institut Grand-Ducal nicht auf die Vorzüge der kapitalistischen Arbeitsteilung besonnen, um Form und Inhalt des Buches in puncto Wertigkeit konvergieren zu lassen? Durch professionelles Lektorat hätten ärgerliche orthografische und grammatische Fehler sowie Interpunktionsschwächen behoben werden können. Beim Layout wiederum kommt der Eindruck auf, als handele es sich um ein ehrenamtliches Eigengewächs unter Einsatz einer antiquierten PageMaker-Software von 1989 ohne französischsprachiges Trennprogramm. Ergebnis ist ein stellenweise zerhacktes Schriftbild, das den Lesefluss doch erheblich stört. So dass beim Betrachter – frei nach Rommes und Ruben – der fahle Eindruck haftenbleiben mag: „On fait ce qu’on peut, même si on peut peu.“
Doch wie gesagt: Der billige Eindruck täuscht. Zur Stimulierung manch eingerosteter Hirnströme im Land sei Le temps des crises trotz (oder wegen) seines kontroversen Potenzials wärmstens empfohlen.
Le temps des crises von Jean-Jacques Rommes und Michel-Edouard Ruben, Luxemburg, Institut Grand-Ducal – Section des sciences morales et politiques, 2022, 196 S., € 20,-.
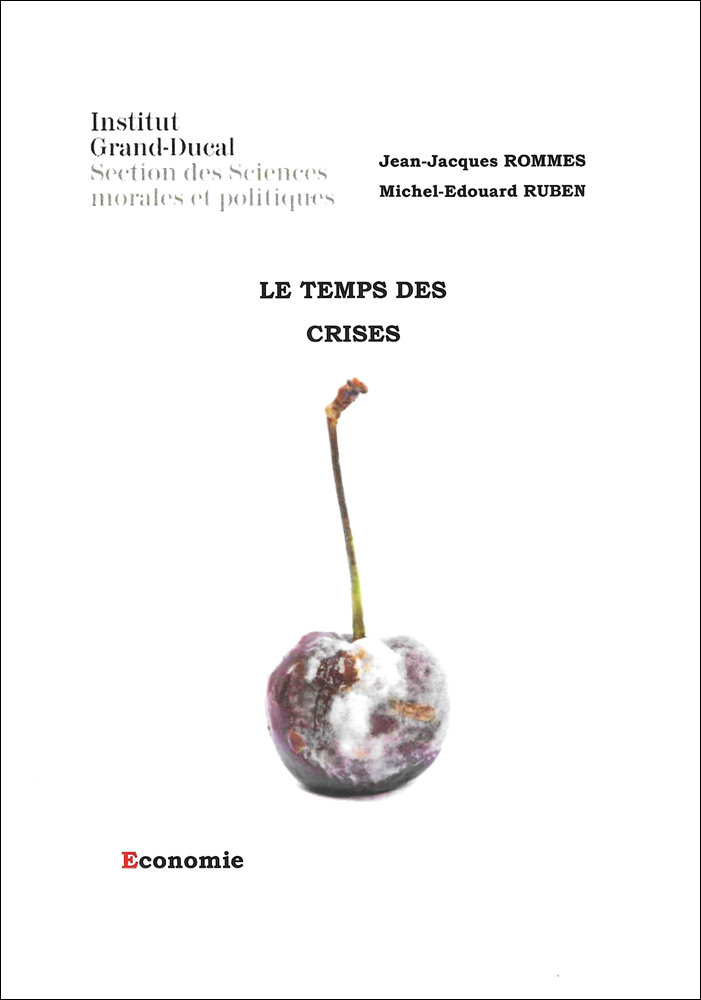
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
