Sicherheitsorientierte Praxis in der Kinder- und Jugendhilfe
Innovative Praxismodelle und gesellschaftlicher Wandel
Die mit dem projet de loi n° 7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles (März 2022) angestrebte Reform der Kinder- und Familienhilfe reflektiert sowohl den fachlichen und politischen Diskurs um notwendige Veränderungen in diesem Feld sowie internationale, weltgesellschaftlich institutionalisierte Normen und Regeln.
So ist die Kinder- und Familienhilfe in Luxemburg, die mit dem AEF-Gesetz von 2008 (aide à l’enfance et à la famille) in der jetzigen Form komplementär zu einem seit 1939 (letzte Fassung von 1992) bestehenden institutionellen, gerichtlichen Jugendschutz geschaffen wurde, in ihrer Grundausrichtung – wie auch der neue Gesetzesentwurf 7994 – an der Kinderrechtskonvention orientiert (Motive).
Andere Diskurse wie zu institutioneller Gewalt und eine damit verbundene Vorstellung von Schutz (Art. 4 des Entwurfs) sind ebenso leitend für die angestrebte Ausrichtung und gesetzliche Rahmung des Feldes der sozialen Hilfen für Kinder und Familien. Ein Aspekt der zukünftigen Schutzkonzepte von Organisationen ist die Möglichkeit der externen Beschwerde.
Im Unterschied zu vielen anderen Ländern gibt es in Luxemburg bisher keine systematische unabhängige Aufarbeitung von institutionellem Missbrauch und keine Anerkennung der Opfer. Das liege wohl auch daran, so die damalige Land-Journalistin Ines Kurschat im Jahr 2019, dass es „an gesellschaftlicher Unterstützung und an [politisch gefördertem] Aufklärungswillen [fehle]. Sexualisierte Gewalt in Institutionen, nicht nur in der Kirche, auch in (para)staatlichen Kinderheimen, in Sportvereinen und in der Familie, ist immer noch ein Tabu.“1
Eine öffentliche fachliche Auseinandersetzung gibt es zur Frage der Rechte von Eltern (autorité parentale) und zur fehlenden Trennschärfe von Schutz und Strafe in der aktuellen Jugendschutzgesetzgebung (Reform 1992). Die Übertragung der autorité parentale auf Institutionen im Falle der Platzierung von Kindern führte in der Vergangenheit zu einer strukturellen und konzeptionell fachlichen Vernachlässigung der Arbeit mit Eltern und bis 2011 zu einem fast völligen Fehlen von Diensten der Familienhilfe. So wurden „mächtige“ Institutionen geschaffen, die in ihrem inneren Handeln und Wirken kaum bis gar keiner Kontrolle unterlagen. Ein Ausdruck dieser Denkweise ist die vielfach kritisierte Praxis, Kinder, ohne das Wissen der Eltern z. B. in der Schule abzuholen, um sie fremd unterzubringen.
Die paternalistische Haltung, der Staat, Institutionen oder Professionelle können Kinder am besten schützen, und die Wahrnehmung von Eltern als störenden Akteuren, werden Stolpersteine der Reform darstellen, wenn es darum geht, die Praxis der Kinder- und Familienhilfe grundlegend zu reformieren. Hierzu bedarf es veränderter Praktiken der Kommunikation und der interprofessionellen Zusammenarbeit. Genau an diesen Punkten setzt die sicherheitsorientierte Praxis (SOP) an. Sie hat Arbeitsweisen entwickelt, die an den Maximen Partizipation, Transparenz und Schutz ausgerichtet sind.
SOP als Praxismodell
Der Fokus des Praxismodels SOP kann verkürzt auf folgende Formel gebracht werden: Kinder sind geschützter, wenn wir „Augen und Ohren“ an den Orten haben, an denen sie leben, d. h., wenn es Menschen gibt, die hören und sehen, was an diesen Lebensorten der Kinder geschieht und die wissen und Auskunft geben können, welche Anzeichen von Sicherheit es gibt oder in welcher Weise Kinder gefährdet sind.
Signs of Safety, so haben der Psychologe Andrew Turnell und der Sozialarbeiter Steve Edwards, die Pioniere sicherheitsorientierter Praxis, dieses Konzept Ende der 1990er Jahre in einer titelgebenden Monografie genannt.2 Auf ihren grundlegenden Arbeiten und Methoden basieren alle Weiterentwicklungen, die es inzwischen gibt. In diesem Zusammenhang war die Frage entscheidend, wie die ungehörten und zum Schweigen gebrachten Stimmen der Kinder und Eltern hörbar gemacht werden können; und wie ein so ausgerichteter Wandel gesellschaftlicher Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe gelingen könne. Die Forschung zu partizipativen Prozessen macht insbesondere auf die Nicht-Beachtung der Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen aufmerksam, vor allem darauf, dass wenig mit den Kindern selbst gesprochen wird. Altersgerechte und altersangemessene Sprache sowie ein Eingehen auf die Sprech- und Handlungsfähigkeit von Kindern mit spezifischen Befähigungen und Bedürfnissen werden – so die gleichlautenden Befunde – wenig reflektiert oder beachtet.
Im aktuellen projet de loi wird die Partizipation der Betroffenen in den Artikeln 31 und 51 beschrieben. Betont wird auch die erforderliche Transparenz der Prozesse, die nach einer einfachen Sprache verlangt und nach der Möglichkeit, die eigene Fallakte einzusehen (Art. 53). Die Fédération d’employeurs du secteur de l’action sociale (FEDAS) weist in ihrem Gutachten zum Gesetz vom 8. Juni 2022 mit Nachdruck darauf hin, dass eine wirkliche Beteiligung der strukturellen Verankerung in der Planung von Interventionen und Hilfen bedarf (S. 4).3 Im Artikel 31 werden die Adressat*innen der Hilfe nur „eingeladen“, was zu Recht als schwache Formulierung kritisiert wird, sowohl mit Blick auf die Eltern wie die Kinder.
Studien zeigen, dass die Kinder sicherer sind, wenn es ein geteiltes Verständnis von Risiken gibt und eine geteilte Verantwortung dafür, diese zu verkleinern, was voraussetzt, dass die Eltern den Professionellen vertrauen und mit ihnen zusammenarbeiten.4 Nur so kann ein freiwilliger, präventiver Schutz von Kindern gelingen, wie er im Gesetzesentwurf angestrebt wird (Art. 5).
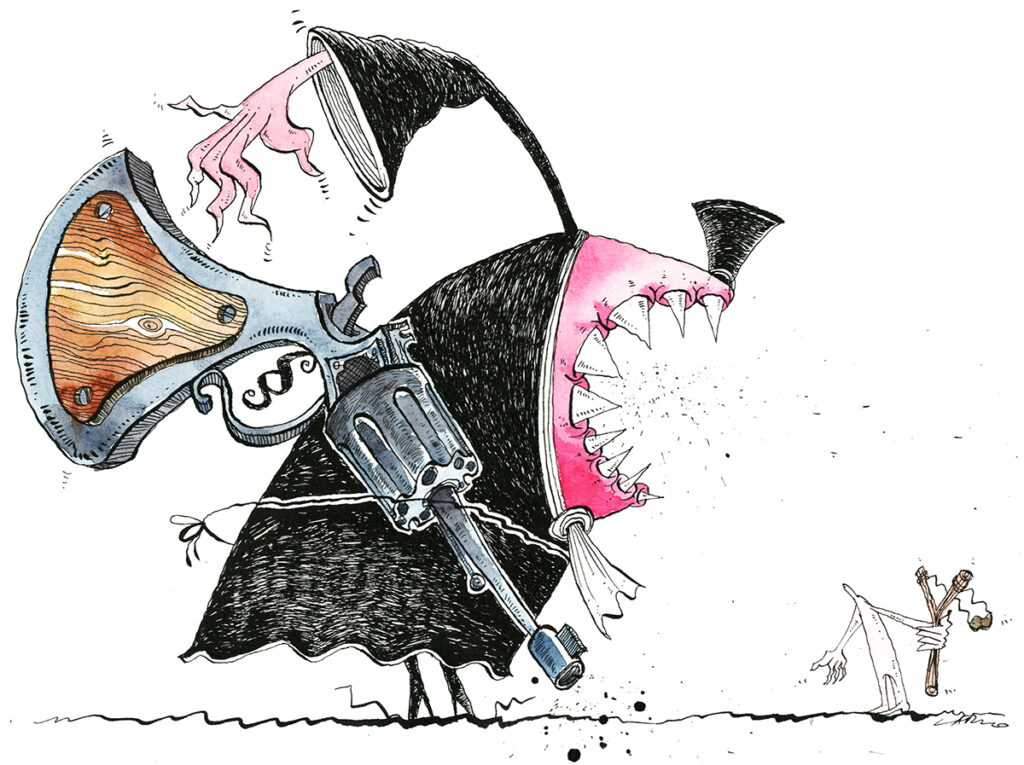
Das Warum und Wie einer sicherheitsorientierten Praxis?
Methodisch strukturierend für die Arbeitsweise von SOP sind die drei Fragehorizonte „Was macht Sorgen?“, „Was gelingt?“ und „Was muss passieren?“. Ein entscheidender Aspekt in der konzeptionellen Weiterentwicklung im Anschluss an die Arbeiten von Turnell und Edwards war dabei die Integration der Arbeit der englischen Psychotherapeutin Susie Essex zur Sicherheitsplanung und zum Umgang mit Verleugnung und umstrittener Kindeswohlgefährdung durch die Eltern („disputed abuse“).5 Kinder müssen für das Erlebte eine Sprache haben, die von den Eltern und den Professionellen akzeptiert wird, so Essex. Sie hat in ihrem Team methodisch die Idee von Bildgeschichten entwickelt. Sie werden mit den Eltern erarbeitet und beschreiben in einer für die Kinder altersgemäßen Sprache, was die Schwierigkeiten in der Familie sind, die die Kinder schädigen und die zum Eingreifen der sozialen Arbeit geführt haben. Gleichzeitig wird detailliert festgehalten, was vereinbart wird, um den Schutz der Kinder herzustellen.6
Eine weitere zentrale Einsicht ist, dass sich etablierte Routinen nur dann verändern werden, wenn das Praxismodell nicht nur in Fortbildungen vermittelt wird. Wichtig ist, dass Organisationen, die das Praxismodell einführen wollen, dazu einen Plan zur Implementierung erarbeiten, der die Anwendung der neuen methodischen Elemente in der alltäglichen Praxis ausformt und spezifisch gestaltet. Die Stärke des Ansatzes beweist sich in einer kontinuierlich sich entfaltenden reflektierenden Praxis.
Gemeinsam ist allen sicherheitsorientieren Konzepten, dass sie systematisch
- auf den Schutz der Kinder und Jugendlichen fokussiert sind,
- visuelle und narrative Methoden nutzen,
- Eltern und andere Beteiligte in den Prozessen befähigen, ihre Sichtweisen und Erfahrungen in der ihnen je eigenen Sprache einzubringen und
- mit der erweiterten Familie bzw. dem sozialen Umfeld der Kinder und Eltern arbeiten und diese in die Gestaltung der Hilfeprozesse von Beginn an einbeziehen.
Den roten Faden im Prozess mit den Familien bildet dabei die Frage nach der Sicherheit, dem Wohlergehen und der Zugehörigkeit der Kinder in ihrem jeweiligen Umfeld. Die Sicherheit der Kinder wird in Form einer Sicherheitsplanung systematisch, detailliert und verständlich beschrieben. Diese Pläne bilden die Basis für eine fortlaufende Beobachtung von Verhaltensweisen, die so evaluiert werden. So entsteht ein kontinuierlicher Prozess der Anpassung der Hilfen und von Veränderungen an die Alltagsrealitäten der Familien.
In Vorbereitung auf die Umsetzung der Gesetzesreform hat das Erziehungsministerium Anfang 2021 entschieden, SOP als methodische Arbeitsweise im gesamten ONE zu implementieren.
Ein zentrales Element, das die beschriebene Arbeitsweise von vielen anderen methodischen Zugängen unterscheidet, ist die systematische, transparente und verständliche Visualisierung bzw. Dokumentation der Gespräche und getroffenen Vereinbarungen. Dokumentiert werden zentrale Elemente des Falls, Gespräche und Absprachen mit den Eltern und Kindern und Entscheidungen. Die Visualisierung ist gerade in Kontexten der Mehrsprachigkeit und der unterschiedlichen Sprachkompetenz ein wichtiges Mittel, die Beteiligten zu einem Dialog zu befähigen.
Eine besondere Herausforderung sehen die Professionellen darin, Gefahren und vorhandene Sicherheiten zu gewichten und abzuwägen sowie konsistente Kriterien für die Etablierung eines Zwangskontextes zu entwickeln, um bewerten zu können, ab welchem Punkt ein Entzug der elterlichen Rechte oder die Herausnahme der Kinder aus dem häuslichen Umfeld angebracht sind.7
SOP in der luxemburgischen Kinder- und Jugendhilfe
Seit 2012 habe ich in regelmäßigen Fall-Werkstätten (Prax Labs) an der Universität Luxemburg Erfahrungen in der Umsetzung von SOP in die Praxis gewonnen und ein erstes Netzwerk von Professionellen etabliert.
2017 hat sich der Croix Rouge als erster Träger in Luxemburg entschieden, SOP für den Bereich Kinder- und Jugendhilfe zu implementieren. Luxemburg hatte damit eine Pionierrolle in der Verbreitung dieser Praxismodelle in deutsch- und französischsprachigen Kontexten inne, die bis dahin mit wenigen Ausnahmen fast ausschließlich in englischsprachigen Ländern bekannt waren, da alle Materialien und Fortbildungen nur in englischer Sprache verfügbar waren.
Dem Beispiel des Croix Rouge folgten andere Träger, und diese entschieden sich 2019, ein Netzwerk namens TransNET SOP zu gründen, um sich in der Implementierung gegenseitig zu unterstützen und einen Ort des Austausches zu entwickeln. Die Besonderheit dieses Netzwerkes liegt darin, dass es trägerübergreifend und transnational ist. Es beteiligen sich Akteure aus Luxemburg, Deutschland und Belgien. Bisher wurden als systematische Formate ein sogenanntes Prax Lab (Fallwerkstatt) eingerichtet, das monatlich online stattfindet, außerdem eine Sommerschule, ein Praxistag und eine viertägige Basisausbildung.
In Vorbereitung auf die Umsetzung der Gesetzesreform hat das Erziehungsministerium (MENEJ) Anfang 2021 entschieden, SOP als methodische Arbeitsweise im gesamten Office nationale de l’enfance (ONE) zu implementieren, verbindlich zu machen und als Angebot für die Mitarbeiter*innen des MENEJ und des ONE im Institut de formation de l’éducation nationale (IFEN) zu etablieren. Im Jahr 2021 fanden die ersten Ausbildungen von Professionellen und von Praxisanleiter*innen statt. Im MENEJ wurde eine Steuerungsgruppe eingerichtet. 2022 gab es einen ersten Praxistag, der an konkreten Fällen zeigte, wie SOP bereits genutzt und in die bestehenden Routinen eingearbeitet werden kann.
Was bleibt zu tun? Was sind die Herausforderungen und Chancen?
Die größte Herausforderung liegt im Moment darin, die Tiefe der möglichen Veränderung zu begreifen, die mit der Reform und mit einer Arbeitsweise wie SOP verbunden sind. Einige der wesentlichen Aspekte und Fragen scheinen mir die folgenden zu sein:
Mehrsprachigkeit und kulturelle Diversität: SOP verlangt eine verständliche Sprache für Kinder und Eltern und eine Übersetzung von fachlichem Wissen in lebensweltliche Bezüge und Verständnisse. Hier stellen sich Fragen nach der Form von Dokumentation und Aktenführung.
Umgang mit verschiedenen Formen von Expertise und von Wissen: Wie ergänzt sich unterschiedliches fachliches und arbeits- und berufsbezogenes Wissen mit dem Wissen von Eltern und Kindern, und wie lässt es sich zu verlässlichen, verbindlichen und verständlichen Absprachen und Hilfen verdichten?
Orientierung an der Erarbeitung von Sicherheiten: Wie lässt sich eine professionelle Kultur und ein professionelles Selbstverständnis verändern, die insbesondere darauf ausgerichtet sind, unsichere und für Kinder schädigende familiäre Situationen durch professionelle Dienstleistungen zu lösen und weniger durch eine Mobilisierung sozialer Netze von Familien, die die Sicherheit von Kindern unterstützen?
Wie können die Grenzen von Jugendhilfe thematisiert werden, und wie kann die Kooperation mit anderen Systemen – wie Schule und Medizin – ausbuchstabiert werden?
Wie können Sozialpolitik – insbesondere auch im Bereich Wohnen – oder Politiken in Bezug auf Migration und Einwanderung soziale Probleme auch in ihren Auswirkungen auf die Problemmuster entschärfen, die in der Jugend- und Familienhilfe bearbeitet werden?
Nachhaltigkeit und strukturelle Verankerung der basalen Arbeitsweisen und Prinzipien: Wie lässt sich der bei vielen Trägern und im MENEJ angefangene Prozess so strukturell verankern, dass er dauerhaft etabliert und wirksam werden kann? Notwendige Voraussetzungen dafür sind die Ausrichtung von Strukturen und Formaten auf partizipative und wertschätzende Haltungen und eine entsprechende Umsetzung in Verfahren und Prozessen.
Kultur der Anerkennung: Wie kann anerkennend und gleichzeitig kritisch mit den Veränderungen umgegangen werden? Welche Formen des Austauschs und der Reflexion sind hier hilfreich?
Wissenschaftliche und fachliche Begleitung: Wie kann eine kontinuierliche und systematische Forschung zu den stattfindenden Prozessen etabliert werden, wie ein fachlicher Diskurs? Dazu gehört es, Erfolgs- und Wirksamkeitsindikatoren zu formulieren, an denen entlang eine kritische Auseinandersetzung stattfinden kann und die auch eine Grundlage für eine Jugendhilfeplanung sein könnten.
Perspektiven
Luxemburg hat einen mutigen Weg eingeschlagen. Viele Professionelle und politisch Verantwortliche sind daran mit Leidenschaft und Gestaltungswillen beteiligt. Die gute Nachricht: Es gibt viele, mit denen sich eine Kooperation lohnen würde; viele, die ähnliche Entscheidungen getroffen haben, wie z. B. der Jugendschutz in Flandern oder in Irland, wie die Jugendämter in Deutschland oder die Kinderschutzverwaltungen in Oberösterreich. Wohin der Weg letztendlich führt, ist vor allem auch davon abhängig, wie dialogfähig die Beteiligten bleiben, wie Krisen und Kritik ver- und bearbeitet werden.
Es ist sicherlich kein einfacher Weg, weil er allen Beteiligten viel abverlangt: Offenheit, Verantwortlichkeit, Verständigungsfähigkeit und Geduld. Gleichzeitig muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, die dies ermöglichen. Dazu gehören insbesondere die Arbeitsbedingungen in der sozialen Arbeit, die Etablierung von hilfreichen Feedback-Formaten und von Strukturen der Qualitätsbeobachtung sowie die Etablierung einer eigenständigen Forschung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.
Ulla Peters war von 2003 bis 2021 als Professorin für Soziologie an der Universität Luxemburg in den Bereichen Sozial- und Erziehungswissenschaften und Soziale Arbeit tätig. Sie hat dort sowohl Prozesse der Implementierung traumpädagogischer wie sicherheitsorientierter Arbeitsweisen in Organisationen begleitet.
1 Ines Kurschat, „Beichte ohne Zeugen“, in: d’Lëtzebuerger Land vom 5. April 2019.
2 Andrew Turnell / Steve Edwards, Signs of Safety: A Solution and Safety Oriented Approach to Child Protection Casework, New York, W.W. Norton, 1999.
3 Vgl. auch den Beitrag von Pascaline K’Delant von der FEDAS in diesem Dossier.
4 Lucy Sheehan et al., Signs of safety: Findings from a mixed-methods systematic review focussed on reducing the need for children to be in care, What Works Centre for Children’s Social Care, 2018, https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/132939 (letzter Aufruf: 29. August 2022).
5 Andrew Turnell / Susie Essex, Working with „Denied“ Child Abuse: The Resolutions Approach, Buckingham, Open University Press, 2006.
6 Ulla Peters / Janine Schöppen, „Narrative und schutzorientierte Ansätze in der Kinder- und Jugendhilfe“, in: Bundeszentrale der Kinderschutzzentren (Hg.), Sexuelle Gewalt an Kindern in familiären Lebenswelten, Kinderschutzzentren Köln, 2020, S. 219-234
7 Jessica Roy, „Signs of Safety: The View From Early Help“, in: Child Care in Practice, 28 (2022), 3,
S. 482-498, hier 492.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
