Luxemburg an der Schwelle zum Superwahljahr
Einführung ins Dossier
Was für die Astronomie die hybride Sonnenfinsternis, ist für Luxemburgs Politik das Superwahljahr: ein Ereignis mit absolutem Seltenheitswert. Weil die Chamber alle fünf, die Gemeinderäte aber nur alle sechs Jahre gewählt werden, begegnen sich Kommunal- und Nationalwahlen alle 30 Jahre in ein und demselben Kalenderjahr. Macht im günstigsten Fall drei Superwahljahre innerhalb eines aktiven Wählerlebens.
Im Gegensatz zu Sonnenfinsternissen sind Superwahljahre aber nicht bis in alle Ewigkeit mathematisch fixiert. Eine krachende Regierungskrise mit vorzeitiger Auflösung des Parlaments, und schon muss das Verhältnis der Wahlzyklen zueinander neu berechnet werden. Die vorgezogenen Neuwahlen von 2013 haben das ursprünglich für 2029 programmierte Superwahljahr um ganze sechs Jahre nach vorne verschoben.
Auch die Reihenfolge der Wahlgänge ist mittlerweile eine andere. In Superwahljahren alter Prägung, das letzte war 1999, gingen im Mai oder Juni die Chamber-, im Oktober die Kommunalwahlen über die Bühne. So war es seit jeher, so waren es die Luxemburger gewohnt. Im Gefolge des politischen Erdbebens von 2013 ging dieser Rhythmus dann verloren. Seither waren beide demokratischen Rendezvous für Oktober terminiert.
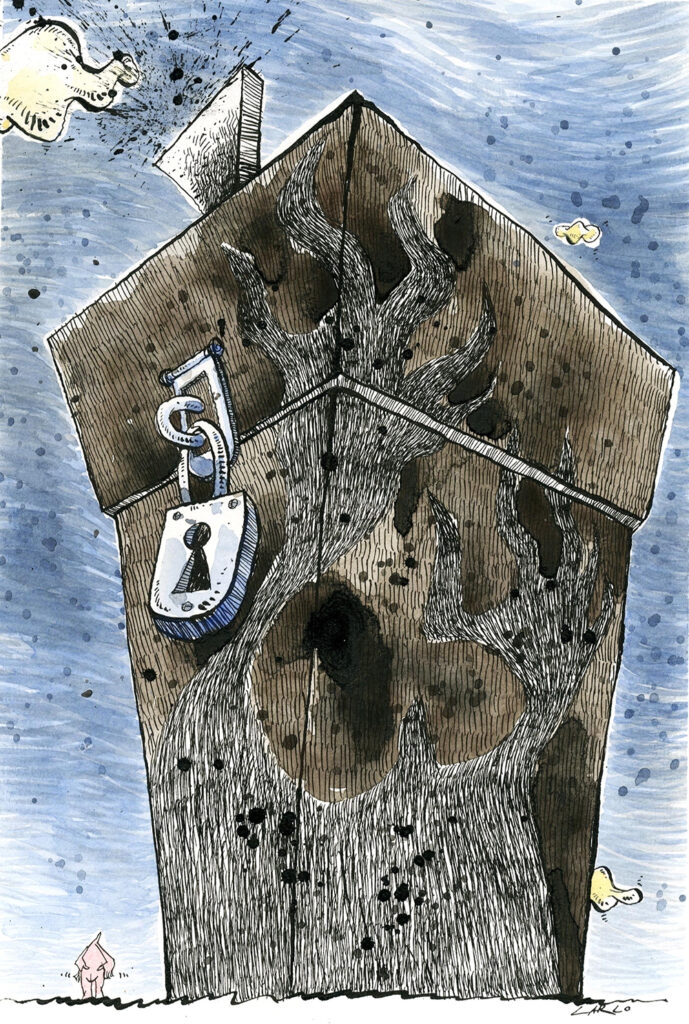
Um jene totalste aller politischen Eklipsen aus nachvollziehbaren, indes nicht zwingenden Gründen zu vermeiden, musste für 2023 eine Lösung her: die zeitliche Trennung der zwei Großereignisse um ein paar Monate. Wobei die vom Gesetzgeber zurückbehaltene Formel diesem kaum zur Ehre gereicht.
Par ordre de mufti verfügten die 60 Deputierten, die Mandatszeit von hunderten für volle sechs Jahre gewählten Volksvertretern in 102 Gemeinden mal eben so um vier Monate zu verkürzen. Viel korrekter, weil großzügiger und demokratietheoretisch schlüssiger wäre die umgekehrte Lösung gewesen: In einem souveränen Gentle(wo)men’s Agreement hätten sich die Parlamentarier beizeiten über die Auflösung der Chamber im Spätfrühling 2023 und die Abhaltung vorgezogener Nationalwahlen im Juni verständigt. Der seit jeher vertraute elektorale Terminkalender wäre wieder im Lot gewesen, die vielen ehrenamtlich engagierten Kommunalpolitiker hätten sich von den Berufspolitikern am Krautmarkt respektiert gefühlt. Sei’s drum: Auch im Hohen Haus sitzt das Hemd womöglich näher als der Rock.
Das Vertrauen bröckelt
Ein Blick über die Grenzen genügt, um zu erkennen, dass über Jahrzehnte geformte Parteienlandschaften, so unerschütterlich robust sie auch scheinen mögen, keine Konstruktionen für die Ewigkeit sind. Jüngstes Beispiel ist Frankreich, wo an die Stelle der moderat rechten und linken Traditionsparteien von einst neue Akteure von extrem rechts über windig mittig bis radikal links getreten sind. In Belgien und den Niederlanden haben die Christdemokraten ihre dominante Position als unverzichtbare Scharnierparteien längst verloren, im katholischen Stammland Italien wurden sie gänzlich pulverisiert. Selbst die deutschen Unionsparteien als Sammelbecken bundesrepublikanischen Mainstreams ringen neuerdings mit der Sinnkrise und kranken, je nach Geografie und sozioökonomischer Gemütslage, an Wählerabwanderung in alle Himmelsrichtungen.
Hinzu kommt, Corona brachte es an den Tag, die Erosion des Grundvertrauens in die demokratischen Institutionen und einen funktionierenden Rechtsstaat. Biedere Bürgerlichkeit flirtet mit Verschwörungstheorien, Wohlwollen weicht Ressentiments, Citoyens mutieren zu Wutbürgern. Ist der emanzipatorische Universalismus etwa ein Auslaufmodell? Spielt der Sound der Zeit in den digitalen identitären Echokammern?
Auch im Parteiengefüge reflektiert sich die Verfasstheit einer Gesellschaft. So gesehen erscheint das vorgebliche Wohlstandswunderland Luxemburg, bei allen Vorbehalten, immer noch als Hort der Stabilität. Auch das Superwahljahr 2023 dürfte nach heutigem, Ilres-basierten Ermessensstand diesbezüglich keine tektonischen Umwälzungen bringen. Was wiederum nicht heißt, dass die politische Klasse den kommenden Monaten mit leidenschaftslosem Gleichmut entgegensieht.
Denn für die laut Umfragen immer noch stärkste Partei im Land, die CSV, geht es 2023 fast schon um Existenzielles. Ihr Selbstverständnis als geborene Regierungskraft ist historisch in Stein gemeißelt. Opposition? Mist. Den seit zehn Jahren griesgrämigen Mienen auf den CSV-Bänken ist anzusehen, dass machtfreie Politik einfach keinen Spaß macht.
Ein Blick zurück
Nach der Zäsur von 2013 schien es lange so, als ob am 14. Oktober 2018 alles wieder gut würde. Doch es kam bekanntlich anders. Die Christsozialen fielen unter die psychologisch bedeutsame Marke von 30 % der Stimmen, dank derer sie sich lange Zeit markant von der Konkurrenz abgehoben hatten. Am Ende fehlte ihnen nur ein klitzekleiner Sitz, und die blau-rot-grüne Regierungsmehrheit wäre futsch gewesen.
Ein Jahr zuvor, bei den Kommunalwahlen am 8. Oktober 2017, hatte die CSV noch triumphiert. Erstmalig war ihr der Sorpasso gelungen, die LSAP als stimmen- und sitzstärkste Kraft in den Proporzgemeinden zu überflügeln. In der Stadt Luxemburg hatte sie mit Serge Wilmes die Rückkehr in den Schöffenrat geschafft, in Esch/Alzette mit Georges Mischo gar den Bürgermeisterstuhl erobert. Auffällig war, dass die CSV in den allermeisten Proporzgemeinden, wo dies arithmetisch möglich und politisch vertretbar war, eine Koalition mit den Grünen gebildet hatte – falls nötig mit Beteiligung eines dritten Juniorpartners. Ja, man konnte geradezu den Eindruck gewinnen, als ob déi gréng, in weiser Voraussicht dessen, was die Spatzen im Frühsommer 2018 von den Dächern pfiffen, für einen Schmusekurs mit der CSV optiert hatten.
Ob so viel Harmonie standen in den nachfolgenden Monaten – zumindest bis zu den Sommerferien 2018 – alle Signale auf Schwarz-Grün. Auch die Umfragen zeugten von hoher Akzeptanz, ja Sympathie für jene zum Greifen nahe Premiere auf Regierungsebene. Dann aber, im Endspurt des Wahlkampfs, verließ die CSV offenbar der innovative Mut. Etliche Parteigranden vom wirtschaftsliberalen Flügel ließen plötzlich ihre uneingeschränkte Präferenz für ein Bündnis mit der DP erkennen (mit Junckers früherem Lieblingspartner LSAP war das Tischtuch seinerzeit zerschnitten). Spitzenkandidat Claude Wiseler schaltete auf maximale Vorsicht. Resultat: Potenzielle CSV-Wähler mit Öko-Penchant und DP-Aversion entschieden sich auf den letzten Metern, vielleicht sogar erst in der Wahlkabine, für die taktisch sicherere Wahl. Der selbstvergessene CSV-Traum von der Gnade der prädestinierten Wiedergeburt mündete in betretene Ratlosigkeit, gefolgt vom selbstzerstörerischen Tohuwabohu der Präsidentschaft von Frank Engel … welcher zurzeit seine Ambitionen als Spitzenkandidat der neugegründeten Fokus-Partei kultiviert und hofft, dass seine nicht eben kleine Fangemeinschaft aus der CSV und anderswo ihm die notwendigen Stimmen für (s)einen – schwer vorstellbar, dass es mehr werden könnten – Parlamentssitz beschert.
Aus der inhaltlichen Zwickmühle im weiten Spannungsfeld von Klimakämpfern, Klimabesorgten, Klimagleichgültigen, Klimaskeptikern und Klimaleugnern findet die Volkspartei CSV seit jenem traumatischen, folgenschweren Wahlabend in der Bonneweger Rotunde nicht mehr heraus. In einer epochalen Domäne wie dem drohenden Klimakollaps, wo der sonst übliche Handlungs- und Verhandlungsspielraum zwischen „ideologisch“ und „pragmatisch“, zwischen Wünschenswertem einerseits und Machbarem andererseits nicht mehr gilt, stößt die altbewährte Methodik des behutsamen Austarierens von Sowohl-als-auch-Kompromissen, die niemandem wehtun und alle irgendwie zufriedenstellen, an ihre systemimmanenten Grenzen. Denn in der Klimafrage gelten vollkommen andere, auf nüchternen naturwissenschaftlichen Fakten basierende Maßstäbe, sprich: „richtig, weil notwendig“ oder „falsch, weil ungenügend“. Und ja, der Paradigmenwandel im Denkansatz betrifft alle Parteien, alle Akteure, alle Bürgerinnen, alle Bürger. Bei der CSV – und ihren europäischen Schwesterparteien – aber nagt er am hundertjährigen Catch-all-Markenkern. Was bleibt, ist Unbehagen, ein diffuses Gefühl der permanenten Überforderung vor einer Menschheitsaufgabe, die nach gängigem Ermessen kaum noch zu bewältigen ist.
Wer geht voran?
Trotz alledem: Natürlich braucht eine Partei von der Statur der CSV auch einen nationalen Spitzenkandidaten. Die Sprachregelung, wonach man letztes Mal mit Claude Wiseler zwei Jahre zu früh dran war, ist hingegen Quatsch. Weil die Entscheidung aus damaliger Perspektive richtig war und es galt, eine seriöse Alternative zum zwar charismatischen und hyperaktiven, dafür aber wenig dossierfesten, geschweige denn staatsmännischen Xavier Bettel aufzubauen. Wiselers Problem war zuletzt auch, dass ein beachtlicher Teil der Luxemburger nach Ende der stolzen Juncker-Jahre die Qualitätsansprüche an das premierministerliche Profil merklich heruntergeschraubt hatte und dem belesenen Studienrat mit Doktortitel eine Rampensau mit hohem Unterhaltungswert vorzog.
Zur Stunde jedoch drängt sich bei den Christlichsozialen niemand ins Scheinwerferlicht. Die demoskopischen Werte sind schlecht und die Lust, sich um der guten Sache willen für die Partei aufzuopfern, entsprechend gebändigt. Doch welche Parteigrande käme überhaupt in Frage? Claude Wiseler? Hatte schon mit dem Karriere-Schlussstrich geliebäugelt, ließ sich dann aber pflichtbewusst als Parteichef rekrutieren. Martine Hansen? Gilt als reinrassige Agrarierin. Gilles Roth? Wirkt, was er ja auch ist, wie ein typischer Speckgürtel-Bürgermeister. Léon Gloden? Distinguiert und gut gekleidet. Serge Wilmes? Will Hauptstadtbürgermeister werden. Laurent Mosar? In einem früheren Leben Chamberpräsident, heute shitstormerprobt auf Twitter. Christophe Hansen? Gewieft auf europäischem Parkett; hat letzthin im Luxemburger Wort die katholische Stammwählerschaft geschockt. Marc Spautz? Weiß um die Sorgen der kleinen Leute. Michel Wolter? Noch zwei Legislaturen, und der Allzeitrekord von Emile Reuter ist geknackt. Luc Frieden? Hat was von Friedrich Merz.
Die Namen Xavier Bettel (DP) und Paulette Lenert (LSAP) gelten demgegenüber als gesetzt. Premier Bettel wird am Wahltag doppelt so lange im Amt sein wie 1979 die liberale Legende Gaston Thorn. Vizepremier- und Anti-Coronaministerin Lenert bringt derweil ihre Partei ins Träumen, weil ausgerechnet sie, die Quereinsteigerin ohne Stallgeruch, es schaffen könnte, als erste Frau und erste LSAP-Repräsentantin überhaupt ins Staatsministerium einzuziehen. Unter den aktuell 46 Mitgliedsländern des Europarats gibt es außer Luxemburg nur fünf, die noch nie von einem sozialdemokratischen Staats- oder Regierungschef geführt wurden (Armenien, Aserbaidschan, Liechtenstein, Lettland, Monaco). Ein kurzer Blick auf die Liste dürfte genügen, um der traditionsreichen großherzoglichen Aarbechterpartei die Schamesröte ins Gesicht zu treiben.
Frage: Wäre Altmeister Jean Asselborn im Dienste der Parteiglorie bereit, auf sein geliebtes Außenministerium zu verzichten, um sich fortan ganz dem Radsport zu widmen und Platz zu machen für Xavier Bettel, der im Diplomatieressort – wie weiland der große Thorn – ganz bestimmt bella figura machen würde? Im Gegenzug würde der blaue galantuomo sein Büro in Sankt Maximin für „Paulette nationale“ räumen.
Kommt der Block?
Oder ist er schon da?
Während sich déi Lénk in ihrer parlamentarischen Oppositionsrolle als geradlinige Kämpferinnen und Kämpfer für linke Überzeugungen recht wohl fühlen und dabei auf ein verlässliches Sympathiekapital bauen können, haben die ursprünglich nicht minder idealistisch gesinnten Grünen über die letzten Jahre eine gewisse Expertise im Krötenschlucken entwickelt und erlitten Kratzer am autosuggestiven Image der moralischen Unbeflecktheit. Dennoch würden sie auch nach 2023 – Klimawandel und Artensterben obligent – gerne in Regierungsverantwortung bleiben. Selbstredend unterscheiden sie sich darin kein Jota von ihren beiden Koalitionspartnern.
Für die größte Oppositionspartei wird die Ausgangslage damit noch diffiziler: Wurde 2018 generell mit dem gottgewollten Comeback der CSV gerechnet, prognostizieren die Meinungsforscher den Mehrheitsparteien seit geraumer Zeit konstant um die 31 bis 32 Sitze. Viele Beobachter halten es mittlerweile für eine ausgemachte Sache, dass DP, LSAP und déi gréng – insofern es die Arithmetik erlaubt – auch nach dem nächsten Urnengang weitermachen werden. Implizit würde das bedeuten, dass Luxemburgs Politik mehr als ein Jahrhundert nach dem antiklerikalen Bloc des gauches, der von 1908 bis 1912 die Liberale Liga und die Sozialdemokratische Partei gegen das katholische Lager zusammenschweißte, erneut von bipolarer Blocklogik dominiert würde. Übrigens kein unattraktives Kalkül aus Sicht der „Gambia“-Allianz: Müsste die CSV fünf weitere Jahre in der Opposition schmoren, dürfte sie endlich und endgültig zu einer stinknormalen Unter-20-Prozent-Partei schrumpfen.
Ein Gedankenspiel, mit dem sich bestimmt auch die alternativ-demokratischen Reformer von der ADR anfreunden könnten. Wie in Deutschland, Österreich, Frankreich oder ehedem der Ersten Republik in Italien bündeln die alten Volksparteien, zumal die mit dem sinnentkernten „C“ im Namen, noch einen Teil des patriotischen, traditionsbehafteten und nationalkonservativen Wachstumspotenzials. Andererseits stellt sich in einem immigrationsgeprägten, finanzstarken und europafreundlichen Land wie Luxemburg die Frage, ob die gläserne Decke für heimattümelnde Putin-Versteher nicht doch fühlbar tiefer schwebt als z. B. in Lothringen oder Sachsen.
Doch Vorsicht vor falschen Schlüssen! Auch hierzulande mangelt es mitnichten an enttäuschten Protestwählern, im Gegenteil. Wahlanalysen zufolge machten 2018, vor allem in sozial schwächeren Sprengeln, viele ihr Kreuzchen bei Sven Clement und seinen Piraten, die überraschend 6,45 % erzielten. In der Chamber entpuppte sich der umtriebige Neu-Abgeordnete als political animal: ein begnadeter Selbstdarsteller mit einem Schüsschen Populistensenf und feinem Gespür für unterschiedlichste, aber ernstzunehmende Stimmungen im Volk. Und so kommt es, dass Luxemburgs Piratenpartei heute keineswegs nur die paar um digitale Bürgerrechte besorgten Geeks anspricht, sondern im weltweiten Netzwerk von rund 40 gleichgesinnten Organisationen eine der erfolgreichsten, wenn nicht gar die wählerstärkste überhaupt ist. Wer weiß, was da noch alles kommen mag? Vielleicht der Eintritt in eine nächste Regierungskoalition? Aus dem eben skizzierten Dreierblock würde dann ein zünftiger ménage à quatre … rein politisch, versteht sich.
Das Dossier im Überblick
An einer forum-Umfrage zum Superwahljahr haben sich acht von neun angeschriebenen Parteien beteiligt. Wir wollten von ihnen wissen, was die Reihenfolge der Wahlen sowie der kurze Abstand zwischen Kommunal- und Chamberwahlen im Juni und Oktober für sie bedeutet. Weitere Fragen beziehen sich auf die Haltung der Parteien zu den Doppelmandaten sowie den SYVICOL-Vorschlag, die Einwohnergrenze zur Umstellung vom Majorz- auf das Proporzsystem zu erhöhen. Außerdem wollten wir wissen, was die Parteien dafür tun, ausländische Bürger*innen für das aktive und passive Wahlrecht zu begeistern. Liest man die Antworten, wird eines ganz deutlich: Der Ausgang der Kommunalwahlen wird einen großen Einfluss auf die Aufstellung der Listen für den Oktober haben. Noch nie hatte eine Gemeindewahl in Luxemburg so eine große nationale Bedeutung. Ob das für kommunale Belange gut ist, bezweifeln wir, sodass Frank Engels Vorschlag, die Wahlen doch besser an einem Tag stattfinden zu lassen, gar nicht so abwegig war. Leider kam diese Idee effektiv zu spät.
In Europa gibt es nur drei Länder, in denen Wahlpflicht besteht: Belgien, Liechtenstein und Luxemburg. Mit Blick auf die international stetig zurückgehenden Wahlbeteiligungen sowie die historischen Kämpfe, die für die Durchsetzung des allgemeinen Wahlrechts gefochten wurden, ist das eigentlich eine gute Sache. Und doch identifiziert Michel Pauly in seinem Beitrag einen Widerspruch: Denn unserer Wahlpflicht steht die Tatsache gegenüber, dass ein Verstoß gegen diese Pflicht zum letzten Mal vor 58 Jahren bestraft wurde. Deshalb fordert er: „Entweder muss der Verstoß gegen die Wahlpflicht auch geahndet werden, oder die Wahlpflicht gehört abgeschafft.“
Pierre Lorang macht sich in seinem Beitrag Gedanken über eine mögliche Direktwahl von Bürgermeister*innen. Er ärgert sich über den Klüngel, mit dem vielerorts nach Gemeindewahlen in Luxemburg Posten und Pöstchen verteilt werden – was bei vielen Wähler*innen regelmäßig für Frust und Wut sorgt.
Unweigerlich lässt Alex Bodrys Beitrag über die députés-maires Luxemburg als gallisches Dorf erscheinen. Entgegen allen internationalen Trends weigert sich das hiesige System beharrlich, die Kumulierung politischer Ämter zu begrenzen. Auch aus eigener Erfahrung jedoch kann der Autor berichten, wie schwierig es ist, ein Bürgermeister- und ein Abgeordnetenmandat unter einen Hut zu bringen. Bodry plädiert daher für ein Ende der députés-maires.
17. April 2023, 17 Uhr. Diesen Termin sollten sich alle volljährigen Ausländer*innen, die in Luxemburg leben, merken, denn bis dahin kann man sich in die Wahllisten für die Kommunalwahlen eintragen. Neben allerlei Zahlenmaterial zur Wahlbeteiligung der letzten Jahre und den Eintragungsraten bietet der Beitrag von Nénad Dubajic vom Centre d’étude et de formation interculturelles et sociales (Cefis) viele Argumente, warum die Wahlbeteiligung ausländischer in Luxemburg lebender Bürger*innen von so großer Bedeutung ist. Er fordert in dieser Hinsicht auch mehr Engagement von den Ministerien, den Gewerkschaften, den Berufskammern, Gemeinden und allen zivilgesellschaftlichen Vereinen, um Ausländer*innen für ihr aktives und passives Kommunalwahlrecht zu sensibilisieren.
Serge Kollwelter erinnert anlässlich des Superwahljahrs daran, dass nicht nur das Wohnungsbauministerium, sondern auch die Gemeinden die Verantwortung haben, sich des Themas anzunehmen, das den Luxemburger*innen laut Politbarometer die größten Sorgen bereitet: dem Wohnungsbau. Obwohl die Gemeinden 75 % der Kosten für die Errichtung oder den Erwerb bezahlbaren Wohnraums erstattet bekommen, werde kaum Gebrauch davon gemacht. Und so fordert Kollwelter, dass die Parteien in ihren Programmen klipp und klar angeben sollten, wieviel sozialen Wohnungsbau sie in der nächsten Legislaturperiode zu errichten vorhaben.
Pit Panther ist in dieser Ausgabe mal wieder vom dritten Teil in das Dossier umgezogen: Auch ihn und Heinrich Heine lässt das Superwahljahr nicht kalt.
Ab Januar auf www.forum.lu
In unserer Rubrik forum+ bringen wir im Januar noch einen weiteren Beitrag zum Superwahljahr. Tommy Klein, Direktor von Ilres, wird die Akteure in den Blick nehmen, ohne die keine einzige Wahl stattfinden könnte und die, so Klein gegenüber forum, immer unberechenbarer werden: die Wähler*innen.
Außerdem werden wir einen neuen Fokus einrichten: „Erwartungen_2023“. Ganz im Sinne unseres Dossiers vom September 2018, in dem rund ein Dutzend Vereine und Interessensgruppen ihre „Erwartungen“ an die Parteien formuliert hatten, wollen wir nun im Laufe des Jahres die aktuellen Erwartungen und Forderungen aus der Zivilgesellschaft auf unserer Internetseite versammeln. Bitte senden Sie uns Ihre Erwartungen als PDF an forum@pt.lu. Sprachliche Vorgaben oder Umfangsbegrenzungen gibt es nicht.
HM
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
