Kampf dem Klüngel
Ein paar Gedanken zur möglichen Direktwahl der Bürgermeister
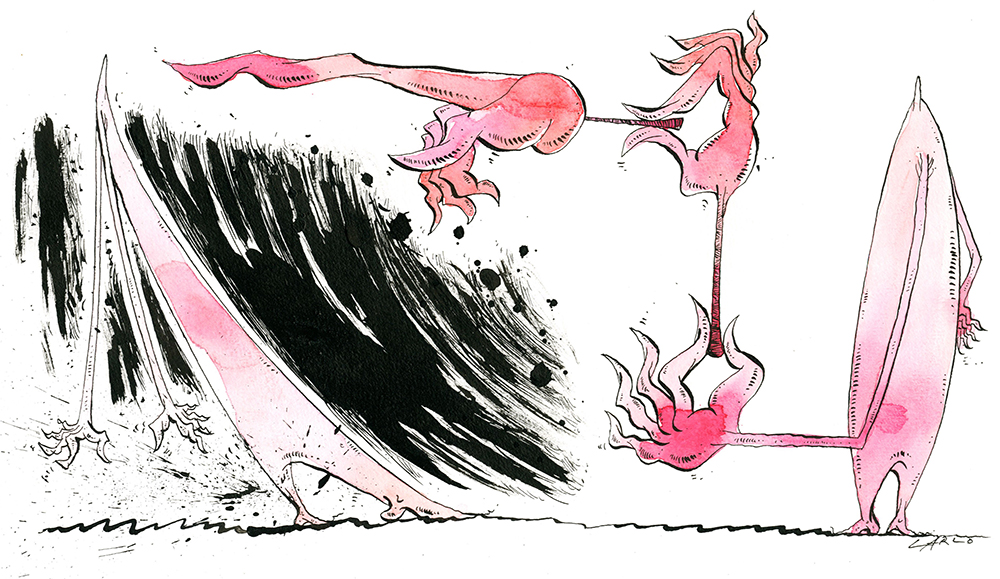
Wetten, dass es im Zuge des 11. Juni 2023, in den Tagen und Wochen nach geschlagener Kommunalwahl, hier und da im Ländchen wieder krachen wird? Dann nämlich, wenn aus vorgeblichen Gewinnern am Ende doch Verlierer werden und aus offenkundigen Verlierern plötzlich Gewinner. Wie gewohnt gilt dann: Same procedure as every time. Trauerzüge mit Sargträgern defilieren durch Gemeindehauptorte, um symbolisch die Demokratie zu beerdigen. Familien streiten beim Abendbrot, Blutsfreundschaften bluten aus, Arbeitskollegen schweigen sich eiskalt an, Stammtischbrüder und -schwestern canceln die wöchentliche Kegelrunde. Und wie immer füllen sich die Leserbriefseiten der Tagespresse und die Kommentarspalten der Onlinemedien. Überall Wut, Enttäuschung, Resignation. Meist zitierte Vokabel: „Wählerwille“. Meist formulierte Drohung: „Gehe nie wieder wählen.“ Meist verachtete Spezies: das politische Klüngelmonster.
Den Klüngel, den gibt es nicht nur in Köln. Ob Telefonleitungen glühend heiß laufen oder die Herrenrunde im Hinterzimmer tagt: Hütchenspiele, Postenschacher und Kuhhändel gelten zwar als unappetitlich, aber leider eben auch als feste Komponente im politischen Geschäft.
Wo geht’s hier zum Wählerwillen?
Zum besseren Verständnis hier ein simples, anschauliches und realistisches Beispiel:
In der Landgemeinde Z wurde jüngst die 3.000-Einwohner-Marke überschritten. Sie ist deshalb vom Majorz- ins Proporzsystem gewechselt. Der künftige Gemeinderat wird 11 Mitglieder zählen, die über Listen nach dem Verhältniswahlverfahren bestimmt werden. Die Lokalsektionen der Parteien machen sich auf die Suche nach je 11 erfolgversprechenden Kandidatinnen und Kandidaten. Partei A und Partei B treten mit vollständigen Listen an. Die Parteien D und E präsentieren gemeinsam eine offene Bürgerliste C, auf der auch parteiunabhängige Bewerber figurieren.
Am Wahltag beträgt der Anteil der Listenstimmen in Gemeinde Z nur rund 30 % der abgegebenen gültigen Stimmen. 70 % der Wähler haben persönliche Vorzugsstimmen verteilt und dabei größtenteils listenübergreifend panaschiert.
Nach Auszählung aller Wahlzettel lauten die Ergebnisse wie folgt: Liste A schneidet mit 35 % der gültigen Stimmen am besten ab und erhält 4 Gemeinderatssitze. Liste B kommt auf 33 % (4 Sitze), Liste C auf 32 % (3 Sitze). Der Spitzenkandidat der stimmenstärksten Liste A (Kandidat A1) bekam ein paar Dutzend Vorzugsstimmen weniger als sein Mitkandidat A2, der Erstgewählter auf der Liste wurde. Der Spitzenkandidat von Liste B (Kandidat B1) hat unter dem Strich mehr Stimmen auf dem Konto als seine jeweiligen Konkurrenten A1 und A2. Nummer eins in Gemeinde Z ist allerdings die Spitzenkandidatin von Liste C (Kandidatin C1). Als austretende Bürgermeisterin sieht sie sich mit ihrem hervorragenden persönlichen Score von der Wählerschaft plebiszitiert. Gegenüber der letzten Wahl vor sechs Jahren (damals noch im Majorzsystem mit Einzelkandidaturen statt Parteilisten) hat sie ihr Ergebnis als Bestgewählte sogar leicht verbessert.
Noch in der Nacht vom 11. zum 12. Juni treffen sich die Verantwortlichen der Parteisektionen A und B im Separee eines Restaurants im Hauptort der Nachbargemeinde Y zu ersten Sondierungsgesprächen. Bürgermeisterin C1 schaut sich derweil zu Hause im Fernsehen den „Tatort“ an und geht dann schlafen. Sie will ihre Kollegen A1 und B1 am Montagvormittag anrufen.
Ehe es dazu kommt, hört C1 beim Frühstück in den Morgennachrichten von radio 100,7 folgende Meldung: „In der neuen Proporzgemeinde Z haben sich die Parteien A und B auf eine Koalition für die nächsten sechs Jahre geeinigt. Mitglieder des Schöffenrats werden die Gewählten A1, A2 und B1. Der Bürgermeisterposten wird im Splitting geteilt. Die ersten zwei Jahre übernimmt A1 als Spitzenkandidat der stärksten Partei A. Auf ihn folgt von 2025 bis 2027 der koalitionsintern bestgewählte B1. Die letzten zwei Jahre wird dann A2 als Erstgewählter von Partei A im Chefsessel des Gemeindehauses sitzen. Die bisherige Bürgermeisterin C1 muss in die Opposition.“
C1 kann es nicht fassen, wie mit ihr, der populären Bürgermeisterin, verfahren wurde. Sie zögert kurz, dann startet sie das Laptop und öffnet ihre Facebook-Seite. Auf die bis dato so friedliche Landgemeinde Z kommen turbulente Zeiten zu …
Neue Formen der Demokratie
Wie gesagt, solche oder ähnliche Geschichten werden auch diesmal wieder dafür sorgen, dass die eine oder andere Kommune, ob klein, mittel oder groß, für lange, peinliche Wochen die (Negativ-)Schlagzeilen beherrscht.
Doch Hand aufs Herz, liebe Innenministerin, liebe SYVICOL-Honoratioren, liebe aufrichtig geschätzten Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker sowie – last, but not least – Ihr ausbaldowerten Stadtoberhäupter, Ortsvorsteher und Dorfschulzen: Seid Ihr ernsthaft der Meinung, dass all das (und noch allerhand mehr) der Begeisterung für Demokratie, Engagement, Partizipation und Bürgersinn förderlich ist? Falls ja: macht ruhig so weiter! Falls nein: Denkt mal darüber nach, den Unfug zu stoppen!
Wie fändet Ihr es zum Beispiel, wenn die Bürgermeister per Direktwahl bestimmt würden? Und dadurch zugleich deren Autorität und Legitimität gestärkt würde? Keine Angst, dies soll kein Plädoyer sein für die Abwertung der Gemeindeparlamente durch Einführung des Präsidialsystems auf lokaler Ebene. Kein Postulat für viele kleine Erdoğans. Aber wahr ist auch: Der überwiegenden Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger geht es bei Kommunalwahlen weniger um prestigeträchtige Kräfteverhältnisse zwischen politischen Parteien als vielmehr um die Entscheidung, welche Person mit welchem Profil und welchem Programm man sich konkret als obersten Repräsentanten der Gemeinde und Chef der kommunalen Verwaltung wünscht.
In vielen demokratisch gereiften Ländern Europas werden die Bürgermeister per absoluter Mehrheitswahl direkt vom Volk gewählt (bzw. sogar abgewählt). In Deutschland z. B. ist dies mit Ausnahme der drei Stadtstaaten mittlerweile in allen Bundesländern der Fall. Ähnlich verhält es sich in Österreich, der Schweiz und Italien. In der Regel ist der Posten hauptamtlich, in kleineren Kommunen kann er auch ehrenamtlich sein, wobei die Amtsperiode für direkt gewählte Bürgermeister oft länger ist als die Mandatsperiode der Stadt- oder Gemeinderäte.
Doch zurück ins klüngelnde Großherzogtum: Für die Hauptstädter fokussiert sich der 11. Juni 2023 vordringlich auf die Frage, ob Stadtmutter Lydie Polfer – sie war immerhin schon Hausherrin am Knuedler, als Helmut Kohl in Bonn Bundeskanzler wurde, in Berlin die Mauer fiel und auf Kirchberg die Rolling Stones auftraten – im direkten Vergleich mit ihren Challengern Serge Wilmes, Gabriel Boisante und François Benoy auch heute noch die bestmögliche Synthese verkörpert in puncto Persönlichkeit, Politik und Führungsstil. Die meisten Escher interessiert dagegen kaum, ob über ihrem Rathaus wieder die rote Fahne weht, sondern ob Newcomer Georges Mischo seine Sache gut gemacht oder ob er die historische Gelegenheit vermasselt hat.
Die Beispiele ließen sich endlos fortzitieren … ganz im Sinne der bewährten Maxime, die in abgewandelter Form auch für die 102 Gemeinden Luxemburgs gilt: Auf den Kanzler kommt es an.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
