- Gesellschaft
Global Citizenship: Eine Idee für alle – alle für eine Idee?
Annäherung an ein schwieriges Konzept
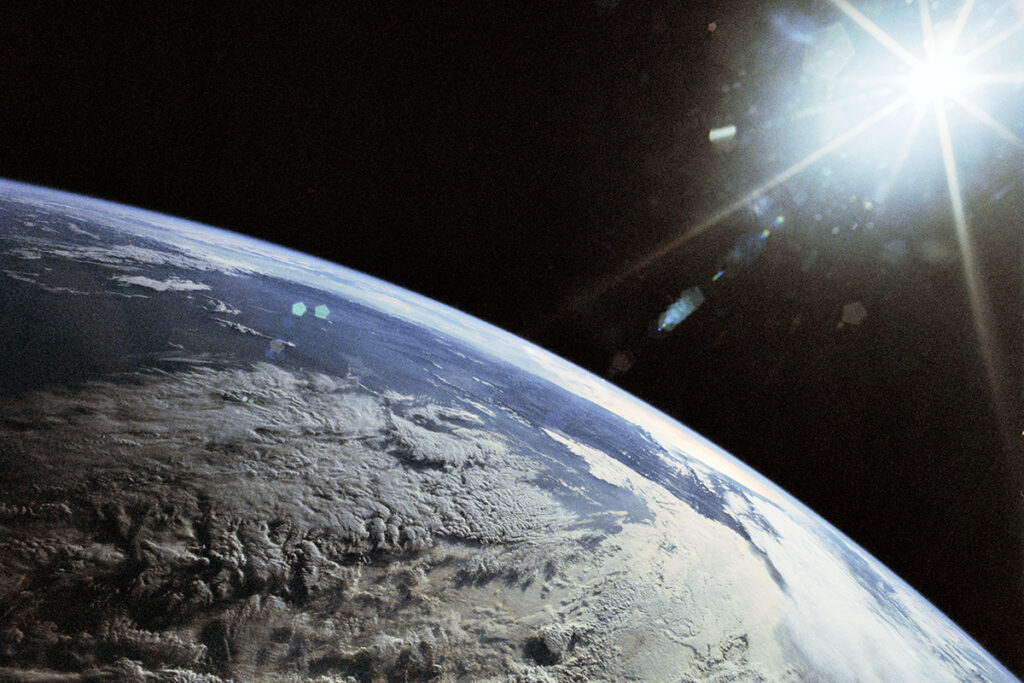
But if you believe you’re a citizen of the world,
you’re a citizen of nowhere.
You don’t understand
what the very word ‘citizenship’ means.
Theresa May
We are the world.
We are the children.
We are the ones who make a brighter day.
So let’s start giving.
Michael Jackson, Lionel Richie
Ehrlich gesagt: Ich habe mich nach wie vor nicht besonders eng mit der Idee Global Citizenship angefreundet. Je nach Perspektive ist das die beste oder die schlechteste Ausgangsposition, um diesen Artikel zu schreiben. Dabei hatte ich für die Annäherung ausreichend Zeit; seit Anfang letzten Jahres habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Die Skepsis ist nicht aggressiv oder polemisch, eher misstrauisch, darauf bedacht, es sich nicht zu einfach zu machen, sich nicht in den Windschatten eines Buzzwords zu begeben, um sich elegant durch die Gegenwart und deren Diskurse zu bewegen.
Postnationale Solidarität
Global Citizenship, das ist gleichermaßen transparent wie opak. Einerseits geht es um eine Weltbürgerschaft, eine citoyenneté mondiale, getragen von Menschen, die sich abseits ihres nationalstaatlichen Bezugs auf bestimmte Werte berufen und sich dementsprechend in Verbünden engagieren. Schließlich haben wir es heutzutage mit „veränderten Zugehörigkeitsgefühlen“1 zu tun, wie es die Philosophin Donatella Di Cesare formuliert. Das Selbstverständnis, ein Bürger mit Rechten und Pflichten zu sein, wächst sich immer weiter aus, bis es statt einer exklusiv nationalen auch eine globale Komponente beinhaltet.
Carlos Alberto Torres, Inhaber einer Professur für Global Learning and Global Citizenship Education an der University of California, schreibt 2020, der Begriff sei „an essential tool to not only build understanding across borders and cultures but to advance our social, political, economic, and environmental interconnectedness necessary to address global and local issues“2. In diesem jungen, kaputten 21. Jahrhundert klingt diese postnationale Solidarität sehr gut, diese transgressive Vorstellung eines anderen Zusammenlebens, die weltumspannende Verständigung, um das große Ganze zu retten, das Klima, den Frieden und ganz grundsätzlich die Zukunft.
Andererseits scheint vieles unklar: Wenn ich global sage, meine ich dann auch universell und/oder planetarisch? Geht’s hier um Weltbürger im historischen Sinne à la Goethe, um klimarettende Erdbewohner oder um Staatsangehörige neuester Art? Der Politologe Michael Byers weist bereits 2005 auf Widersprüche hin, die knapp zwanzig Jahre später noch deutlich ausgeprägter sind: „There are tens of millions of stateless people in the world today“, schreibt er. „They have no right to reside, vote, express opinions, associate, travel anywhere at all. Their lack of national citizenship and their consequential desperate need for governmental assistance and accountability makes them the most obvious candidates for Global Citizenship.“3 Auch gibt es gewiss viele Menschen, die bei dem Thema eher sagen würden: I prefer not to. In seinem Manifest Die Zukunft der Erdbewohner schreibt der Anthropologe Marc Augé, dass „eine gigantische intellektuelle Kluft zwischen der universalistischen Sprache“ einerseits und der „realen Situation der Menschen“ andererseits bestünde, „von denen ein bedeutender Teil […] sich nicht von einem Abenteuer einnehmen lassen kann, dessen genaue Umstände er nicht kennt“4.
Tappende Annäherungen
Als ich letztens einer guten Freundin von dem Thema erzählte, verlief das Gespräch erst einmal in den üblichen, ziemlich enttäuschenden Bahnen. Wie so oft war schnell von den Vereinten Nationen, der Globalisierung und der Klimakrise die Rede, irgendwann von der zombiehaften Wiederkehr der Nationen, von postkolonialer Kritik und westlicher Arroganz. Es gefiel mir nicht – nicht, weil das alles Unfug war, sondern weil wir im Ungefähren tappten, sehr weit weg von Augés „realer Situation“. Es gelang uns nicht, mit diesen vielen Hochwertbegriffen zielführend umzugehen. Ja, das hat alles sicherlich auf die eine oder andere Weise mit Global Citizenship zu tun. Wir wussten nur nicht, auf welche Weise; daher redeten wir einfach immer weiter. Glücklicherweise stellte die Freundin mir irgendwann eine Frage: Ob ich mich denn selbst als global citizen verstünde?
Es ist eine gute Frage, vor allem, weil in ihr die Unwägbarkeit mitformuliert ist, dass niemand zu wissen scheint, welchen Status die Global Citizenship denn nun besitzt: Steht dahinter eine private Haltung, ein staatsrechtliches Prinzip, eine politische Forderung oder eine gesellschaftliche Tendenz? Roland Bernecker, ehemaliger Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission, schreibt in einem Aufsatz, dass Global Citizenship „das Gefühl einer Zugehörigkeit zu einer großen menschlichen Gemeinschaft“ sei. „Sie betont dabei insbesondere die wechselseitige politische, ökonomische, soziale und kulturelle Abhängigkeit und die Wechselwirkungen zwischen dem Lokalen, dem Nationalen und dem Globalen“5.
Das scheint die Minimallösung zu sein, auch in Anbetracht der Tatsache, dass es keine weltumspannende Institution gibt, die die Autorität besitzt, Weltbürgerrechte und -pflichten zu etablieren. Also begeben wir uns eher auf das Terrain der Gefühle, der subjektiven Erfahrung, auch wenn das nicht die beste Grundlage für eine nüchterne gesellschaftspolitische Diskussion ist.
Selbstschau als Zugang
An besagtem Abend hatte ich nicht mehr die Muße, auf die Frage nach meinem Gefühl einzugehen – jetzt also, als verspätete Antwort, eine knappe Selbstschau: geboren in Luxemburg; ebenda ausgebildet in einem am Ende quasi fünfsprachigen Schulsystem, das mir Sprachen selten als interkulturelle Toolkits, eher als grammatische Maschinen vermittelt hat; jährlich mehrere Reisen seit der Kindheit, zuerst innerhalb Europas, dann quer über alle Kontinente, seit einigen Jahren wieder vermehrt innerhalb Europas; ein Studium abgeschlossen in Deutschland; in der Zeit Seminare belegt zur Weltliteratur und zur Global History; seit einigen Jahren durch die Arbeit als Selbstständiger am Pendeln zwischen Deutschland und Luxemburg; bei alledem das Ausland ausschließlich als Chance erfahren, nie als Gefahr oder Unwägbarkeit; dessen ungeachtet nie die Selbstverständlichkeit erlangt, meine Biografie als besonders inter-, trans- oder postnational zu betrachten; ebenso wenig die Überlegung angestellt, ein Konzept wie Ausland grundlegend in Frage zu stellen.
Ich bin mir ziemlich sicher, was die Freundin mir antworten würde: Nichts davon qualifiziert dich dazu, dich als global citizen zu betrachten. Ich würde ihr zustimmen. (Ich habe ja schon Probleme damit zu erklären, inwiefern ich mich als europäisch bezeichnen würde.) Wenn überhaupt, dann lässt sich dem biografischen Abriss die Warnung entnehmen, global in diesem Fall nicht mit mondän, mobil oder weltgewandt zu verwechseln. Herkömmlicher Tourismus, Sprachkenntnisse, kulturelle Prägung, kulinarisches Interesse, arbeitsbedingtes Pendeln: Das alles führt nicht notwendigerweise zu einem weltbürgerlichen Bewusstsein. Schlimmstenfalls ist das Gegenteil der Fall: Der Kitsch, mit dem ein weltoffener Habitus zelebriert wird, verdeckt, wie borniert jemand ist.
Ich kenne insgesamt wenige Menschen, die sich als global citizens bezeichnen würden – und das aus unterschiedlichsten, teils gut nachvollziehbaren Gründen: weil sie die Idee technokratisch finden, den Anspruch dahinter megalomanisch oder diffus, weil es sie nicht interessiert, weil sie im Universalismus eine weitere Ideologie sehen, der sie skeptisch gegenüberstehen.
Luxemburg als Exempel
An dem bereits angesprochenen Abend sprachen wir dann noch über Luxemburg und die Gleichzeitigkeit von Gestern und Morgen, von Herkömmlichem und Sonderbarem, eine Erfahrung, die das Leben hier so eigenartig macht. Ab und zu strahlt einen das Land so progressiv und einundzwanzigstesjahrhunderthaft an, mit den vielen Nationalitäten auf den Straßen, den zahlreichen Sprachen im Ohr und einer bemerkenswerten Liberalität. Dann wiederum blökt es einen unerwartet regressiv an, wenn sich der stereotype Luxemburger Lifestyle zeigt – der Degout für d’Heckefransousen, d’Praisen an d’Jughurten, die unerträgliche Selbstgewissheit, den Reichtum des Landes höchstpersönlich mitverdient zu haben, die Verteidigungshaltung, wenn es um die Umverteilung von Chancen und Privilegien geht.
Tatsächlich lässt sich einiges über das Thema in Erfahrung bringen, wenn man sich das Großherzogtum samt seiner gesellschaftspolitischen Widersprüche anschaut. So gelangt man auch endlich einmal in Augés verzweifelt verlangte „reale Situation“, die sich in Bezug auf die Fragestellung so selten einstellt.
Alles ist bekannt, im Kleinen wie im Großen: die mehr als 210.000 Grenzgänger, die Tag für Tag nach Luxemburg kommen; die 179 Nationalitäten, die 2022 im Land erfasst wurden; die Nation-Branding-Autofellatio, um sich als dynamisch, offen und zuverlässig auszuweisen; das Referendum von 2015, bei dem u. a. das Ausländerwahlrecht mit gut 78 % der Stimmen abgelehnt wurde; „je kleiner das Land, desto größer das Ausland“, © Jacques Santer; seit einigen Jahren der zweite Platz beim sogenannten Overshoot Day, bei dem weltweit verglichen wird, wie schnell einzelne Länder Ressourcen verbrauchen; „man stößt sehr schnell auf breitere Räume, wenn man Luxemburger ist“, © Jean-Claude Juncker; die rhetorischen Manöver, um den Widerspruch zu meistern, einerseits ein kleines Land mit einer angeblich widerborstigen Identität zu sein, andererseits wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich längst in ganz anderen, supra- und postnationalen Tüchern zu stecken.
Die Einwohner und Erwerbstätigen in Luxemburg sind auf gewisse Weise längst global citizens.
Ob sie es wollen oder nicht, ob sie es wissen oder nicht und ganz gleich, ob sie es als positiv oder negativ wahrnähmen: Die Einwohner und Erwerbstätigen in Luxemburg sind auf gewisse Weise längst global citizens. So unterschiedlich und partikular ihre Biografien auch aussehen, so sehr ist ihre lebensweltliche Realität in Bezug auf Reisen, Kommunikation, Konsum, sozialen Austausch, nationales Selbstbild und politische Programme doch geprägt von Einflüssen und Angeboten, die das Nationale bei weitem übersteigen. Gerade in Luxemburg, diesem komprimierten Raum, der einem Durchlauferhitzer gleicht, wird diese Tendenz in aller Widersprüchlichkeit deutlich, auch wenn es sicherlich auch auf alle anderen Länder zutrifft. Das ist gewissermaßen die andere Seite der Medaille: Platz 2 beim Overshoot Day, dafür aber auch einer der ersten Räume, in denen sich eine Dynamik wie Global Citizenship niederschlägt.
Das heißt auch: Es ist irrelevant, ob ich mich eigens zum global citizen adele. Die Frage, die mir die Freundin stellte, läuft ins Leere. Es steht mir als Einzelnem nicht zu, die Bezeichnung souverän anzunehmen oder sie zu verweigern. Global Citizenship ist viel eher eine zeithistorische Wirkkraft, die jeden auf die eine oder andere Weise erfasst. Die Arbeit – und die einzige Aussicht darauf, handlungsfähig zu sein – besteht vor diesem Hintergrund darin, dieses Label nicht nur als Privileg globalisierter Freiheit zu feiern. Es gilt stattdessen, es ebenso als politisches, ökologisches und soziales Problem zu betrachten, zu dem ein jeder in komplexer Beziehung steht. Schließich ist, schreibt Augé, „die Realität der Globalisierung weit entfernt von den Idealen einer weltumspannenden Vergesellschaftung (planétarisation), einer Weltgesellschaft, deren rechtlich und faktisch gleiche und freie Bürger sich den Raum im Interesse des gemeinsamen Nutzens teilen“6.
Global Citizenship als Haltung
So kann auf die Erfahrung, das Objekt, schlimmstenfalls das Opfer einer überindividuellen historischen Entwicklung zu sein, eine neue Haltung folgen: Das sind die veränderten Begebenheiten, nun gut, dann sind das hier meine proaktiven Lösungsansätze. Bestenfalls decken sie sich mit den Ideen anderer. Dadurch entstehen Verbünde, solidarische Eingriffe, Hoffnungen. Erst an dieser Stelle ergibt das staatstragende Wort Citizenship samt dem Pathos von Bürgerpflicht und emanzipativer Aktion Sinn. Bis dahin bleibt es eine Nebelkerze, die einem die Sicht nimmt.
„We are all migrants now“7, das sagte 1989 der Soziologe Stuart Hall. 2017 pflichtete ihm sein britischer Kollege Anthony Giddens mit der identischen Formulierung bei, die gewiss manche Einwände und Nuancierungen verdient.8 Ich zitiere den Satz hier aber lediglich, um ihn als Sprungbrett zu benutzen. „We are all global citizens now“, das trifft die Sache, meine ich, besser. Letztlich geht es darum, sich einer Tatsache bewusst zu werden, unter deren Einfluss man längst steht, und sich ihrer anschließend zu bemächtigen.
Gut möglich, dass einem dabei auffällt, wie unzureichend oder altersschwach die Global Citizenship ist. Aber auch das wäre bereits Teil einer Lösung: neu und beharrlich danach zu fragen, wer we ist, wann now ist und inwiefern Universalität und Globalität miteinander vereinbar sind. Gegebenenfalls würde man dann feststellen, dass die Global Citizenship lediglich ein Hilfsvehikel auf dem Weg in eine neue Zeit ist, für die uns – Stand: heute – ganz offensichtlich die passenden Worte und Taten fehlen.
1 Donatella Di Cesare, Philosophie der Migration, Berlin, Matthes & Seitz, 2021, S. 270.
2 Carlos Alberto Torres / Emiliano Bosio, „Global citizenship education at the crossroads: Globalization, global commons, common good, and critical consciousness“, in: Prospects 48 (2020), S. 99-113, S. 104.
3 Michael Byers, „What, if anything, does Global Citizenship mean?“ (Vortrag von 2005).
4 Marc Augé, Die Zukunft der Erdbewohner. Ein Manifest, Berlin, Matthes & Seitz, 2019, S. 24.
5 Roland Bernecker / Ronald Grätz (Hg.), Global Citizenship – Perspektiven einer Weltgemeinschaft, Göttingen, Steidl Verlag, 2017.
6 Augé, Zukunft, a. a. O., S. 45.
7 Zit. n. Andreas Wimmer / Nina Glick Schiller, „Methodological nationalism and the study of migration“, in: European Journal of Sociology 43 (2002), 2, S. 217-240, 218.
8 Anthony Giddens im Gespräch mit Labinot Kunushevci, 15. November 2017: https://tinyurl.com/GiddensGC (letzter Aufruf: 21. Februar 2023).
Samuel Hamen lebt als freier Autor in Diekirch und Heidelberg. Im April dieses Jahres erscheint sein neuer Roman Wie die Fliegen bei Diaphanes, Zürich. Er war in beratender Funktion an der Ausarbeitung der Veranstaltungsreihe zu Global Citizenship beteiligt, die 2023 von der Commission nationale pour la coopération avec l’UNESCO organisiert wird.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
