- Armut, Gesellschaft, Politik
Auf welchem Menschenbild die Sozialarbeit basieren sollte
Armut existiert auch in ausgeprägten Sozialstaaten wie Luxemburg. Die Sozialarbeit kann dagegen ansteuern – wenn sie unter den richtigen Paradigmen arbeitet.
Armut gibt es seit jeher. Armut besteht 2023 – auch in einem reichen Land wie Luxemburg –, und sie wird wohl auch nie verschwinden. Das mag desillusionierend klingen. Deswegen hier die gute Nachricht: Armut lässt sich abfedern und durch präventive Maßnahmen zum Teil sogar verhindern. Dafür braucht es allerdings eine effiziente und exakt kalibrierte Sozialarbeit. Sie hilft Betroffenen dabei, ihre Armut provisorisch oder definitiv zu überwinden.
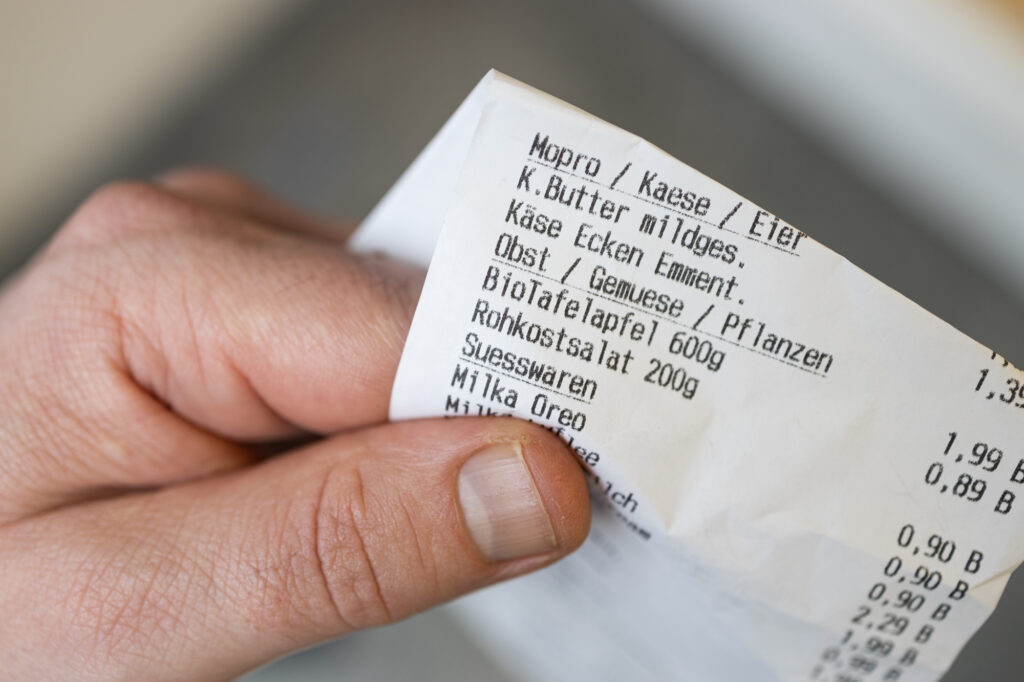
Doch um zu helfen, muss die Sozialarbeit einige grundlegende Dinge beachten.
Wer ist in diesem Land noch arm?
Zum Beispiel, wer in Luxemburg überhaupt als arm gilt: Das Armutsrisiko befand sich laut einer Schätzung des Statec 2022 mit 19,2 Prozent auf einem sehr hohen Niveau für Luxemburg. Die sozialen Transferleistungen senken das Risiko bereits um die Hälfte. Das bedeutet, dass das Armutsrisiko ohne jene viel höher wäre.1
Besonders betroffen sind dabei Familien mit drei oder mehr Kindern und Alleinerziehende. Insgesamt liegt eine von acht erwerbstätigen Personen mit ihrem Einkommen unter dem Existenzminimum.2 Bei Menschen, die zur Miete wohnen, liegt der Prozentsatz der erlebten Schwierigkeiten bei 40,2. De facto geben Mieter oft die Hälfte ihres Einkommens für ihre Miete aus. Vereinzelte Hilfen sind ein Tropfen auf den heißen Stein des angespannten Wohnungsmarkts.
Und: Es macht einen Unterschied, ob wir über reine Geldbeträge oder tatsächlich verfügbares Einkommen sprechen. Dazu ein vereinfachtes Rechenbeispiel ohne Beachtung von Sozialtransfers: Der soziale Netto-Mindestlohn liegt derzeit bei rund 2.000 Euro. Auf einen Monat gerechnet wären das 67 Euro pro Tag. Teilte man diesen Betrag bei einer dreiköpfigen Familie durch drei, so hätte jede Person am Tag 22 Euro zur Verfügung, die sie für Essen, Wohnkosten, Bekleidung, ihre Gesundheit oder Kultur und Reisen ausgeben könnte.
Kann man angesichts dieser Zahlen darauf schließen, dass Armut eine Minderheit betrifft und daher nur ein nebensächliches Politikfeld ist? Kann man annehmen, dass Arme selbst schuld an ihrer Situation sind, weil sie in einem der reichsten Länder der Welt unter einem ausgeprägten Sozialstaat leben? Diese Fragen mögen zynisch klingen. Und doch sind sie Teil eines geläufigen Narrativs über Armut und Sozialpolitik.
Grob verkürzt gibt es in der Gesellschaft zwei wesentliche Anschauungen: Da wäre zum einen die Anschauung, die staatliche Intervention auf ein Minimum zu begrenzen – sowohl, was finanzielle Hilfen als auch nicht-materielle Hilfsangebote anbelangt. Begründet wird diese Anschauung mit dem Argument, dass „wer will, auch kann“ und dass eine arme Person somit selbst schuld an ihrem Problem sei. Zu viele Hilfeleistungen würden die Menschen dazu ermutigen, nicht zu arbeiten, in ihrer Situation zu verweilen und vom Staat unterstützt zu werden, so die Behauptung. Diese Anschauung ist die liberale Variante.
Dann gibt es die Anschauung, nach der die Sozialpolitik als Pflichtfeld des Staates betrachtet wird. Man könnte sie auch als „demokratisch-humanistische Einstellung“ beschreiben. Sie teilt sich in zwei unterschiedliche Tendenzen: die sozialwissenschaftliche Variante, die auf Erkenntnissen der Gesundheitsgenese, der Psychologie und der Organisationslehre basiert, und die spirituell-humanistische Variante, die geschichtlich aus der Armutsarbeit der katholischen Kirche entwachsen ist.
Eine gute Sozialarbeit sollte Menschen dabei helfen, Lebenskrisen zu erkennen, deren Ursachen zu verstehen und zu meistern.
In der sozialarbeiterischen Praxis in Luxemburg sind alle drei Varianten präsent, weil sich alle Individuen und Organisationen auf den einen oder anderen Standpunkt stellen. Aus meiner Sicht vermag die humanistische Sichtweise dem Menschen als einzige der drei Anschauungen eine tatsächliche Perspektive zu eröffnen. Sie basiert auf dem Erlebten, dem Wissen und Können und dem Allerwichtigsten: dem Wunsch der Person nach Veränderung und ihrer Zuversicht, es zu schaffen.
Der Mensch hinter den Statistiken
Eine gute Sozialarbeit sollte Menschen dabei helfen, Lebenskrisen zu erkennen, deren Ursachen zu verstehen und zu meistern. Die Maßnahmen der Sozialarbeit sollten sich darauf ausrichten, einer Person ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und ihre Autonomie zu erhalten und zu fördern. Die Hilfestellungen können materieller oder nichtmaterieller Natur sein.
Die US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow und Carl Rogers haben ein Modell entwickelt, das sozialwissenschaftliches Handeln im humanistischen Sinne erlaubt.3 Im Rahmen dieses Artikels werde ich die Bedürfnis-Pyramide von Maslow als wissenschaftliche Basis für Sozialarbeit beschreiben.4
Nach Maslows Theorie müssen verschiedene Bedürfnisse erfüllt sein, damit sich eine Person nach und nach verwirklichen und ihr Wesen in idealer Weise für sich selbst und die Gesellschaft ausleben kann. Diese Entwicklung verläuft nicht immer linear: Es gibt Rückschläge in der individuellen Entwicklung, Umbrüche, Neuausrichtungen. Sei es krankheitsbedingt, aus familiären Ursachen oder wegen politischen Einflüssen wie Krieg.
Die Bedürfnispyramide nach Maslow setzt sich dabei aus verschiedenen Stufen zusammen: Auf der ersten Stufe stehen die physischen Bedürfnisse für das menschliche Überleben – etwa Nahrung, Atmung, Schlaf, Fortpflanzung. Auf der zweiten Stufe stehen die Sicherheitsbedürfnisse: Sie garantieren körperliche und seelische Unversehrtheit sowie finanzielle und soziale Sicherheit. Verliert der Mensch das Gefühl der Sicherheit, kann das zu Einstellungen und Handlungen führen, die sowohl für die Betroffenen als auch für ihre Umwelt riskant sein können. Ein Beispiel wären Erkrankungen wie Depressionen oder Extremreaktionen wie Amokläufe.
Danach folgen auf den weiteren drei Stufen die Sozialbedürfnisse von Gemeinschaft, Liebe und Zugehörigkeit (Stufe Drei), die Individualbedürfnisse von Wertschätzung, Erfolg und Selbstbestätigung (Stufe Vier) bis hin zur finalen Stufe der Selbstverwirklichung. In dieser kann der Mensch seine eigenen Fähigkeiten entwickeln und seiner Kreativität freien Lauf geben. Er fühlt, dass das Leben einen Sinn hat.
Maslow legte seiner Sichtweise eine bedürfnisorientierte und systemische Analyse zugrunde, die als humanistische Psychologie bekannt wurde. Seiner Theorie nach entwickelt sich der Mensch anhand seines inneren Wesens – je nachdem, wie die äußeren Zustände es ermöglichen. Eine Person kann also nur sie selbst sein. Maslows Zitat „A musician must be a musician“ fasst die These kurz und knapp zusammen. Zum Vergleich: Die behavioristische Psychologie geht davon aus, dass die persönliche Entwicklung von außen bestimmt wird und personenbezogene innere Faktoren dabei irrelevant sind.
Damit eine Person wieder Vertrauen in ihr eigenes Können aufbaut, muss die Sozialarbeit bereits Erreichtes benennen.
Die Sozialarbeit nach dem humanistischen Modell konzentriert sich im Wesentlichen auf die ersten beiden Stufen des Maslowschen Modells. Wer von Armut bedroht ist, macht sich Gedanken um die Sicherung seiner Grundbedürfnisse. Die Gefühle einer Person sind oft von Angst und Unsicherheit durchzogen: Werde ich es schaffen, die Miete zu zahlen? Wird mein Arbeitsvertrag verlängert? Werde ich meinen Kindern eine bessere Zukunft bieten können? Strategisches Denken ist in solchen Situationen quasi unmöglich – und unrealistisch. Denn zahlreiche unbeeinflussbare Faktoren bestimmen nun das Leben der vom Armutsrisiko betroffenen Person: die Entwicklungen des Wohnungsmarkts, des Arbeitsmarkts, die Entscheidungen der Verwaltungen …
Die Sozialarbeit implementiert zwei Stufen der Bedürfnispyramide
Wie die Sozialarbeit die Maslowsche Pyramide in ihre Praxis übersetzt, zeigt sich gut bei Arbeitslosigkeit: Durch den Arbeitsplatzverlust und das fehlende Einkommen trifft das Sicherheitsbedürfnis einer Person auf eine Situation der Prekarisierung. In einer ersten Phase sind die betroffenen Menschen oft geschockt und gelähmt, Sprachlosigkeit oder Wut sind häufige Reaktionen.

Der Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiterin nimmt diese Wut nicht persönlich, sondern lässt sie zu und reagiert empathisch. Erst nachdem er oder sie im Gespräch mit der betroffenen Person ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, können konkrete Handlungsschritte geplant werden. Die Sozialarbeit thematisiert dabei auch eventuelle Rückschläge als mögliche Szenarien – etwa, wenn die Bewerbung auf eine Arbeitsstelle gegebenenfalls nicht positiv beantwortet wird.
Damit die Person wieder Vertrauen in ihr eigenes Können aufbaut, muss die Sozialarbeit bereits Erreichtes benennen: In welchen Bereichen hat die betroffene Person in ihrem Leben gearbeitet? Welche Arbeit brachte ihr die meiste Zufriedenheit? Was kann sie gut? Sozialarbeiterin und Klient begegnen sich auf Augenhöhe, das Erlebte des Klienten wird empathisch von der Sozialarbeiterin „miterlebt“.
Handlungsschritte und Entscheidungen werden gemeinsam in aller Transparenz über den Sachverhalt und die möglichen Konsequenzen auf die Lebenssicherung getroffen: Was würde passieren, wenn die arbeitslose Person den Job nicht bekommt? Was würde passieren, wenn sie die Beschäftigung durch das Office national d’inclusion sociale (ONIS, Deutsch: das Nationale Amt für soziale Eingliederung) wegen Krankheit abbrechen müsste?
Wo der Sozialstaat hilft
Jede Einzelperson baut ihre persönlichen Sozialrechte auf Basis der Erwerbsarbeit auf. Die in die Sozialversicherung eingezahlten monatlichen Beiträge ermöglichen den Zugang zur Gesundheitskasse und zur Altersversorgung. Ist ein Mensch in Luxemburg krank, schwanger oder geht in den Ruhestand, macht er von diesen Sozialrechten Gebrauch – und zwar unabhängig von seiner finanziellen Situation.
Im Laufe der letzten 150 Jahre hat sich der Sozialstaat in Luxemburg sehr stark entwickelt. Die stetig steigende Zahl von Erwerbstätigen – also Sozialbeitragszahlenden – machte es dem Staat möglich, den Bürgern und Bürgerinnen gute Leistungen anzubieten und sogar neue einzuführen. Ein Beispiel ist die 1998 unter der damaligen Sozialministerin Mady Delvaux-Stehres (LSAP) eingeführte Pflegeversicherung der assurance dépendance.
Die diversen Leistungen variieren je nach Höhe und Dauer der Sozialversicherungsbeiträge. Minimale Leistungen wie die gleichnamige Minimalrente sind in verschiedenen Fällen garantiert. Sie zeugen von dem oben erwähnten demokratisch-humanistischen Ansatz, wonach der Sozialstaat Armut vorbeugen soll. Daneben ist der luxemburgische Sozialstaat davon geprägt, dass Lebens- oder Ehepartner und Kinder unentgeltlich mitversichert sind. Ein historisches Überbleibsel aus Zeiten, in denen weibliche Erwerbsarbeit verboten war.
Fällt die Person durch das Netz des Sozialstaates, dann kann der Sozialstaat Hilfe anbieten. Man spricht dann nicht mehr von Sozialrechten, sondern von Sozialhilfe. Diese hängt im Gegensatz zu den Rechten von der finanziellen Situation einer Person ab: Sie basiert auf dem Grundsatz der Analyse der „situation de fortune“, also der individuellen Einkommenssituation. Das eigene Vermögen und etwaige Einnahmequellen einer Person müssen dabei zuerst genutzt und ausgeschöpft werden, bevor der Staat Sozialhilfe gewährt. Sind keine eigenen Ressourcen da, stockt die Sozialhilfe auf. Sei es als REVIS (das Einkommen zur sozialen Eingliederung) oder als Unterstützung durch das Sozialamt oder karitative Vereinigungen.
Das Gesetz zur Sozialhilfe vom 18. Dezember 2009 setzt das Recht auf Sozialhilfe fest. Eine Person, die sich ans Sozialamt wendet, muss demnach eine schriftliche Absage samt Erläuterungen erhalten, falls das Amt nach eingehender Überprüfung keine Hilfen bewilligt. Ist die Person nicht mit der Entscheidung einverstanden, kann sie beim Conseil arbitral de la sécurité sociale (beim Schiedsamt der sozialen Sicherheit) Beschwerde einlegen. Das Gesetz zur Sozialhilfe ist in dem Sinne bahnbrechend, als dass es willkürliche Entscheidungen theoretisch unmöglich macht und weniger fehleranfällig ist.
Dadurch wird die Sozialhilfe sozialwissenschaftlich fundiert und geschützt: Ein „Nein“ hängt nicht länger von den subjektiven Bewertungen des Verwaltungsapparats ab, sondern basiert auf einer umfangreichen Analyse einer Person aus der Sozialarbeit. Diese leitet die angebotene individuelle Hilfestellung oder die eventuelle Absage dann aus der Anamnese ab.
Bürokratische Reflexe sind kontraproduktiv
Bürokratische Mechanismen sind in der Sozialarbeit fehl am Platz – ja sogar kontraproduktiv. Sie wirken armutsfördernd, weil sie die individuelle Situation des Menschen außer Betracht lassen und Panikreaktionen auslösen können, wenn sich die Person nicht verstanden fühlt.
Ein Beispiel: Eine heranwachsende Frau aus Afghanistan hat die physisch und emotional kräftezehrende Flucht aus Afghanistan über die Türkei, Griechenland und Italien nach Luxemburg noch immer nicht verarbeitet. Im Foyer für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht, versucht sie, die vielen unbekannten Begriffe und Sachverhalte zu verstehen, die ihr die Erzieher und Erzieherinnen erklären: BPI, ADEM, CAE, SNJ, CNS, Office social, Maison de l’orientation, CAF. Fürs Erste sind ihre Grundbedürfnisse aus der ersten Stufe der Maslow-Pyramide wohl gesichert. Ein Sicherheitsgefühl wie auf Stufe Zwei der Pyramide kommt so schnell aber nicht auf und wird viele Gesten der Menschlichkeit, der Empathie und des Vertrauens brauchen, um zu entstehen. Und selbst dann steht das Sicherheitsgefühl auf wackeligen Beinen: Es hängt von vielen externen Entscheidungsfaktoren ab, von denen die Heranwachsende abhängig ist – darunter den Regeln des Aufenthaltsrechts, dem Leben in der Aufnahmeeinrichtung, der schulischen Fortbildung oder einem eventuellen Ausbildungsplatz.
Auch in diesem Fall kann ein hohes Maß an professionellem Handeln durch die Sozialarbeit entscheidend sein. Voraussetzungen dafür sind unter anderem exzellente Kenntnisse des legalen Spielraums, eine hohe Empathie- und Kommunikationskompetenz, Kreativität und Verhandlungskompetenz in kritischen Phasen oder ein gutes soziales Netzwerk. Und das alles in stetigem Austausch mit der jungen Frau, um deren Leben und Zukunftsgestaltung es letztendlich geht.
Der Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiterin sollte mit Fingerspitzengefühl immer wieder den roten Faden aufnehmen, wenn Betroffene allein vielleicht aufgeben würden. Aber die Person aus der Sozialarbeit sollte auch erkennen, wann eine Grenze überschritten und wann eine Pause notwendig ist, um einen neuen Anlauf zu versuchen. Genau an dieser Schnittstelle entstehen oft Reibungen zwischen empathiebasierter Sozialarbeit und bürokratisch motiviertem Handeln. Ein Beispiel: Einer arbeitssuchenden Person wird die Arbeitslosenentschädigung mit sofortigem Effekt entzogen, weil sie einen Termin bei der ADEM nicht wahrgenommen hat. Dass sich in der Familie kurz zuvor eine Konfliktsituation zugetragen hat, die die Person als traumatisch erlebt hat, wird beim Rekursantrag nicht in Betracht gezogen.
Sozialarbeit 2023: Viele offene Fragen
In den letzten Jahren hat sich der luxemburgische Sozialstaat im Bereich der Sozialarbeit stark weiterentwickelt. Private Vereinigungen leisten als kleine Träger oder als mittelgroße Betriebe innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen eine gewaltige Arbeit. Ohne sie und ihre ehrenamtlichen Verwaltungsmitglieder wäre der luxemburgische Sozialstaat heute so nicht möglich.
Private Vereinigungen leisten innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen eine gewaltige Arbeit.
Wie es in der nationalen Sozialarbeit – und damit im Kampf gegen die Armut in Luxemburg – nun weitergehen wird, hängt viel von der Gestaltung der Klientenarbeit und dem bis dahin vorherrschenden Menschenbild ab: Traut der Staat dem „Armen“ zu, sein Leben nach und nach selbstbestimmt zu leben? Wird dem Wunsch des „Armen“ und der Sachkompetenz des Sozialarbeiters und der Sozialarbeiterin mehr Gewicht zugeschrieben werden als den administrativen Prozessen? Wird der Beruf des Sozialarbeiters und der Sozialarbeiterin durch ein Ausbildungskurrikulum aufgewertet, das dem Praxiswissen und der Arbeit mit dem Menschen den Vorrang gibt? Wird ein Masterabschluss entwickelt, der Managementkompetenzen und das Wissen über Bedarfsanalysen ausreichend vermittelt? Steht dem Beruf irgendwann sogar eine Weiterentwicklung im Sinne der humanistischen Psychologie bevor, und wird er zunehmend als Menschenrechtsberuf verstanden?
All das sind Fragen, auf die es bisher noch keine Antworten gibt. Allein: Für Menschen, die von Armut oder einem Armutsrisiko betroffen sind, könnten sie eine enorme Steigerung der Lebensqualität bedeuten.
1 Panorama social 2022, Chambre des salariés Luxembourg, S. 27.
2 Ebd., S. 29, 31.
3 Carl Rogers (1902-1987) entwickelte die klientenzentrierte Therapie. Empathie, Kongruenz sowie Wertschätzung prägen darin die Beziehung zwischen Sozialarbeitern und Klienten und ermöglichen Vertrauen als Basis von Veränderungsszenarien.
Ginette Jones ist Sozialarbeiterin mit einem Schwerpunkt auf Travail social communautaire. Zudem arbeitete sie als beigeordnete Direktorin der ADEM und als Beraterin des Arbeitsministeriums. Jones ist Verfasserin einer Studie zur Individualisierung der Rechte in der Sozialversicherung und Einkommenssteuer. Darüber hinaus ist sie Präsidentin der Entente des offices sociaux ASBL.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
