Lesezeit: 7 Minuten
Wir alle haben eine Vorstellung von Zeit, obwohl wir gar kein Wahrnehmungsorgan dafür haben. Umgangssprachlich kann man Zeit „haben“1, manchen attestiert man zu viel, uns selbst stets zu wenig davon, man kann sie angeblich gewinnen oder verlieren, sie kann leicht oder schwer und sogar rosa sein. Unbeeindruckt von Rätseln der Physik und Metaphysik über die (objektive) Zeit, oder wie Zeiterleben (subjektive Zeit) im Gehirn produziert wird, lassen wir Zeit unseren Alltag strukturieren, unser Handeln leiten, Verantwortlichkeiten und Interaktionen mit anderen bestimmen, von Arbeit über Freizeit, Schlaf, Familienzeit und Hobbies bis zur Nahrungsaufnahme. Und die meisten von uns wollen Zeit sogar sinnvoll nutzen. Eine riesige Selbstoptimierungsindustrie verspricht seit Jahrzehnten, vor allem unser Zeitmanagement erheblich zu verbessern. Zeit lässt sich aber weder „sparen“, noch „managen“ etc., sie vergeht einfach. Man kann bestenfalls sich selbst managen. Was ich mit mir „in der Zeit“ mache, so dass ich diese sinnvoll nutze, lässt sich auch durchaus zielgerichtet trainieren. Aber wann nutze ich meine Zeit überhaupt sinnvoll? Darauf gibt es vielleicht nicht ganz so viele Antworten wie Befragte – aber Sie wissen, worauf ich hinauswill. Die wichtigere Frage scheint mir: Warum gibt es so wenig Fragende?
Von Zeitgeschenken und Zeitfressern
Ein Teil der Antwort mag sein, dass wir dafür keine Zeit (zu) haben (scheinen). Unter anderem, weil wir viel davon mit etwas verbringen, das uns verspricht, Zeit zu sparen: Unser Smartphone und seine Apps. Das tut es mitunter zweifellos: Wer will heute noch zum Briefkasten marschieren und sich eine Fahrtroute auf Papierkarten zusammensuchen, oder für eine kurze private Mitteilung auf die telefonische Erreichbarkeit von jemandem warten? So beschert es uns befreite Zeit.
Unzählige Studien belegen allerdings eine durchschnittliche tägliche Screentime irgendwo zwischen 1,5 und 4,5 Stunden (je neuer die Studie, desto länger). Diese besteht im Schnitt aus 45-75 einzelnen Sessions, von denen ca. 70 % kürzer als 2 Min., 25 % kürzer als 10 Min., und nur 5 % länger sind. Ständig trudeln Benachrichtigungen ein, jeder Blick auf die Uhr wird für kurzes Nachrichten-Checken genutzt. Dies führt zu einer Fragmentierung des Alltags und unserer Aufmerksamkeit. Wir können uns weniger auf wichtige Aufgaben fokussieren und erzeugen ständige Übergangsverluste bei der Rückkehr zur Aufgabe. Allein die Anwesenheit des Smartphones reduziert nachweislich die Leistung, weil stets das Versprechen von als belohnend empfundenen Neuigkeiten lauert. Es wird vermutet, dass der Zusammenhang zwischen Smartphone und Produktivität einer umgekehrten U-Funktion folgt, d. h. das ursprüngliche Versprechen wird bestenfalls bei gezielter Nutzung bis zu einem mittleren Ausmaß eingelöst – darüber kehrt sich das Verhältnis von aufgebrachter Zeit zum erzielten Output ins Negative.2
Lernende Algorithmen passen auf Basis äußerst umfangreicher Daten, z. B. über bisher Gesehenes, Verweilzeiten, Likes, Kommentare, Weiterleiten etc., sowohl präsentierte Inhalte als auch Designelemente individuell derart an, dass diese möglichst lange an den Bildschirm binden. Und sie tun dies oft trotz besseren Wissens erfolgreich, unterstützt durch Persuasive Design und Nudging, von Push–Notifikationen und farblich optimierten Designs über Default-Settings wie der blaue WhatsApp-Doppelhaken bis zu raffiniert eingesetzter intermittierender Verstärkung.3
Ständig trudeln Benachrichtigungen ein, jeder Blick auf die Uhr wird für kurzes Nachrichten-Checken genutzt. Dies führt zu einer Fragmentierung des Alltags und unserer Aufmerksamkeit.
In Studien fällt stets mindestens ein Drittel der Screentime auf Social Media. Wieviel davon genau mit Menschen zu tun hat, die uns wirklich, mäßig und eigentlich gar nicht wichtig sind, ist unklar. Der Endowment Effekt4 und die Sunk-Cost-Fallacy5 fördern, dass einmal kreierte Profile immer weitere Aufmerksamkeit und Pflege erhalten. Ein weiteres gut dokumentiertes Phänomen ist time displacement: Online verbrachte Zeit ersetzt Zeit, die sonst offline mit anderen Dingen verbracht würde, was zur Vernachlässigung von Aktivitäten und Verantwortlichkeiten führen kann.
Mit dem Smartphone online zu sein, sorgt zudem für Phänomene der Zeitverzerrung, d. h. es kann aus verschiedenen Gründen zu einer veränderten Zeitwahrnehmung kommen: Wer kennt nicht die Irritation, wieviel Zeit nach völlig versunkenem Doom-Scrollen plötzlich schon vergangen sein soll? Unter ständigem Versprechen neuer interessanter Inhalte hält uns Dopamin im Zustand einer daueraktivierten Suche. Das Handy-Spiel hält uns im individuell optimierten Level mit perfekter Balance zwischen Anforderung und eigenen Fähigkeiten und erzeugt Flow-Erleben mit Verlust der Zeitwahrnehmung. Im WWW bewegen wir uns losgelöst von körperlichen Sinneseindrücken im virtuellen Raum, in dem generell Zeitlosigkeit herrscht, alles sieht 24/7 gleich aus, es fehlen vertraute zeitliche Referenzpunkte.
Smartphones fressen nicht nur tagsüber, sondern auch nachts Zeit, nämlich für Schlaf. Das emittierte, stark im kurzwelligen Bereich liegende Licht inhibiert die Melatoninsekretion, die Schläfrigkeit einleiten soll, und stört so den Schlaf-Wach-Rhythmus.6 Die Verwendung von Smartphones im Bett führt – objektiv gemessen – zu einer längeren Einschlafzeit, einer höheren durchschnittlichen Herzfrequenz und einer geringeren Herzfrequenzvariabilität, die alle in direktem Zusammenhang mit der Schlafqualität und dem Ausmaß der Erholung stehen. Zudem kommt es zu einem höheren Anteil nächtlicher Wachphasen, was die Gesamtschlafzeit verkürzt. Die Nutzung hat allerdings einen stimmungsanhebenden Effekt, der uns paradoxerweise unsere Schlafqualität subjektiv sogar besser einschätzen lässt. Das erschwert erheblich, negative Langzeitfolgen (z. B. Schläfrigkeit tagsüber, Aufmerksamkeitsprobleme) überhaupt zu entdecken bzw. auf den objektiv gemessen beeinträchtigen Schlaf zurückzuführen.
Ich will Smartphones keinesfalls verteufeln (ich möchte sie nicht missen!) – sondern schlicht anregen, die eigene Nutzung, unsere Nutzungskultur und die Tolerierbarkeit des aktuellen „datenkapitalistischen“ Modells gründlich zu überdenken, was den Mythos von Zeitersparnis und de facto sinnvoller Nutzung von Smartphones betrifft.
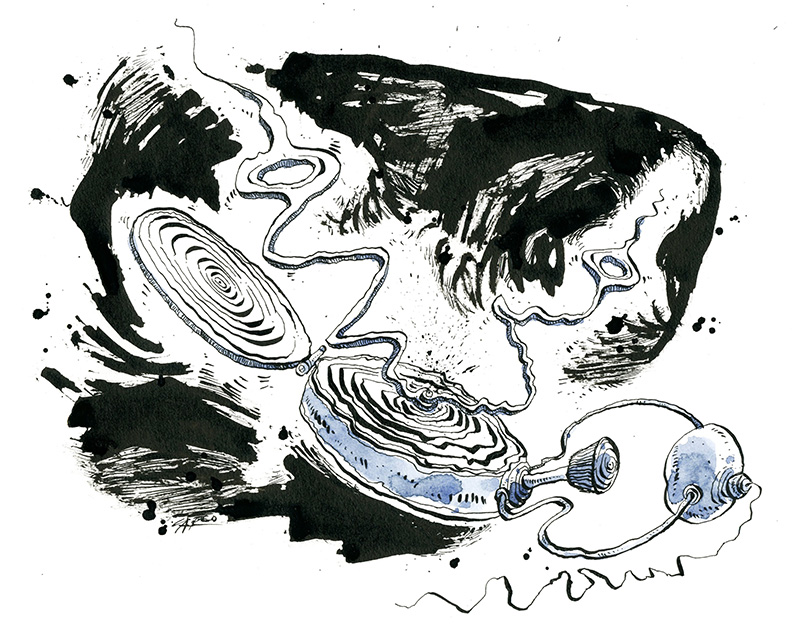
Langeweile – ein überflüssiges Übel der Prä-Smartphone-Ära?
Das in Studien am meisten genannte Motiv zur Smartphone-Nutzung ist Langeweile. Diese ist das unangenehme Gefühl7, eine zufriedenstellende Aktivität ausführen zu wollen, aber nicht zu können.8 Sie tritt hauptsächlich auf, wenn uns eine Situation, Tätigkeit oder andere Menschen eigentlich unwichtig sind. Es gibt eine situative, extern bedingte Langeweile mit Anfangs- und Endpunkt, wenn die Situation schlicht monoton und durch mangelnde Stimulation geprägt ist. Bei chronisch-existenzieller Langeweile hingegen entspricht der erlebte Mangel an Anregung nicht dem tatsächlichen Angebot. Man spürt Verlangen „nach etwas“, weiß aber nicht wonach, empfindet simultan Betätigungsdrang und -hemmung, innere Leere, geringe Lebenszufriedenheit und Sinnerleben. Langeweile wird stets als unangenehm erlebt, wir wollen sie loswerden.9 Doch mit dem Siegeszug des Smartphones und den darüber überall und sofort verfügbaren Angeboten und Annehmlichkeiten muss uns heute nicht mehr langweilig sein. Haben wir verlernt, Langeweile auszuhalten? Oder haben wir uns so sehr an die ständige Beschleunigung des privaten und sozialen Alltags und die angebliche Optimierbarkeit unseres Lebens in jeglichen Bereichen gewöhnt, dass wir jede Sekunde nutzen wollen und jede kleine Zwangspause als störend empfinden und zur Langeweile erklären?
Der Soziologe Hartmut Rosa weist diesbezüglich darauf hin, dass technische Fortschritte und gesellschaftliche Veränderungen zu einem Konglomerat aus technischer Beschleunigung, Beschleunigung des sozialen Wandels und Beschleunigung des Lebenstempos geführt haben.10 Durch diese ständige Beschleunigung entsteht bei Menschen ein Gefühl der Entfremdung – von ihrer Umwelt, ihren Mitmenschen und sich selbst. Sie kann verschiedene Formen annehmen, z.B. Entfremdung vom Raum, von Dingen, von der Zeit und von eigenen Handlungen. Die Beschleunigung und daraus resultierende Entfremdung könnten ein wesentlicher Grund sein, warum es trotz mehr Möglichkeiten als je zuvor oft nicht gelingt, ein subjektiv gutes, erfülltes Leben zu führen, bzw. diese zumindest ein wesentliches Hindernis darstellen. Nimmt man dies ernst, erwächst daraus eigentlich die Notwendigkeit, individuell wie auch als Gesellschaft über die Auswirkungen der Beschleunigung auf unser Leben nachzudenken, sowie einer tiefgreifenden Reflexion darüber, wie wir Zeit in unserem Leben gestalten und erleben (wollen). Dies ist keine Aufgabe für einen einwöchigen Digital-Detox-Retreat, sondern kann immer nur ein kontinuierlicher Prozess in kleinen Etappen von Neuorientierung, Versuch und Irrtum, Reflektion und Modifikation sein. Diese konnten früher dort stattfinden, wo sich im Alltag mehr oder weniger große Lücken und Zwangspausen auftaten. Und genau diese haben wir uns abtrainiert. Jede noch so kurze Lücke, auf dem WC, in der Schlange im Supermarkt, sogar im Auto an der Ampel, wird gefüllt. Mir scheint, als betiteln und behandeln viele Menschen mittlerweile jede kurze Zeit des Aushaltens, in der wir eben keine neuen Reize zulassen, sondern einfach mal das Erlebte wirken lassen, bereits als zu vermeidende Langeweile.
Langeweile hebt die Bedeutung von Veränderung hervor und kann Anlass für Suchprozesse sein.
Ist dieses emsige Vermeiden berechtigt? Den ganzen Tag permanent mit Reizinput konfrontiert zu sein, schafft unterm Strich eben nicht das Unangenehme ab, sondern kann uns ganz im Gegenteil auf ein ungesundes Level pushen, auf dem ständige innere Unruhe herrscht und in einem Teufelskreis die Fähigkeit herabgesetzt wird, den eigentlich verursachenden Reizfluss zu unterbrechen. Langeweile konfrontiert uns mit uns selbst. Gerade existentielle Langeweile tritt im Zustand der Selbstaufmerksamkeit als wahrgenommene Diskrepanz von erwarteter Anregung für das Erleben von Glück und Wohlbefinden und dem tatsächlichen Erleben auf. Sie kann daher als Signal verstanden werden, dass uns eine Tätigkeit, aktuell oder im weiteren Sinne, im eigentlichen Kern nicht erfüllt. Vielleicht passt sie schlicht nicht zu uns, oder wir sehen darin keinen Sinn. Langeweile hebt die Bedeutung von Veränderung hervor und kann Anlass für Suchprozesse sein. Sei es danach, was man durch seine Tätigkeit zur Welt beiträgt – sei der Wirkradius noch so überschaubar – oder danach, was man anders machen kann, welche neuen Tätigkeiten oder Hobbies erschlossen werden können, die mit Sinnerleben verbunden sind. Wenn Langeweile also nicht nur sporadisch auftaucht, sondern anhält und sich in jeder nicht gefüllten Lücke zeigt, ist deren Verscheuchen offenbar nicht sinnvoll.
Aus Unterforderung – weniger aus Überforderung („abschalten“, weil man nichts mehr versteht) – entstehende Langeweile kann zudem zu Kreativität führen: Sie kann eine Motivation zur Suche nach Neuem auslösen. Sie kann erlauben, innerlich zur Ruhe zu kommen und Mind-Wandering entstehen zu lassen. Gedanken schweifen vom aktuellen Fokus ab und konzentrieren sich auf andere, oft zufällige und unzusammenhängende Inhalte. Das Gehirn geht in eine unwillkürliche, spontane und unkontrollierte Form des Denkens über, in der, ohne bewusste Anstrengung, neue Gedanken und Ideen produziert werden. Auch bei der intensiven Beschäftigung mit einem konkreten Problem kann Langeweile als Phase der Ablenkung oder des Nichtstuns bewirken, dass das Gehirn unbewusst an einem Problem weiterarbeiten und neue Verbindungen knüpfen kann (Inkubation). So können kreative Einfälle oder Lösungen entstehen, die während einer fokussierten Phase nicht zugänglich waren. Vielleicht auch solche, wie wir mit einem anderen digitalen Geschäftsmodell zu einer sinnvollen Nutzung unserer wertvollen Zeit finden, in der unser Smartphone seinen berechtigten Platz findet.
1 Andreas König ist Diplompsychologe, Dr. phil. (Uni Landau) / Docteur en Psychologie (Uni Luxemburg), approbierter Psychotherapeut und Chargé de Direction des Zenter fir exzessiivt Verhalen a Verhalenssucht.
1 Zeit ist ja nach Benjamin Franklin bekanntlich Geld – und das sogar ohne eigenes aktives Zutun, seitdem der Papst das Zinsverbot aufgehoben und damit etwas, das zuvor zur Natur (d. h. Gott) gehörte, ökonomisch verfügbar gemacht hat. Dinge effektiver und schneller, d. h. mit mehr Effizienz zu erledigen – und damit zunächst prinzipiell mehr verfügbare Zeit freizusetzen (und diese natürlich dann ebenso effektiv zu nutzen) – hat sich längst vom industriellen Bereich über geistige Tätigkeiten bis hin ins Private als Maxime durchgesetzt.
2 Christian Montag, Du gehörst uns! Die psychologischen Strategien von Facebook, TikTok, Snapchat & Co – und wie wir uns vor der großen Manipulation schützen, München, Blessing, 2021.
3 Dabei werden Belohnungen für erwünschtes Verhalten anfangs oft und regelmäßig und mit der Zeit immer weniger, unregelmäßiger und unvorhersehbar gegeben, was zu besonders stabilen Verhaltensmustern führt.
4 Vereinfacht: Wenn wir etwas erst einmal besitzen, trennen wir uns nur schwer wieder davon.
5 Wir rechtfertigen bereits getätigte Investitionen vor uns selbst, sodass wir immer weiter darein investieren und „auf Kurs bleiben“, obwohl dies rational nicht mehr vertretbar ist und ein Aufgeben günstiger wäre.
6 Der Effekt findet sich übrigens im Vergleich zum Lesen eines Buches auch noch, wenn man Blaulichtfilter verwendet.
7 Langeweile wird in der Psychologie von manchen schlicht als Gegenteil von Interesse betrachtet, von anderen als ganz besondere Emotion, nämlich die einzige, die schwächer wird, wenn die Wichtigkeit der Situation ansteigt. Teilweise wird sie auch als Persönlichkeitsmerkmal verstanden, bei dem sich Menschen darin unterscheiden, wie schnell, häufig und intensiv sich das entsprechende Erleben einstellt.
8 James Danckert, John D. Eastwood, Out of My Skull: The Psychology of Boredom, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2020.
9 Nicht völlig zu unrecht: Wer sich viel und ständig langweilt, hat ein größeres Risiko früher zu sterben – nicht etwa an Langeweile selbst, sondern an aus Langeweile ausgeführten Risiko- oder ungesunden Verhaltensweisen (z. B. beim Essen) in Verbindung mit Problemen, die eigenen Emotionen sinnvoll zu regulieren. Zahlreiche Studien bringen Langeweile mit Essstörungen, Angststörungen sowie Depression, bis hin zu aggressiverem Fahrstil in Verbindung.
10 Hartmut Rosa, Beschleunigung und Entfremdung: Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit, Berlin, Suhrkamp Verlag, 2013.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
