- Gesellschaft
My Body,My Choice?
Sexarbeit in Luxemburg

Ich schlendere über die Reeperbahn. Neben Amsterdam hat Hamburg wohl eines der berühmtesten Rotlichtviertel Europas. Ich bin jung und habe gerade erst die Schule in Luxemburg abgeschlossen. Mein Interesse an Sexualwissenschaften hat sich in den letzten beiden Jahren stark entwickelt. Ich möchte menschliche Sexualität verstehen. Und da ist die Reeperbahn natürlich ein Schlaraffenland für mich – viel aufregender als das fast schon verschlafene Luxemburg. Die deutsche Hauptstadt, in die ich später ziehen werde und die eine noch viel faszinierendere Sexualkultur bietet, kenne ich damals noch nicht.
Während ich an der berühmten Davidwache über die Straße gehe, erblickt mich eine junge Sexarbeiterin, die an der gegenüberliegenden Straßenecke vor einem Fast-Food-Restaurant steht, und kommt auf mich zu.
„Na Süßer? Möchtest du nicht mit mir hoch auf mein Zimmer kommen?“
„Nee danke, ich bin schwul“, antworte ich.
„Och, das macht doch nix“, erwidert sie frech, „ich habe auch einen Dildo oben!“
Ich lache, obwohl ich den Spruch schon kenne. Ich höre ihn hier nicht zum ersten Mal.
Ich zögere kurz und frage dann, etwas schüchtern:
„Könntest du dir vorstellen, dich einfach mit mir eine halbe Stunde zu unterhalten? Ich würde super gerne mehr über deine Arbeit erfahren.“
„Für 30 Euro auf jeden Fall!“
Am Ende werden es 50 Euro sein, schließlich muss ich auch zwei Getränke für je zehn Euro kaufen. Aber ich willige ein. Ich möchte nicht über Sexarbeiter*innen reden, ohne auch mit ihnen geredet zu haben.
Und so folge ich ihr in ein nahegelegenes, schmales Gebäude, durch die Tür, eine Treppe hinauf und in ihr Zimmer. Sie erzählt mir von ihrer Arbeit – manchmal toll, manchmal weniger, manchmal nervend, manchmal erfüllend. Würde ich nicht wissen, dass es um das Tabuthema Sex(arbeit) geht, könnte ich fast denken, dass sie mir von einem Job wie jedem anderen erzählt.
Doch das ist es natürlich nicht. Es ist eine Tätigkeit, die politisch und gesellschaftlich seit Jahrhunderten wie kaum eine andere diskutiert, bekämpft und stigmatisiert wird. Davon zeugt schon allein der Umstand, dass das Bordell, in dem ich mich mit dieser Sexarbeiterin befinde, in Luxemburg illegal wäre. Und genau das wird auch einer der Gründe dafür sein, weshalb es sich als so schwierig erweist, mehr über die Situation von Sexarbeiter*innen in Luxemburg zu erfahren.
Die Realität von Sexarbeit ist komplexer als es die Gegensätze „freiwillig“ oder „gezwungen“ vermuten lassen.
Heute sind sexarbeitende Menschen Teil meines Lebens, meiner Freundschaften und meiner Arbeit. Dennoch kenne ich keine*n einzige*n Sexarbeiter*in aus Luxemburg. Ich möchte das ändern. Ich will wissen: Wie ist die Lebensrealität von Sexarbeiter*innen in Luxemburg? Welchen Einfluss hat der Feminismus in Luxemburg? Wie wurde in Luxemburgs Geschichte Sexarbeit geregelt, wie über sie gesprochen und verhandelt? Und welche Forderungen stellen Betroffene und Wissenschaftler*innen an die luxemburgische Politik und Gesetzgebung? Müssen sich die Gesetze zur Sexarbeit in Luxemburg ändern? Und falls ja, in welche Richtung?
Was ist Sexarbeit?
Schon die Wahl des Begriffs zeigt: Sexarbeit ist politisch hoch umstritten. Kritiker*innen, insbesondere aus abolitionistischen, (also aus einer ideologischen Position der Abschaffung der Sexarbeit), sowie aus radikal-feministischen Bewegungen, lehnen den Begriff „Sexarbeit“ ab. Sie empfinden ihn als Verharmlosung sexualisierter Gewalt und Ausbeutung. Sie argumentieren, dass es dabei selten um freiwillige Arbeit gehe.
Viele Sexarbeiter*innen selbst betonen dagegen, dass der Begriff essenziell sei, um ihre Tätigkeit als Arbeit anzuerkennen und sich für ihre Rechte einzusetzen. Auch wenn der Begriff unter den marginalisiertesten Sexarbeiter*innen – zum Beispiel unter jenen auf der Straße mit besonders viel Gewalterfahrungen – weniger verbreitet ist, definieren besonders Personen aus aktivistischen und wissenschaftlichen Kreisen Sexarbeit klar als die freiwillige, einvernehmliche Erbringung sexueller oder sexualisierter Dienstleistungen gegen Entgelt oder materielle Gegenleistungen zwischen erwachsenen Personen. Amnesty International hat diese Sichtweise 2016 in einer viel beachteten Stellungnahme1 bekräftigt und sich für die Entkriminalisierung von Sexarbeit ausgesprochen, weil nur so die Rechte der Beteiligten wirksam geschützt werden können. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benutzt in ihren Richtlinien zur HIV-Prävention den Begriff und weist seit Jahren darauf hin, dass Sexarbeit entkriminalisiert werden sollte, um die Gesundheitsversorgung und Prävention sicherzustellen.2
Als Sammelbegriff umfasst Sexarbeit zahlreiche Tätigkeiten: von dem, was landläufig als „Prostitution“, also der Verkauf von sexuellen Dienstleistungen, bezeichnet wird, über Pornografie und erotische Massagen bis hin zu digitalen Angeboten wie Webcam-Performances oder OnlyFans, ebenso wie spezialisierte Formen wie BDSM3-Dienstleistungen und edukative, sogenannte „post-pornografische“4 Inhalte.
Der Begriff entstand in den 1970er-Jahren ausdrücklich als Alternative zur traditionell belasteten Bezeichnung „Prostitution“. Er betont den arbeitsrechtlichen und selbstbestimmten Charakter der Tätigkeit und grenzt diese bewusst von Zwangsprostitution oder Menschenhandel ab. Diese sprachliche Verschiebung war entscheidend, um Betroffene als handelnde Subjekte sichtbar zu machen und nicht länger nur als Objekte staatlicher oder moralischer Regulierung.

Generell werden die 1970er-Jahre als Wendepunkt der Bewegung für die Rechte von Sexarbeitenden gesehen. Damals verschärfte die französische Polizei den Druck auf diese, was sie zunehmend in den Untergrund drängte und ihre Sicherheit massiv verschlechterte. Nachdem zwei Sexarbeiterinnen ermordet worden waren und die Regierung untätig blieb, besetzten Aktivist*innen am 2. Juni 1975 die Kirche Saint-Nizier in Lyon und traten in den Streik. Acht Tage lang hielten sie den Raum und forderten menschenwürdige Arbeitsbedingungen sowie ein Ende des gesellschaftlichen Stigmas. Die Polizei räumte schließlich die Kirche, doch das Ereignis gilt seither als Ausgangspunkt der internationalen Bewegung von Sexarbeiter*innen für ihre Rechte – und daran wird bis heute jährlich am 2. Juni, dem International Whores’ Day (Internationaler Hurentag), erinnert.
Für diesen Artikel verwende ich bewusst den Begriff „Sexarbeit“, um die Perspektive derjenigen zu respektieren, um die es hier geht. Obwohl wir uns dabei vor allem auf jene Tätigkeit konzentrieren, die oft als „Prostitution“ bezeichnet wird, ist diese begriffliche Unterscheidung zentral: Denn Sprache prägt Realität und politische Entscheidungen.
Doch bereits an dieser Stelle muss klar sein: Die Realität von Sexarbeit ist komplexer als es die Gegensätze „freiwillig“ oder „gezwungen“ vermuten lassen. Viele Menschen berichten, dass sie die Arbeit bewusst wählen, etwa weil sie Selbstbestimmung, Flexibilität oder finanziell bessere Möglichkeiten als andere prekäre Jobs eröffnet. Andere hingegen geraten in die Sexarbeit aufgrund ökonomischer Notlagen, mangelnder Alternativen oder Diskriminierungserfahrungen am regulären Arbeitsmarkt. Besonders betroffen sind marginalisierte Gruppen: trans5 und nicht-binäre Personen, Migrant*innen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, People of Color, Menschen mit Behinderungen oder solche mit Suchterkrankungen. Hier wirken verschiedene Formen von Unterdrückung zusammen – ein intersektionaler6 Blick ist deshalb unverzichtbar.
Die Realität von Sexarbeit ist komplexer als es die Gegensätze „freiwillig“ oder „gezwungen“ vermuten lassen.
Wíner Ramírez Díaz ist Soziologe und arbeitet in Paris im öffentlichen Gesundheitswesen. Zudem ist er Teil eines Kollektivs von LGBTQIA+ Immigrant*innen und begleitet im Rahmen seiner Arbeit unterschiedliche Sexarbeiter*innen. Er betont, dass Sexarbeit umfassender betrachtet werden müsse – wie wir noch sehen werden auch im Kontext von Kapitalismus, Neoliberalismus und Machtverhältnissen. „Jeder Werdegang ist einzigartig, jede Geschichte komplex.“
Hinzu kommt, dass Sexarbeit im politischen und gesellschaftlichen Diskurs häufig eng mit Menschenhandel verknüpft wird. Menschenhandel ist ein schweres Menschenrechtsverbrechen, das ohne Zweifel entschieden bekämpft werden muss. Gleichzeitig betonen Fachorganisationen, dass es problematisch ist, Sexarbeit pauschal mit Zwang oder Menschenhandel gleichzusetzen. Viele Betroffene erleben dies als Entmündigung, weil dadurch ihre Stimmen und Erfahrungen unsichtbar gemacht werden. Salomé Lannier ist Rechtswissenschaftlerin und Postdoktorandin an der Universität Luxemburg und hat sich auf die Bekämpfung von sexualisiertem Menschenhandel spezialisiert: „Es gibt Menschen, die sich freiwillig für Sexarbeit entscheiden. Andere tun dies aus wirtschaftlichen, sozialen oder migrationsbedingten Gründen. Aber wir müssen deutlich zwischen freiwilliger Sexarbeit und Formen von Gewalt und Menschenhandel unterscheiden.“ Diese differenzierte Betrachtung sei wesentlich, um gezielt politische Maßnahmen ergreifen zu können, die nicht pauschal kriminalisieren, sondern gezielt Unterstützung und Schutz bieten.
Die Unterscheidung zwischen sexualisiertem Menschenhandel und freiwilliger Sexarbeit erweist sich indes als einfacher als das Konzept der Freiwilligkeit an sich innerhalb der Sexarbeit. Angela Jones7 ist Professor*in für Women, Gender and Sexuality Studies an der State University of New York. Zu Jones’ Forschungsinteressen gehören afroamerikanisches politisches Denken und Protest, Sexarbeit, Ethnie/„Rasse“, Geschlecht, Sexualität, feministische Theorie, Schwarzer Feminismus sowie queere Methodologien und Theorien. 2024 war Jones Mitherausgeber*in des Sammelbands Sex Work Today: Erotic Labor in the Twenty-First Century. Jones hat im Rahmen von Forschungsarbeiten mit zahlreichen Sexarbeiter*innen aus der ganzen Welt gesprochen und erklärt: „Der Einstieg in die Sexarbeit erfolgt über ein Kontinuum von Zwang, Wahl und Umständen. Manche machen gerne und freiwillig Sexarbeit. Manche werden durch die Umstände dazu gebracht – Armut, Diskriminierung oder ein Mangel an realistischen Beschäftigungsmöglichkeiten. Einige der Menschen, die zunächst Zwang erleben, entscheiden sich aber später bewusst dafür, in der Sexarbeit zu bleiben, weil sie dort eine Gemeinschaft, Autonomie oder finanzielle Stabilität gefunden haben.“

Ein konkretes Beispiel seien Jones’ Gespräche mit behinderten Sexarbeiter*innen. „Viele erleben den traditionellen Arbeitsmarkt als äußerst behindertenfeindlich, da er kaum Möglichkeiten bietet, chronische Krankheiten oder wechselnde Arbeitsfähigkeiten angemessen zu berücksichtigen. Die Sexarbeit hingegen ermöglicht es ihnen, flexibel und eigenständig zu arbeiten und ihre Tätigkeit an ihre körperlichen und psychischen Bedürfnisse anzupassen.“
Sexarbeit findet oft in sogenannten Heterotopien statt – ein Begriff des Philosophen Michel Foucault. Heterotopien beschreiben Orte, die sich am gesellschaftlichen Rand befinden und in denen Normen außer Kraft gesetzt werden können. Bordelle, Privatwohnungen oder Straßenstriche erfüllen diese Funktion: Hier gelten andere Regeln als in der Gesellschaft draußen. Das Normale und Nicht-Normative verschwimmen miteinander.
Ein konkretes Beispiel dafür ist das Atrium in Berlin, ein von Sexarbeiter*innen selbst betriebenes BDSM-Studio. An diesem Ort wird Sexualität offen zelebriert, Marginalisierung wird temporär zu Macht, und Rollenspiele erlauben das bewusste Ausbrechen aus gesellschaftlichen Normen. Solche Orte verdeutlichen, wie Sexarbeit auch Räume schaffen kann, die abseits gängiger moralischer Vorstellungen liegen und dennoch – oder gerade deswegen – von großer Bedeutung für die Selbstbestimmung der Beteiligten sein können.
Luxemburg kennt solche Orte derzeit nicht, da Bordelle hier verboten sind. Doch auch hier existiert Sexarbeit – oft verborgen und manchmal unter Bedingungen, die weit weniger selbstbestimmt sind. Die genaue Kenntnis und Reflexion über diese Orte, ihre Funktionen und deren Fehlen im luxemburgischen Kontext ist wesentlich, um zu verstehen, unter welchen Bedingungen Sexarbeit stattfindet, welche Rechte die Sexarbeiter*innen haben und wie Politik diese Rechte schützen oder einschränken könnte.
Feministische Sex-Kriege
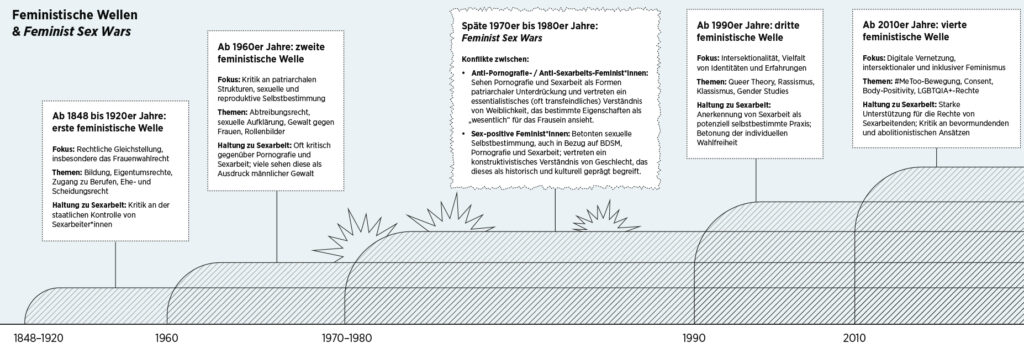
Feministische Sex-Kriege
Wohl kaum eine Bewegung hat sich intensiver mit dem Thema Sexarbeit auseinandergesetzt als der Feminismus. Doch „den Feminismus“ an sich gibt es nicht – vielmehr existieren zahlreiche feministische Strömungen mit teils gegensätzlichen Positionen zur Sexarbeit. Diese Unterschiede wurden besonders sichtbar während der sogenannten „Feminist Sex Wars“ der späten 1970er und 1980er Jahre, in denen Feminist*innen kontrovers über Sexarbeit, Pornografie und BDSM diskutierten. Der Einfachheit halber lassen sich zwei zentrale Positionen unterscheiden: der liberale oder sex-positive Feminismus, sowie der sogenannte Radikalfeminismus, der manchmal auch als Differenzfeminismus bezeichnet wird, weil er (vermeintliche oder reale) Unterschiede (Differenzen) zwischen Männern und Frauen betont.
Bernadette Barton, Soziologieprofessorin und Direktorin der Gender Studies an der Morehead State University in den USA, und Breanne Fahs, Professorin für Frauen- und Geschlechterforschung an der Arizona State University, weisen in ihrem Essay Were the Feminist Sex Wars Inevitable? darauf hin, dass „sexpositive Feminist*innen darum kämpften, Sexualität von religiösen und puritanischen kulturellen Vorstellungen von Sex als ‚sündhaft‘ und ‚schlecht‘ zu befreien, während radikale Feminist*innen sich dafür einsetzten, Frauen vor ungewolltem Sex oder ungewollten sexuellen Darstellungen zu schützen und gleichzeitig auf unterdrückerische und geschlechterkonservative Sexualpraktiken aufmerksam zu machen, die Frauen schaden oder benachteiligen.“8
Radikalfeminist*innen lehnen Sexarbeit grundsätzlich als patriarchale Ausbeutung ab – sie sehen sie als Ausdruck eines männlichen Anspruchs auf Frauenkörper. Sex-positive Feminist*innen hingegen betrachten Sexarbeit als potenziell selbstbestimmte Tätigkeit und als Ausdruck sexueller Autonomie.
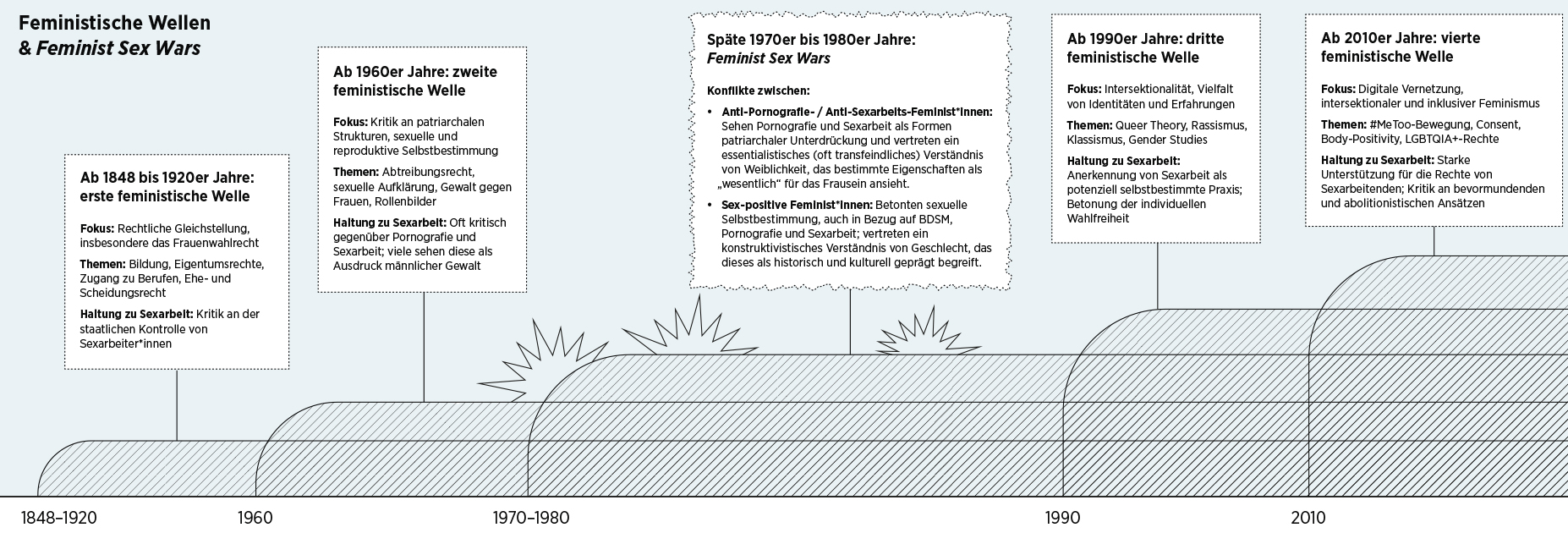
Jones kritisiert die radikalfeministische Perspektive scharf: „Diese radikalen Feminist*innen sollten einfach mal mit Sexarbeiter*innen sprechen. Dann würden sie erkennen, dass viele diese Tätigkeit selbstbestimmt und freiwillig ausüben. Wenn es dem Feminismus wirklich um körperliche Autonomie geht, muss diese Autonomie auch das Recht umfassen, Sexarbeit ohne Scham und Zwang auszuüben.“
Auch der Soziologe Wíner Ramírez Díaz, der in der Großregion geforscht hat, sieht eine entscheidende Schwäche abolitionistischer feministischer Positionen: Sie stellen Sexarbeit pauschal als Ausdruck von Unterdrückung dar. Viele Betroffene erleben ihre Tätigkeit jedoch gerade als Möglichkeit zur Emanzipation, etwa durch Kontrolle über Sexualität und Geschlechtsidentität. Ramírez Díaz warnt, solche Modelle würden Außenstehenden die Deutungshoheit geben: „Damit fällt man in eine Logik des ‚White Saviorism‘9 zurück.“
Wir müssen aufpassen, dass wir Sexarbeiter*innen nicht automatisch als Opfer darstellen.
Die Rechtswissenschaftlerin Salomé Lannier teilt diese Einschätzung. Für sie ist es „das Gegenteil von Feminismus“, wenn man vorgibt, Frauen schützen zu wollen, ihnen aber zugleich vorschreibt, was sie tun dürfen. „Wenn man einer Frau etwas vorschreibt – sei es, ob sie abtreiben darf oder nicht, Sexarbeit machen darf oder nicht – dann reduziert man Frauen darauf, als Frau so oder so sein zu müssen. Das widerspricht der Grundidee des Feminismus.“
Ähnlich argumentiert Luxemburgs Justizministerin Elisabeth Margue (CSV). In einem Interview mit dem Lëtzebuerger Land10 2018 sagte sie, dass sie sich nicht unbedingt als Feministin bezeichnen würde, sondern es für selbstverständlich halte, dass Frauen gleichberechtigt am gesellschaftlichen und politischen Leben teilnehmen. „Hat sich Ihre Position zum Feminismus seit dem Interview von 2018 verändert? Und welche Rolle spielen Frauenrechte in Ihrer Bewertung von Sexarbeit?“, frage ich sie. „Oft wird Feminismus mit einer übermäßigen Viktimisierung verbunden“, erwidert sie. „Genau das sehe ich auch in dieser Debatte als Problem: Wir müssen aufpassen, dass wir Sexarbeiter*innen nicht automatisch als Opfer darstellen.“ Wenn Feminismus aber bedeute, Gleichberechtigung für alle einzufordern, dann sei auch sie Feministin.

Mit dem essentialistischen Bild der Frau als Opfer geht indes das essentialistische Bild des Mannes als Täter einher. Jedoch nehmen innerhalb des Systems der männlichen Dominanz nicht alle Männer den gleichen Rang ein. Für Ramírez Díaz liegt deswegen ein wesentlicher Schlüssel zur differenzierten Betrachtung in einem intersektionalen Feminismus. „In jeder Gesellschaft gibt es unterschiedliche Formen von Männlichkeit: hegemoniale (also privilegierte) Männlichkeiten, die an der Unterdrückung aktiv teilnehmen; komplizenhafte Männlichkeiten, die zwar wissen, was passiert, aber das System nicht infrage stellen; und subalterne Männlichkeiten, die selbst Unterdrückung und Stigmatisierung erfahren – zum Beispiel Schwarze Männer oder Männer mit Migrationsgeschichte. Intersektionaler Feminismus macht dies sichtbar. Er macht auch sichtbar, dass Unterdrückung nicht nur auf Geschlecht reduziert werden kann. Eine 50-jährige Migrantin, die kaum Zugang zur Landessprache und zum Arbeitsmarkt hat, erlebt Diskriminierungen (wie Sexismus, Rassismus, Klassismus) nicht einfach kumulativ. Vielmehr durchziehen sie strukturell ihre gesamte Existenz.“ Sexarbeit könne unter diesen Umständen ein pragmatischer und logischer Schritt sein, um Geld zu verdienen, ohne dass notgedrungen Zwang oder Ausbeutung im Spiel sind.
Die Geschichte der Sexarbeit in Luxemburg
Der Feminismus hat auch in Luxemburg einen entscheidenden Einfluss auf die Einstellungen und die Politik rund um Sexarbeit. Die Geschichte der Sexarbeit, ihrer Regulierung, gesellschaftlichen Wahrnehmung und politischen Rahmenbedingungen reicht jedoch weiter in die Geschichte des Landes zurück. Sie ist geprägt von widersprüchlichen Entwicklungen, einer komplexen rechtlichen Situation und einer oft problematischen medialen Darstellung.
Vor Mitte des 20. Jahrhunderts existierte Sexarbeit in Luxemburg in einer rechtlichen Grauzone: Sie war weder vollständig legalisiert noch strikt verboten, sondern wurde gesellschaftlich verdrängt und moralisch stigmatisiert, weswegen historische Berichte über Sexarbeit selbst spärlich sind. Es gibt Hinweise, dass im Umfeld der Industriezentren und Garnisonen Luxemburgs (etwa im Raum Esch/Alzette oder in der Stadt während der beiden Weltkriege) Sexarbeit florierte – beispielsweise über Kellnerinnen in Gaststätten, die gleichzeitig der Sexarbeit nachgingen.
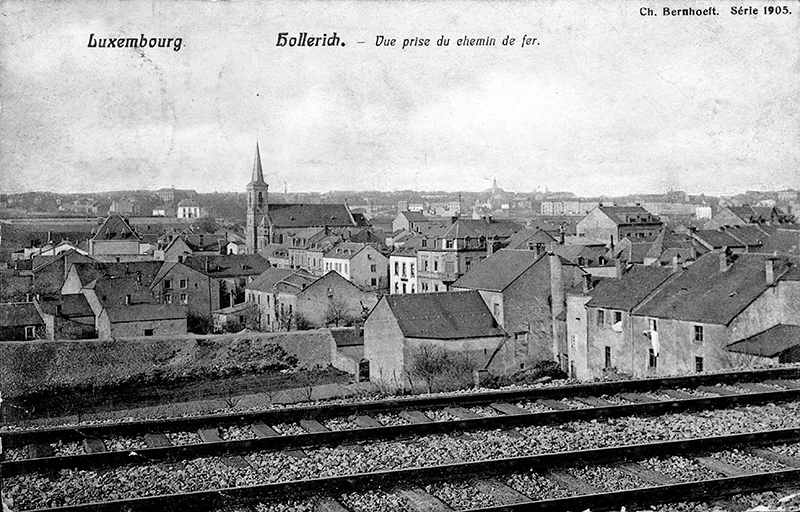
Das liegt vermutlich am rasanten Industrialisierungs- und Migrationsschub im Minette-Becken um 1900. Sexarbeit wurde erstmals als öffentliches „Problem“ definiert; Polizeiberichte verknüpften sie mit neuen Vergnügungsräumen und bezeichneten sogenannte Animierkneipen als „wahre Unzuchtstätten“ sowie „gefährlichste Horte der Geschlechtskrankheiten“, während die ausländische Kellnerin zur „personifizierten Gefahr“ erklärt wurde. Zugleich stigmatisierten Behörden das unverheiratete Zusammenleben als „Ansteckungsherd der Prostitution“, wobei Statistiken etwa für Differdingen einen Ausländeranteil von 92 Prozent in solchen „wilden Ehen“ auswiesen; damit verschränkten sich Geschlecht, Klasse, Nation und Raum im Blick auf Sexualität und schrieben die ausländische Frau der Arbeiterklasse im Süden des Landes als Gefahr für die sittlichen Männer Luxemburgs fest – und zwar über die Sexarbeit.11
Diese dichte Problematisierung rechtfertigte ein Maßnahmenbündel, das weit über das formale Strafverbot hinausging. Die Fremdenpolizei setzte an Stelle mühsamer Gerichtsverfahren auf die sofortige Ausweisung verdächtiger Frauen – in 81 % der einschlägigen Fälle traf es Migrantinnen – und verschob so das „Übel“ symbolisch ins Ausland. Parallel wurden Frauen mit vermuteter Syphilis festgenommen und isoliert, häufig nach vagen Angaben männlicher Patienten; zwischen 1899 und 1914 verzeichnete allein Hollerich 116 polizeilich registrierte Fälle, während Männer unbehelligt blieben.
Die Geschlechterwissenschaftlerin Heike Mauer analysiert diese Praktiken durch das Konzept der Gouvernementalität – ein von Michel Foucault geprägter Begriff, der Formen moderner Macht beschreibt, die nicht primär durch Verbote, sondern durch das „Führen des Verhaltens“ operieren: Staat und Öffentlichkeit kombinierten juristische Zwangsmittel mit disziplinarischen Verhaftungen und moralischen Selbstführungsappellen, etwa wenn Hausfrauen zur „nationalen Hygiene“ ermahnt wurden. Gouvernementalität macht verständlich, wie ein scheinbar heterogenes Arsenal – Strafrecht, Fremdenpolizei, Gesundheitszwang, Sittlichkeitsdiskurse – zu einem kohärenten Regime verschmolz, das intersektional bestimmte Gruppen von Frauen als Zielscheibe auswählte und ihre Mobilität, Körper und Arbeitsmöglichkeiten ordnete und einschränkte.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Sexarbeit in Luxemburg also weder liberal reguliert noch schlicht verboten, sondern in einem intersektionalen Machtmix aus Strafrecht, Polizeirecht, Gesundheitszwang und moralischer Selbstführung regiert. Sichtbar wird ein gender- und migrationspolitisches Dreieck: weibliche Körper, männliche Bedürfnisse, nationale Hygienesorgen, die vor vermeintlichen Gefahren aus dem Ausland geschützt werden müssen. Dieses historische Panorama erklärt, warum aktuelle Debatten um Sexarbeit fast zwangsläufig Themen wie Migration, öffentliche Gesundheit und Geschlechterrollen berühren.
Auch danach bleiben Berichte über Sexarbeit rar. Doch 1970 erfolgte in Luxemburg ein deutlicher Kurswechsel: Mit einer Reform des Strafgesetzbuches wurden Bordelle gesetzlich verboten. Offiziell begründet wurde dies mit dem Ziel, Proxenetismus (Zuhälterei) und Menschenhandel einzudämmen, die öffentliche Ordnung und Moral zu wahren und gesundheitliche Risiken zu reduzieren. Damit folgte Luxemburg einem europaweiten Trend, der sich auch auf die UN-Konvention von 1949 zur Unterdrückung des Menschenhandels bezog, und schlug einen abolitionistischen Kurs ein. Sexarbeit selbst blieb zwar legal, wurde jedoch in den kommenden Jahrzehnten immer stärker reglementiert, gesellschaftlich stigmatisiert, und entzog sich gleichzeitig weitgehend effektiver staatlicher Regulierung. Was blieb, war ein Klima, in dem Sexarbeit zwar existierte, aber nicht offen thematisiert wurde.
1999 rückt das Thema dann im Nachgang der internationalen feministischen Diskurse um Sexualität in einen neuen Rahmen: Menschenhandel wird als eigener Straftatbestand definiert und Prostitution hauptsächlich durch diese Brille betrachtet. Der politische Fokus verschiebt sich hin zur Kriminalitätsbekämpfung. In den folgenden Jahren wird die Gesetzgebung in diesem Bereich weiter ausgebaut, ohne dass freiwillige Sexarbeit einen eigenen Rechtsrahmen erhält.
2007 ließ die Regierung erstmals Meinungsumfragen zur Sexarbeit in der Bevölkerung durchführen – ein erster vorsichtiger Schritt hin zu einer offeneren Diskussion. Sie zielten darauf ab, gesellschaftliche Einstellungen zur Sexarbeit zu erfassen und zeigten beispielsweise, dass in Luxemburg eine Opferperspektive vorherrscht: Die überwiegende Mehrheit der Befragten sah Sexarbeit nicht als autonome Entscheidung an. 2011 forderte die damalige Familienministerin und frühere Ministerin für die Förderung der Frauen Marie-Josée Jacobs (CSV) die Einführung des Nordischen Modells, welches die Kund*innen von Sexarbeit kriminalisiert. Mit dem Regierungswechsel 2013 unter DP, LSAP und Grünen wurde dieser Plan jedoch nicht weiterverfolgt.
2012 wurden die Meinungsumfragen wiederholt.12 Nur 23 % der Befragten sehen Sexarbeit als eine autonome Entscheidung an – ein Anstieg von 7 % gegenüber 2007, aber noch immer ein deutliches Zeichen für die vorherrschende Opferperspektive. Drei Viertel der Befragten geben an, sie würden eine ihnen nahestehende Person zum Ausstieg aus der Sexarbeit bewegen wollen. Im selben Jahr organisierte das Ministerium für Chancengleichheit eine vielbeachtete Konferenz: Et si on parlait de prostitution au Luxembourg? Damit wird ein Tabu gebrochen. Regierungsvertreter*innen reisen daraufhin in die Niederlande (Legalisierung der Sexarbeit) und nach Schweden (Kriminalisierung durch das Nordische Modell), um sich dortige Gesetzgebungen anzuschauen – ein Zeichen dafür, dass auch Luxemburg politische Reformen in Erwägung zieht.

2014 folgte mit der sogenannten EXIT-Strategie ein erstes konkretes Ergebnis. Das vom Ministerium finanzierte Programm wird von der Beratungsstelle für Sexarbeitende dropIn des Roten Kreuzes betreut und soll Menschen unterstützen, die dauerhaft aus der Sexarbeit aussteigen möchten. Es gibt dabei zwei unterschiedliche Module: EXIT 1 richtet sich an Personen ohne eigene Wohnung und sieht die Bereitstellung einer Unterkunft vor, während EXIT 2 für Personen mit bestehendem Wohnraum gedacht ist. Grundlage bildet jeweils ein individueller Vertrag zwischen den Teilnehmenden und dem dropIn, der in Zusammenarbeit mit Partnern wie der Arbeitsagentur ADEM, den Gemeinden oder der Caisse Nationale de Santé umgesetzt wird.
Die bisherige Bilanz ist jedoch ernüchternd. Im dropIn erklärt man mir, dass sie selten Anträge dafür erhalten. Ashanti Berrend, die bis April 2025 die stellvertretende Direktionsbeauftragte war, erklärte im Interview, dass „eine Wohnung allein nicht die Probleme löst; der Ausstieg aus der Sexarbeit ist ein komplexer Prozess, der oft von Rückschlägen geprägt ist. Viele kehren zur Sexarbeit zurück, weil sie keine Alternativen sehen.“


Die Direktionsbeauftragte Claire Marchal geht noch weiter: „Der reine Wunsch, auszusteigen, ist selten. Es geht oft um grundlegende administrative Unterstützung oder um die Entwicklung neuer beruflicher Perspektiven.“
Bislang konnte deshalb nur eine sehr kleine Zahl an Menschen erfolgreich in andere Lebenswege begleitet werden. Dem stehen zahlreiche Abbrüche des EXIT-Programms gegenüber, u. a. aufgrund von Suchterkrankungen, gesundheitlichen Problemen oder fehlendem Aufenthaltstitel. Häufig scheitert der Übergang nicht am Willen der Betroffenen, sondern an strukturellen Hürden. So stellt insbesondere der angespannte Luxemburger Wohnungsmarkt eine enorme Hürde dar. Viele der Jobs, die für ehemalige Sexarbeiter*innen in Frage kommen – etwa in Reinigung oder Gastronomie – sind niedrig bezahlt, sodass Vermieter*innen nur schwer überzeugt werden können, Wohnungen an sie zu vergeben. Auch die Wartelisten beim Fonds du logement sind lang. Hinzu kommt, dass ohne gültige Aufenthaltspapiere kaum eine Chance besteht, einen regulären Job oder eine Wohnung zu finden. „Die Zugänglichkeit dieser Programme für Nicht-EU-Bürger*innen ist außerdem sehr eingeschränkt“, erklärt Berrend. „Obwohl einige über einen Aufenthaltsstatus in anderen EU-Ländern verfügen, finden sie oft schwer Zugang zu Unterstützungsprogrammen in Luxemburg.“
Fachleute sehen die EXIT-Strategie deshalb als zu schmal angelegt und nicht ausreichend auf die Realität der Zielgruppe abgestimmt. Sie bemängeln, dass strukturelle Probleme – prekäre Jobs, Wohnungsnot, Aufenthaltsrecht – zu wenig berücksichtigt werden. Das Programm stößt hier an klare Grenzen: Nicht alle Menschen in der Sexarbeit streben einen Ausstieg an, und für jene, die es versuchen, braucht es weit umfassendere sozialpolitische Rahmenbedingungen, als die EXIT-Strategie bisher bieten kann.
2016 sorgte die Einführung des Nordischen Modells in Frankreich für neue Dynamiken in Luxemburg. Die Nachfrage im Großherzogtum stieg – besonders in Grenzregionen. Die Regierung entwickelte einen Plan d’Action National (PAN) Prostitution. Ziel ist nicht die Kriminalisierung von Sexarbeiter*innen oder deren Kund*innen, sondern die Verbesserung der Sicherheit sowie der Kampf gegen Menschenhandel. Parallel forderte der Conseil national des femmes du Luxembourg (CNFL) erneut die Einführung des Nordischen Modells und die Abschaffung der Sexarbeit und lehnte das Konzept der „selbstbestimmten Prostitution“ explizit ab.

2018 wurde schließlich ein neues Gesetz verabschiedet – ein politischer Kompromiss zwischen Legalisierung einerseits und den Forderungen nach der Kriminalisierung durch das Nordische Modell andererseits. Diesen Änderungen werden wir uns im folgenden Kapitel widmen.
2020 veränderte die COVID-19-Pandemie das Bild von Sexarbeit in Luxemburg dann grundlegend. Der Straßenstrich, lange sichtbar im städtischen Bahnhofsviertel, verlor an Präsenz. Kund*innen blieben aus, viele Sexarbeiter*innen zogen sich zurück oder verlagerten ihre Tätigkeit in private Räume. Einige beendeten ihre Tätigkeit ganz, andere stiegen – oft aus wirtschaftlicher Not – neu ein. Auch nach den Lockerungen der Ausgangssperren findet Sexarbeit heute größtenteils in privaten Räumen statt und bleibt somit unsichtbar und schwerer zu erreichen – sowohl allgemein für die Gesellschaft als auch spezifisch für Hilfsorganisationen oder die Polizei: „Durch die Verlagerung der Aktivitäten in Privatwohnungen
– oder sogenannte ‚short-term facilities‘ wie Airbnb usw. – und parallel dazu das Werben bzw. Inserieren in speziellen Foren und auf Plattformen sind die sonst sichtbaren Aktivitäten aus dem öffentlichen Raum verschwunden“, erklärt Chefkommissar Johny Meyrer von der Polizei. „Es ist schwieriger geworden, mit den betreffenden Personen in Kontakt zu treten. Eine ‚einfache‘ Patrouille oder Kontrolle in bestimmten Vierteln der Stadt reicht nicht mehr aus, um sich ein Bild von der Situation zu machen.“ Auf der Straße käme es zwar zu geringen saisonalen Fluktuationen, wobei jedoch oft Personen anzutreffen sind, die der Polizei schon länger bekannt seien. Allgemein bleibt die Straßensexarbeit seit der Pandemie dauerhaft reduziert. Meyrer könne verstehen, dass die Verlagerung der Aktivitäten in Wohnungen für die betroffenen Personen Vorteile in Bezug auf Anonymität, Hygiene, Sicherheit usw. mit sich bringt. „Allerdings ist es für uns dadurch schwieriger herauszufinden, ob Sexarbeit hier freiwillig erfolgt oder aus einer Not- bzw. Zwangslage heraus. Besonders bei den genannten ‚short-term facilities‘ besteht das Risiko, dass potenzielle Opfer innerhalb eines Netzwerks durch EU-Länder geschleust werden. Hier besteht durchaus die Gefahr, dass wir eine solche Zwangslage nicht rechtzeitig mitbekommen.“
Ramírez Díaz hat mehrere Jahre in der Großregion gelebt und geforscht. Er meint: „Eine Grenze zwischen zwei Ländern ist keine klare Linie, sondern ein Ort intensiver Bewegung und Austausch. Sexarbeit ist in diesem Kontext stets präsent und allgegenwärtig.“ Auffällig sei die Koexistenz der unterschiedlichen Modelle: Deutschland erkennt Sexarbeit an, Belgien entkriminalisiert sie, Frankreich kriminalisiert Freier*innen – und Luxemburg schwanke unklar zwischen Toleranz und gezielter Einschränkung. „Doch keines dieser Modelle lässt Sexarbeit verschwinden. Luxemburg ist vielmehr ein spannungsgeladener Punkt, an dem die verschiedenen Rechtsmodelle und Realitäten aufeinanderprallen.“
Luxemburg ist zudem ein Transit- und Arbeitsland. Ramírez Díaz erklärt, dass die starke Wirtschaft Luxemburgs viele Sexarbeiter*innen aus Frankreich, Belgien und Deutschland anziehe, die lukrativere Arbeit, wohlhabendere Kund*innen oder spezialisierte Dienstleistungen suchen. „Das Land kann nicht ignorieren, dass Sexarbeit Teil seiner Wirtschaft und regionalen Dynamik ist. Früher oder später wird Luxemburg klarer als jetzt Stellung beziehen müssen.“
Politik, Gesetze und Sexarbeit
Luxemburgs politische und gesetzliche Herangehensweise an Sexarbeit steht im Kontext dreier ganz unterschiedlicher europäischer Modelle: dem französischen, abolitionistischen Nordischen Modell, der deutschen regulativ-legalisierenden Herangehensweise und der vollständigen Entkriminalisierung in Belgien. Diese Vielfalt beeinflusst Luxemburgs Politik, die in einer komplexen Zwischenposition verharrt.
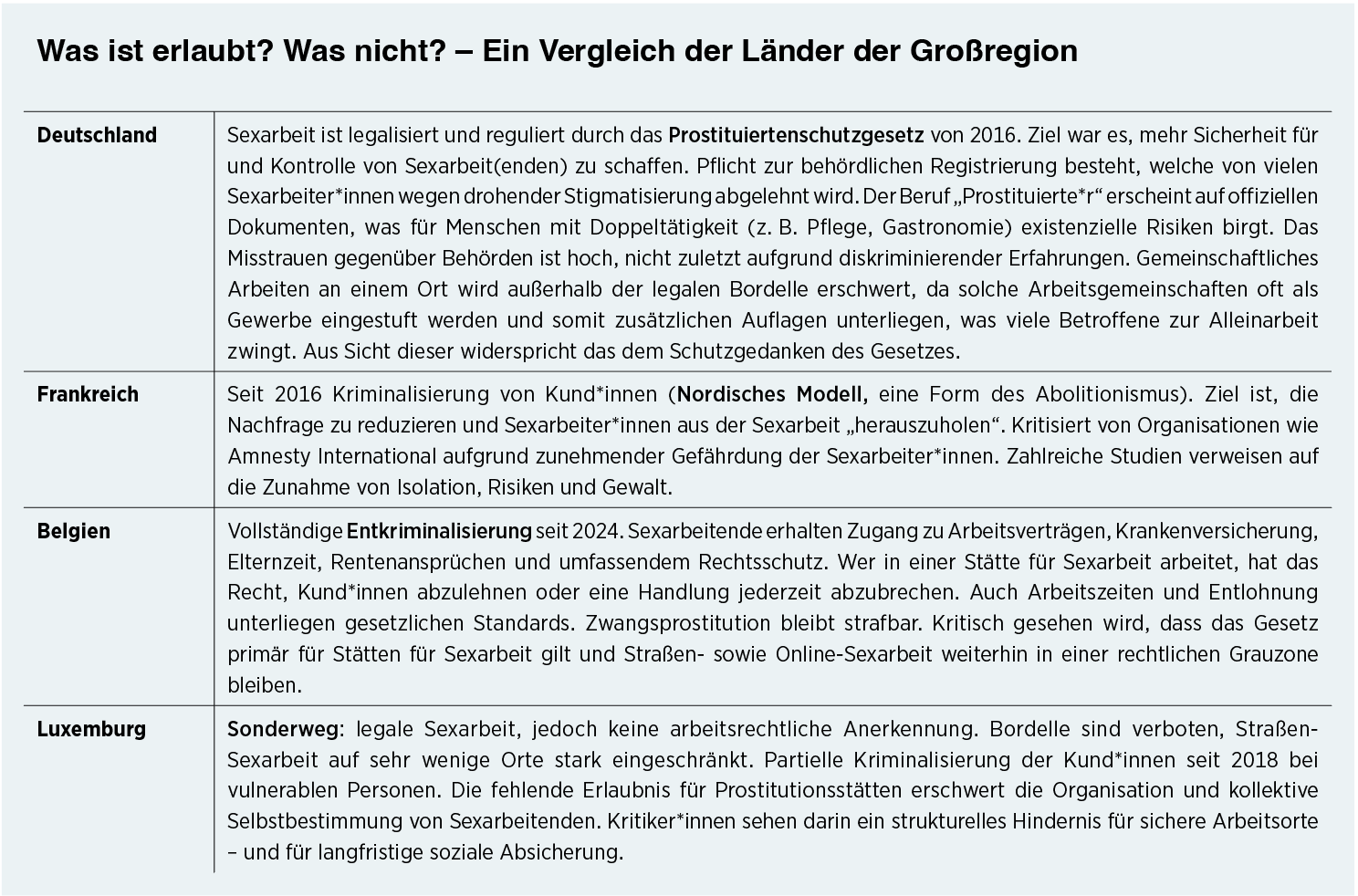
Besonders umstritten ist das Nordische Modell. „Aus politischer Sicht ist die Kriminalisierung von Sexarbeit – also auch das Nordische Modell – weltweit eines der schädlichsten Probleme“, meint Jones. „Zahlreiche empirische Studien zeigen, dass diese Maßnahmen nicht nur unwirksam sind, sondern Sexarbeiter*innen aktiv schaden.“ Auch Ramírez Díaz kritisiert: „In Frankreich fließen heute die meisten Mittel für die öffentliche Gesundheit, die für Sexarbeiter*innen bestimmt sind, an abolitionistische Verbände. Organisationen, die sich für Rechte von Sexarbeiter*innen einsetzen, erhalten kaum finanzielle Unterstützung.“ Teile dieses Modells beeinflussen ebenfalls die Gesetzgebung in Luxemburg. Befürworter*innen des Nordischen Modells argumentieren, dies senke die Nachfrage und schütze so Sexarbeiter*innen. Allerdings zeigen wissenschaftliche Untersuchungen immer wieder, dass das Nordische Modell die Situation eher verschlechtert als verbessert. Eine kanadische Studie13 etwa kam zu dem Schluss, dass Strafverfolgung und Polizeistrategien, die sich gezielt gegen Freier*innen richten, bestehende Risiken und Gefahren reproduzieren.14 Vor allem das Risiko von Gewalt und Missbrauch gegenüber Sexarbeiter*innen nehme dadurch zu. Die Forscher*innen betonen zudem, dass die Kriminalisierung der Freier*innen keinen nennenswerten Effekt auf die Reduzierung der Straßen-Sexarbeit oder die Prävalenz von Gewalt habe. Vielmehr liefere ihre Analyse „starke empirische Belege“, dass eine solche Kriminalisierung die Verhandlungsmacht von Sexarbeiter*innen hinsichtlich ihrer Arbeitsbedingungen, Sicherheit und Gesundheit erheblich beeinträchtige. Zudem verdränge dieses Modell Sexarbeit in abgelegenere, unsichere Gebiete, wo Sexarbeiter*innen weniger Möglichkeiten hätten, Kund*innen vorab zu überprüfen oder bestimmte Dienstleistungen – etwa Sex ohne Kondom – abzulehnen. Dies führe unmittelbar zu einer Zunahme körperlicher und sexueller Gewalt sowie einer erhöhten Gefahr von HIV und anderen STIs.15

Besonders aufschlussreich ist hierzu die Sicht der luxemburgischen Rechtswissenschaftlerin Salomé Lannier. Ursprünglich selbst Befürworterin des Nordischen Modells, änderte sie ihre Meinung aufgrund der vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse: „Lange Zeit habe ich an das Nordische Modell geglaubt. Ich war der Meinung, dass Prostitution abgeschafft werden sollte, weil sie gegen die Rechte der Frauen verstöße. Doch dann wurde ich Wissenschaftlerin. Ich begann, wissenschaftliche Studien über das Nordische Modell zu lesen und vor allem über die realen Auswirkungen dieser rechtlichen Rahmenbedingungen auf die Menschen, auf die sie abzielen.“ Und langsam änderte sich ihre Perspektive. „Ich habe mich entschieden von der Unterstützung des Nordischen Modells abgewendet und bin jetzt von der Entkriminalisierung überzeugter.“
Lannier betont, dass es oft eine einer politischen Agenda folgenden Fehlinterpretation von Daten sei, wenn behauptet wird, in Ländern mit Nordischem Modell würden Statistiken belegen, dass die Zahl an Sexarbeiter*innen zurückgegangen sei. „In Wahrheit wurden nach Einführung des Gesetzes Freier*innen und Sexarbeiter*innen in den Schatten gedrängt. Plötzlich gab es keine Daten mehr – nicht weil die Sexarbeit verschwunden war, sondern weil sie in den Untergrund getrieben wurde. Aber nur weil man etwas nicht mehr sehen kann, bedeutet das nicht, dass es nicht mehr existiert.“
Lannier weist auch darauf hin, dass das Vertrauen gegenüber der Polizei in Ländern mit Nordischem Modell sinke, was besonders gefährlich ist, wenn Sexarbeiter*innen Schutz vor Gewalt benötigen. Dieses Vertrauensdefizit gegenüber staatlichen Institutionen sei ein gravierender Nebeneffekt des Modells.

© Philippe Reuter / forum
Jones geht noch weiter: „Die Politik gegenüber Sexarbeit, insbesondere die Kriminalisierung, ist grundlegend klassistisch. Ich würde sogar sagen, sie ist Teil eines anhaltenden Krieges gegen die Armen. Diese Gesetze treffen gezielt wirtschaftlich marginalisierte Menschen und verstärken gesellschaftliche Ungleichheiten.“
Eine der alarmierendsten Entwicklungen sei, dass Finanzinstitute Sexarbeiter*innen zunehmend von Bankgeschäften und Zahlungsabwicklungen ausschließen. „Immer häufiger werden ihre Konten eingefroren oder gekündigt, und große Plattformen wie Mastercard, PayPal oder Cash App weigern sich, ihre Zahlungen zu bearbeiten.“ Diese Entwicklung sei auf die FOSTA- (Fight Online Sex Trafficking Act) und SESTA-Gesetze (Stop Enabling Sex Traffickers Act) in den USA zurückzuführen, die am 11. April 2018 in Kraft traten und die Haftungsbefreiung für Online-Plattformen aufhoben, wenn sie mutmaßlich sexuelle Dienstleistungen fördern. „Dies treibt Sexarbeiter*innen weltweit noch tiefer in finanzielle Unsicherheit“, bedauert Jones.
In kapitalistischen Volkswirtschaften stehe Produktivität an erster Stelle. Arbeit werde akzeptiert, wenn sie den starren Geschlechternormen und moralischen Vorstellungen entspricht. Jones meint: „Sexarbeit stellt diese Normen auf mehrfache Weise in Frage. Weil Sexarbeit außerhalb traditioneller Arbeitsmärkte stattfindet, nutzen Regierungen Kriminalisierung als Werkzeug, um Betroffene zu kontrollieren und zu bestrafen, statt systemische Ursachen wie Armut und Diskriminierung zu beseitigen.“
Auch Luxemburgs Justizministerin Elisabeth Margue zeigt sich skeptisch gegenüber dem Nordischen Modell. Sie hebt hervor, dass die Zahlen dessen Wirksamkeit nicht überzeugend belegen.
Gerade hier liegt ein Hauptproblem der luxemburgischen Debatte. Der CNFL hält trotz Kritik weiterhin am Nordischen Modell fest. Auf Nachfrage erklärt der CNFL, dass ihre Position seit 2016 nicht neu bewertet wurde. Sein zentrales Argument ist der Schutz der vulnerabelsten Personen, wofür er auf „eine Vielzahl von Studien und Umfragen“ verweist – ohne jedoch konkrete Quellen zu nennen.
Sexarbeiter*innen, die sich öffentlich äußern, seien laut CNFL lediglich Unterstützer*innen des „Prostitutionssystems“, während die eigentlichen Opfer aus Angst schweigen würden. Das „Prostitutionssystem“ erklärt der CNFL pauschal als gewalttätig.
Dem Nordischen Modell steht die Entkriminalisierung gegenüber, wie sie in Belgien umgesetzt wurde. Hier erhalten Sexarbeitende, wie in anderen Berufen auch, Zugang zu umfassenden Arbeits- und Sozialrechten.
Da das Gesetz in Belgien noch relativ jung ist, gibt es kaum belastbare Zahlen oder Daten zur Wirksamkeit. Allerdings gibt es diese aus Neuseeland, wo die Entkriminalisierung bereits 2003 eingeführt wurde. „Hier haben wir ziemlich viel Forschung vorliegen“, sagt Lannier. „Die Untersuchungen zeigen, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessert haben. Sexarbeiter*innen haben mehr Verhandlungsmacht, sowohl mit Kund*innen als auch mit Bordellbesitzer*innen.“ Dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit, auf Kondome zu bestehen. „Außerdem gibt es einen stärkeren rechtlichen Schutz für Sexarbeitende, so dass diese ihre Rechte besser wahrnehmen können. Und nicht zuletzt hat die Entkriminalisierung auch ein gestärktes Vertrauen in Institutionen wie Polizei und soziale Dienste ermöglicht. Sexarbeitende trauen sich öfters zur Polizei, wenn sie Gewalt erfahren. Durch die größere Sichtbarkeit sind sie auch erreichbarer für Unterstützungsangebote.“ Auch wenn Entkriminalisierung kein Allheilmittel gegen Gewalt und Stigmatisierung darstelle, belegen Studien aus Ländern wie Neuseeland, dass Gewalt reduziert und Gesundheitsversorgung verbessert werden können.

Neben dem Abolitionismus (Frankreich) und der Entkriminalisierung (Belgien) steht die Legalisierung bzw. Regulierung. Sexarbeit ist hier erlaubt, aber an Sonderauflagen geknüpft (z. B. Registrierung, Gesundheitsauflagen, Beschränkung auf spezielle Zonen, Lizenzpflicht für Betriebe). Wer außerhalb dieses Rahmens arbeitet, macht sich (wieder) strafbar oder handelt ordnungswidrig. Das schafft oft eine Zwei-Klassen-Struktur: „legal“ im Regime, „illegal“ daneben – mit entsprechenden Risiken.
„Legalisierung bedeutet nicht zwangsläufig Rechte“, betont Lannier. „Beispielsweise haben Sexarbeiter*innen in Ländern mit Legalisierung oft nur sehr eingeschränkt Zugang zu Arbeitsrechten. Manchmal haben sie sogar überhaupt keinen Zugang dazu.“
Ein Beispiel dafür ist neben der Gesetzgebung in den Niederlanden das deutsche Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG): Zwar gibt es durch das Gesetz verbesserte Informationen über Rechte, Gesundheitsschutzmaßnahmen und eine bessere Überwachung legaler Stätten für Sexarbeit. Gleichzeitig weist das Gesetz aber erhebliche Schwächen auf, insbesondere durch die verpflichtende Registrierung. Diese wird von vielen Sexarbeitenden abgelehnt, da sie Stigmatisierung und rechtliche Schwierigkeiten befürchten, was dazu führt, dass sich zahlreiche von ihnen in die Illegalität zurückziehen und somit weniger geschützt sind.16 Gerade marginalisierte Gruppen, wie etwa migrantische Sexarbeitende ohne Arbeitserlaubnis, bleiben von den Schutzmechanismen des Gesetzes weitgehend ausgeschlossen. Trotz der erklärten Zielsetzung des ProstSchG, die Arbeitsbedingungen von Sexarbeitenden zu verbessern, bleiben strukturelle Probleme bestehen, und eine umfassende Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen wurde bislang nicht erreicht.17
Die politische Landschaft Luxemburgs spiegelt Elemente dieser unterschiedlichen Ansätze wider. Luxemburg verfolgt seit 2018 eine eigene Zwischenlösung mit Elementen aus sowohl Abolitionismus als auch Legalisierung bzw. Regulierung: Sexarbeit bleibt grundsätzlich legal, aber ohne rechtlichen Rahmen. Bordelle bleiben verboten. Straßen-Sexarbeit ist nur auf zwei genau definierten Straßen rund um das Bahnhofsviertel gestattet – und dies ausschließlich in einem engen Zeitfenster zwischen 20:00 und 3:00 Uhr nachts. Gleichzeitig drohen Kund*innen strafrechtliche Konsequenzen, wenn sie wissentlich die Dienste von Minderjährigen, Opfern von Menschenhandel, Zuhälterei oder Zwangsprostitution, oder von besonders schutzbedürftigen Personen in Anspruch nehmen. Dazu gehören beispielsweise Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus, in prekären sozialen Lagen, Schwangere, kranke Menschen oder Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung oder Behinderung. Es drohen dann Gefängnisstrafen zwischen acht Tagen und fünf Jahren sowie Geldstrafen bis zu 50 000 €. Das Problem: Die Beweislast liegt bei den Behörden – und in der Praxis ist kaum nachzuweisen, was Kund*innen wussten oder nicht wussten. Johny Meyrer von der Polizei bestätigt, dass ihnen kein Fall einer Verurteilung bekannt sei. Zwar werden regelmäßig Kund*innen verhört, „allerdings kam es, soweit ich mich erinnere, noch nie zu einer Festnahme eines Kunden, da die Umstände nie glasklar waren.“

Viele halten diese Gesetzgebung deswegen für rein symbolisch, aber realitätsfern. „Die meisten Gesetze, die angeblich Menschen vor Zwang schützen sollen, tun wenig, um Betroffenen wirklich zu helfen“, erklärt Jones. „Viel entscheidender wäre es, strukturelle Probleme wie Armut, Rassismus und patriarchale Unterdrückung anzugehen – jene Faktoren, die Menschen überhaupt erst in prekäre Situationen bringen.“ Viele Leute, mit denen ich im Rahmen meiner Recherchen gesprochen habe, darunter auch Sexarbeitende, bemängeln außerdem, dass ausgerechnet diese „besonders schutzbedürftigen“ Personen mit dem neuen Gesetz quasi so behandelt werden, als würde in Luxemburg das Nordische Modell gelten. Durch die Gesetzgebung der Kriminalisierung ihrer Kundschaft werde ihnen somit ihre manchmal einzige mögliche Einkommensquelle genommen. Auch bleibt im Gesetz unklar, was mit Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen genau gemeint ist und warum ausgerechnet diese Menschen auch pauschal als „schutzbedürftig“ angesehen werden. Kritiker*innen führen beispielsweise an, dass Menschen, die körperlich behindert sind, sich durchaus selbstbestimmt zur Sexarbeit entscheiden können – unabhängig von ihrer Behinderung – und in diesem Fall keine „Errettung“ oder Schutz durch den Staat brauchen oder möchten.
Zur wirksameren Strafverfolgung erweiterte das Gesetz außerdem die Zutrittsrechte der Polizei: Mit Genehmigung der Staatsanwaltschaft dürfen Beamte jederzeit Hotels, Bars, Clubs oder andere öffentlich zugängliche Orte betreten, wenn konkrete Hinweise auf Zuhälterei vorliegen. „Das Eintrittsrecht in eine Privatwohnung hingegen ist im Code de procédure pénale geregelt“, erklärt Meyrer. „Dafür braucht es ‚sichere, präzise und übereinstimmende Anhaltspunkte, die vermuten lassen, dass dort Handlungen des Zuhältertums begangen werden‘ sowie die Zustimmung der Staatsanwaltschaft. Es ist uns nicht erlaubt, einfach so eine Wohnung zu betreten.“
Opfer von Menschenhandel, die wegen Straßenanwerbung („racolage“) auffallen, bleiben mit der neuen Gesetzgebung in Luxemburg straffrei. Zudem wurde ein neuer Straftatbestand eingeführt, der den missbräuchlichen Umgang mit Ausweisen oder Reisedokumenten im Kontext von Menschenhandel mit bis zu fünf Jahren Haft sanktioniert.
Zusätzlich wurde mit dem Gesetz die Einrichtung des Comité prostitution beschlossen. Dieses soll die Sexarbeit in Luxemburg kontinuierlich beobachten, die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans (PAN) begleiten und der Regierung regelmäßig Empfehlungen vorlegen. Das Gremium arbeitet eng mit der Koordinierungsstelle gegen Menschenhandel zusammen und kann externe Fachleute als Beobachter*innen hinzuziehen.
Das Gremium besteht aus neun ordentlichen Mitgliedern aus Justiz-, Gleichstellungs- und Innenministerium, der Staatsanwaltschaft, der Polizei, der Sozialabteilung der Stadt Luxemburg, des dropIn-Projekts für Sexarbeitende des Roten Kreuzes, der HIV-Beratung sowie der Zivilgesellschaft. Kritisiert wird allerdings, dass in diesem Gremium die Stimmen von Sexarbeiter*innen selbst fehlen. Jones fordert beispielsweise, dass politische Entscheidungsprozesse, die Sexarbeit betreffen, nur mit direkter Beteiligung von Sexarbeiter*innen stattfinden dürfen – „Nothing about us without us.“ Diese Forderung trifft auf eine Realität, in der Sexarbeiter*innen in politischen Gremien, wie dem Comité prostitution, oft noch immer fehlen. Es gibt aktuell Bemühungen, dies im Comité zu ändern, auch wenn sich die Umsetzung aufgrund des Stigmas als schwierig erweist.

Kritiker*innen wie Lannier betonen, dass Luxemburgs Politik visionslos sei, keine deutliche Richtung vorgebe und so eine nachhaltige Lösung verhindere. Die fehlende Anerkennung von Stätten für Sexarbeit erschwert zudem sichere Arbeitsbedingungen und die kollektive Selbstorganisation der Sexarbeiter*innen. Luxemburg befindet sich somit weiterhin in einer komplexen politischen Diskussion, die zwischen Schutz, Autonomie und gesellschaftlichen Erwartungen pendelt.
Justizministerin Margue verteidigt dennoch Luxemburgs Ansatz als pragmatischen Mittelweg, der vulnerablen Personen Schutz bieten soll, ohne in völlige Liberalisierung oder völligen Abolitionismus abzugleiten. Sie zeigt sich jedoch offen für neue Erkenntnisse auch seitens des Comité prostitution sowie für eine kritische Überprüfung des Modells und gesteht zu, dass wissenschaftliche Forschungen künftig stärker berücksichtigt werden sollten.
Lannier zieht einen risikobasierten Ansatz vor: „Die Realität ist, dass Sexarbeit existiert. Anstatt darüber zu streiten, ob es sie geben sollte oder nicht, sollten wir uns auf die Risiken konzentrieren, denen Sexarbeiter*innen ausgesetzt sind ‒ Ausbeutung, Gesundheitsrisiken, prekärer Migrationsstatus ‒ und darauf hinarbeiten, ihr Leben zu verbessern, indem wir sicherstellen, dass ihre Grundrechte geschützt und wirksam umgesetzt werden.“
Auch für Jones ist eine Sache klar: „Politische Maßnahmen müssen auf Schadensbegrenzung und nicht auf Verbote ausgerichtet sein. Außerdem muss sich die Politik auf die stärksten marginalisierten Communitys innerhalb der Sexarbeit konzentrieren, also auf trans Menschen, People of Color, Menschen mit Behinderungen. Und die Politik muss empirisch-wissenschaftlich fundiert sein, statt auf moralische Panik oder politische Bequemlichkeit zu setzen.“
Die Diversität der Sexarbeit(enden)
„Die Vielfalt der Menschen, die Sexarbeit verrichten, ist enorm – viel größer als allgemein angenommen“, betont Jones. „Sexarbeit wird nicht nur von cis18 Frauen, sondern auch von trans und nicht-binären Menschen ausgeübt, deren Bedürfnisse oft ignoriert werden.“ Die Gründe für den Einstieg in die Sexarbeit seien ebenso vielfältig: „In erster Linie ist Sexarbeit Arbeit – Menschen machen sie, um Rechnungen zu bezahlen, genau wie in jedem anderen Job.“
Ashanti Berrend erzählt: „Viele unserer Klient*innen nutzen die Sexarbeit als Mittel, um finanzielle Unterstützung für ihre Familien im Heimatland zu leisten. Insbesondere Migrant*innen aus Osteuropa teilen uns mit, dass sie den Großteil ihres Einkommens nach Hause schicken.“ Die Direktionsbeauftragte Claire Marchal fügt hinzu: „Andere betrachten die Sexarbeit als eine Möglichkeit des ‚einfach verdienten Geldes‘ und stehen oft unter starken wirtschaftlichen Zwängen, die ihnen wenig andere Arbeitsmöglichkeiten lassen.“
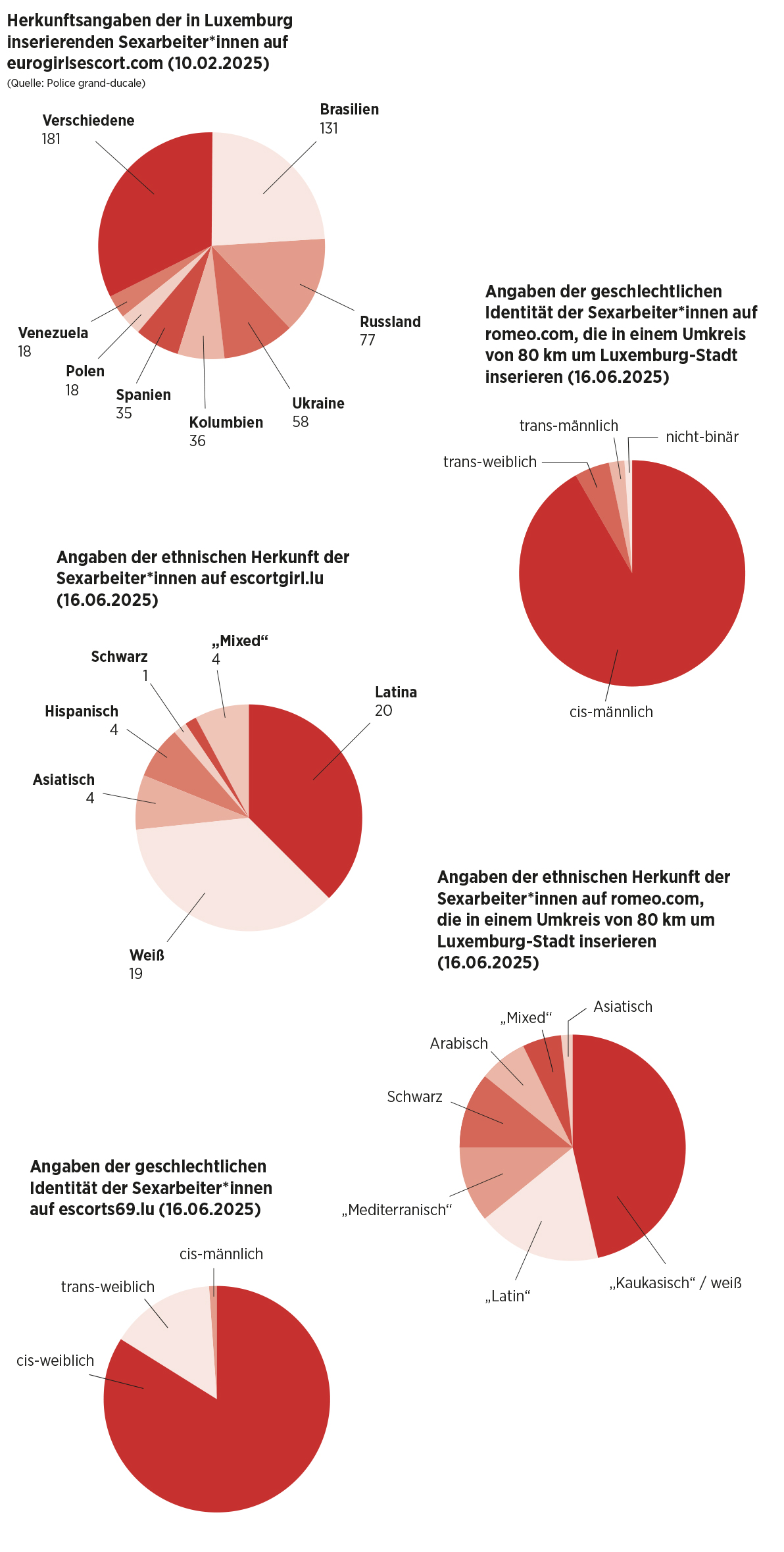
„Oft ist Sexarbeit auch eine kurzfristige Lösung für finanzielle Engpässe, beispielsweise um Ausbildungskosten zu decken“, fährt Jones fort. „Manche Menschen entscheiden sich sogar bewusst dafür, weil sie in der Sexarbeit bessere Bedingungen oder mehr Freiheit als in konventionellen Jobs finden.“
„Sexarbeit ist keine homogene Kategorie“, betont auch Ramírez Díaz. „Sie umfasst sehr unterschiedliche Menschen – mit vielfältigen Realitäten.“ In Frankreich, wo er heute lebt und arbeitet, hänge vieles von Nationalität, Rechtsstatus, Alter, Bildungsniveau und Lebenslauf ab. Das führe zu einer Hierarchisierung innerhalb der Sexarbeit. „Viele der Menschen, mit denen wir arbeiten, sind migrantische Sexarbeiterinnen, häufig aus China.“ Auch in Luxemburg hängt Sexarbeit oft mit ähnlichen Identitäts- und biographischen Kriterien zusammen.
Die Zahl der Sexarbeitenden in Luxemburg variiert stark je nach Quelle. 2020 sprach ein Artikel im L’Essentiel von 1 500 bis 2 000 Personen, die in Luxemburg der Sexarbeit nachgehen würden.19 Laut Chefkommissar Johny Meyrer waren allein auf der Website eurogirlsescort.com Anfang 2025 insgesamt 575 Anzeigen mit Bezug auf Luxemburg geschaltet, auch wenn einige Anzeigen mehrfach geschaltet sein könnten oder Ortsangaben ungenau sind. So können Anzeigen in Petingen oder Rodingen beispielsweise in der Realität von Menschen jenseits der Grenze in Frankreich oder Belgien sein. Die Herkunftsangaben dieser Inserate unterstreichen zudem die internationale Zusammensetzung der Sexarbeiter*innen: 23 % der Anzeigen stammten von Personen aus Brasilien, gefolgt von Russland (13 %), Ukraine (10 %), Kolumbien und Spanien (jeweils 6 %) sowie kleineren Anteilen aus Frankreich, Polen, Venezuela und weiteren Ländern. Allerdings muss man auch hier vorsichtig sein, da aufgrund der Nachfrage nach bestimmten Hautfarben oder „Herkünften“ Angaben strategisch angepasst werden können. Der Hintergrund: Schwarze, Indigene und People of Color werden in sexuellen Märkten oft über rassifizierte Stereotype „exotisiert“, fetischisiert oder hypersexualisiert – etwa das stigmatisierende Stereotyp des hypersexuellen Schwarzen Mannes, der stets verfügbaren „heißblütigen“ Latina oder die historische Exotisierung asiatischer Frauen –, was Nachfrage prägt und Selbstpräsentationen auf Plattformen beeinflusst. Diese Stereotype sind teils während des europäischen Kolonialismus entstanden und wirken bis heute fort. Studien zeigen, dass solche rassifizierten Wünsche und Ausschlüsse online weit verbreitet sind und BIPOC20 häufig auf stereotype Rollen reduzieren – ein Muster, das auch auf Sex-Dienstleistungsportalen fortwirken kann.
„Wenn Migrant*innen nach Europa kommen, müssen sie überleben“, erklärt Ramírez Díaz. „Aber die Realität ist, dass nicht alle Migrationen gleich sind. Es gibt soziale Klassen in der Migration: Menschen, die mit einem Studienvisum oder einer Aufenthaltsgenehmigung kommen, können sich leichter in das akademische oder berufliche System integrieren. Menschen, die aus prekären Verhältnissen kommen, oft aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen in ihren Herkunftsländern, haben nicht die gleichen Möglichkeiten.“ Allerdings sei Sexarbeit für viele Migrant*innen keine Entscheidung, die sie erst hier getroffen haben müssen, sondern kann auch eine Kontinuität ihrer bisherigen Arbeit sein.
Auch trans Menschen – insbesondere trans Frauen – müssen besonders berücksichtigt werden. Trans Personen geraten zunehmend in den Fokus gesellschaftlicher Debatten. Transfeindlichkeit, die sowohl gesellschaftlich als auch politisch zunimmt, führt dazu, dass trans Menschen überdurchschnittlich häufig mit Arbeitslosigkeit konfrontiert sind. Gleichzeitig werden trans Körper, ähnlich wie BIPOC, ebenfalls von der Gesellschaft fetischisiert. Dies bedeutet, dass trans Menschen häufig Sexarbeit als einen der wenigen Wege sehen, überhaupt Geld verdienen zu können – auch in Luxemburg: Von den 5 146 Besuchen21 beim dropIn im Jahr 2023 sind 3 % auf trans Menschen zurückzuführen.22 Dabei machen trans Menschen weniger als 1 % der Gesamtbevölkerung aus.
Die Folgen dieser toxischen Mischung aus Hass und Fetischisierung sind oft tödlich: Am 20. November jeden Jahres, dem Trans Day of Remembrance, werden die Namen jener trans Personen veröffentlicht, die weltweit ermordet wurden. Jedes Jahr aufs Neue zeigt sich, dass trans Sexarbeiterinnen, insbesondere trans BIPOC, unter den Opfern stark überrepräsentiert sind – 2024 lag ihr Anteil bei erschreckenden 46 %, 2008 sogar bei 84 %.23 Hier wird erneut klar, dass Sexarbeitspolitik untrennbar mit Fragen von Diversität, sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Anerkennung verknüpft ist.
Die Diversität innerhalb der Sexarbeit zeigt sich im neoliberalen Kapitalismus jedoch auch anhand der sozialen Klassen. Bei Sexarbeit denken die meisten einseitig an die Straßensexarbeiterin aus ärmeren Verhältnissen. Doch Sexarbeit gibt es in sämtlichen sozialen Schichten. „Wenn man soziale Klassen analysiert, denkt man oft zuerst an Besitz, Einkommen und Produktionsmittel“, erklärt Ramírez Díaz. „Sexarbeit lässt sich nicht allein ökonomisch betrachten.“
Beispielsweise erlebe eine 60-jährige migrantische Sexarbeiterin eine völlig andere Realität als eine 20- oder 30-Jährige. „Ältere Sexarbeiter*innen verdienen weniger, erleben größere physische und soziale Herausforderungen und sind stärker ausgegrenzt. Auch Sprachbarrieren haben massive Auswirkungen: Sie können migrantische Sexarbeiter*innen abhängig machen – von Mittelsleuten, Übersetzer*innen oder Zuhälter*innen.“ Bei der Analyse von Sexarbeit müssten daher neben ökonomischen Faktoren unbedingt ethnische Herkunft, Migrationshintergrund, Alter, Gesundheitsstatus sowie Zugang zu sozialen Diensten einbezogen werden.

Auch aktuelle Zahlen aus Online-Portalen zeigen die Vielfalt des Sexarbeitsmarkts: Auf Luxgirls.lu waren am 16. Juni 2025 18 Anzeigen aktiv, darunter 14 cis Frauen und vier trans Frauen. Auf escortgirl.lu liefen 62 Anzeigen (1 arabisch, 4 asiatisch, 1 schwarz, 4 hispanisch, 20 Latina, 4 mixed, 19 weiß), auf escort-luxembourg.lu 110 Anzeigen, überwiegend von Frauen. Escorts69.lu listete sogar 362 Anzeigen, primär cis Frauen, aber auch 49 trans Frauen und einen cis Mann. Der hohe Anteil an trans Frauen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung verdeutlicht wieder das globale Phänomen, dass trans Frauen überdurchschnittlich häufig in der Sexarbeit anzufinden sind.
Über Romeo.com/Hunqz (für queere Anbieter*innen, insbesondere schwule und bisexuelle Männer sowie trans Frauen) wurden 279 Inserate im Umkreis von 80 km um Luxemburg-Stadt gemeldet: darunter vier trans Männer, zwölf trans Frauen, drei nicht-binäre Personen, der Rest cis Männer. Von der selbst ausgewiesenen Ethnie waren 102 Caucasian, 44 Latin, 27 Mediterranean, 24 Black, 16 Arab, 12 Mixed und 4 Asian.
Online erzählen die Inserate eine ganz andere Geschichte als das stereotype „Kommen und Gehen“. Neben klassischem Sex werben viele Anbieter*innen mit spezialisierten Erlebnissen wie BDSM-Sessions mit klar ausgehandelten Rollen von Dominanz und Unterwerfung, eindringliche Fetisch- oder Nassspiele, Rollenspiele sowie gezielte Feminisierungspraktiken für männliche Kunden. Auch Fisting, Massage mit erotischem Fokus und intime „Girlfriend/Boyfriend Experience“ zählen zu den häufig angebotenen Dienstleistungen – diese reichen von entspannten Begegnungen am Abend bis hin zu Begleitdiensten für gesellschaftliche Anlässe. Insgesamt zeigen die zahlreichen Profile, dass es im digitalen Sexarbeitsmarkt nicht nur um schnellen körperlichen Kommerz geht, sondern um ein reichhaltiges Spektrum von Spiel, Begegnung, körperlicher, aber auch emotionaler Nähe.
Auf Anfrage weist die Polizei darauf hin, dass sie jedoch keine Statistik im Kontext mit der Sexarbeit insgesamt in Luxemburg führe, da es unter anderem wegen der Fluktuation an Menschen und unterschiedlichen Diensten in der Sexarbeit nicht möglich sei, eine halbwegs verlässliche Zahl zu nennen. Diese enorme Diskrepanz zwischen den unterschiedlichen Zahlen und Schätzungen sowie die institutionell begrenzte Datenerhebung machen deutlich, wie schwer es ist, die tatsächliche Größe des Sexarbeitsmarkts in Luxemburg belastbar zu erfassen.
Daten zu freiwilliger Sexarbeit sind praktisch nicht zu finden. Das liegt einerseits an der gesellschaftlichen Unsichtbarkeit der Sexarbeit, andererseits an der Problematik des Begriffes „Freiwilligkeit“ selbst, da, wie wir gesehen haben, wirtschaftliche Zwänge unter kapitalistischen Bedingungen jede Form der Erwerbsarbeit mit einer gewissen Notwendigkeit verbinden, während unterschiedliche Diskriminierungsformen (Rassismus, Klassismus, Ausländer*innen-, Trans- oder Behindertenfeindlichkeit) Möglichkeiten der Erwerbsarbeit stark einschränken können. Gleichzeitig zeigen aktuelle Evaluationen zum Prostituiertenschutzgesetz in Deutschland, dass der Begriff „Freiwilligkeit“ in der Sexarbeit stets kritisch diskutiert wird: Während Sexarbeit von einigen Akteur*innen grundsätzlich als Verletzung der Menschenwürde, der Grundrechte und des Gleichheitssatzes bewertet wird, betonen andere, dass ein solcher pauschaler Ansatz die Selbstbestimmung der Sexarbeitenden ignoriert und diese als rechtlich unmündige Subjekte behandelt. In ihrem „Rechtsgutachten zur Freiwilligkeit in der Prostitution“ kommt das deutsche Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu der Schlussfolgerung: „Nach den Maßstäben der Rechtsordnung wird Prostitution nicht per se unfreiwillig ausgeübt, vielmehr besteht die Möglichkeit einer im Rechtssinne freiwilligen Prostitution. Prostitution ist mit dem rechtlichen Konzept der Freiwilligkeit und der Selbstbestimmung im Sinne von Art. 2 GG nicht von vornherein unvereinbar.“24
Gleichzeitig weist das Gutachten auf die Grenzen des Konzepts der Freiwilligkeit hin: „Insbesondere lassen sich zentrale Probleme (wie etwa das Phänomen der Armutsprostitution) nicht über die Freiwilligkeit lösen, weshalb sie auch nicht in diesen Bereich verschoben werden dürfen.“25 Dennoch wird hervorgehoben, dass die Anerkennung von Freiwilligkeit in der Sexarbeit eine wichtige Voraussetzung ist, um Sexarbeitende nicht als bloße Opfer, sondern als Träger*innen von Grundrechten und individueller Autonomie anzuerkennen. Dies erfordert jedoch eine differenzierte Betrachtung, die neben strukturellen Zwängen auch die subjektiven Perspektiven der Sexarbeitenden respektiert und schützt.
Zwischen Medien, Stigma und Empowerment
Sexarbeit ist ein gesellschaftlich stark stigmatisiertes Thema, das häufig von emotional aufgeladenen Debatten und Vorurteilen geprägt wird. Ein besonders prägnantes Beispiel hierfür liefert eine Diskussion in der Sendung Stern TV vom 16. Oktober 2024. Dort trat die deutsche CSU-Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär auf, eine Befürworterin des Nordischen Modells, die während der Sendung eine kontroverse Aussage traf. Bär argumentierte, dass Sexarbeitende entweder „halbfreiwillig“ oder aufgrund emotionaler Abhängigkeiten tätig seien und stellte dabei direkte Zusammenhänge zwischen Sexarbeit und früherem Kindesmissbrauch her.

In derselben Sendung26 wurde Nicole Schulze, eine Sexarbeiterin aus Trier, die auch in Luxemburg arbeitet, unmittelbar von Bär konfrontiert. Schulze wurde vorgeworfen, von Lobbyisten bezahlt zu sein, denn, so die CSU-Politikerin: „Selbstbestimmung ist eine absolute Mär! Man muss es sich natürlich irgendwann einreden, weil man denkt, man kommt da gar nicht mehr raus.“ Schulze widersprach deutlich: „Ich bin seit zwanzig Jahren in der Prostitution, und zwar als Straßensexarbeiterin. Ich finde es von Ihnen nicht korrekt, dass Sie mich hier hinstellen, nur weil ich Mitglied im Berufsverband für Sexarbeit bin, als wäre ich von der Lobby bezahlt.“ Die Diskussion verdeutlicht exemplarisch, wie tief verwurzelt Vorurteile und Stigma gegenüber Sexarbeiter*innen auch auf politischer Ebene noch sind.
Stigma in der Sexarbeit bedeutet, dass Menschen aufgrund ihrer Tätigkeit systematisch abgewertet, diskriminiert oder unsichtbar gemacht werden. Oft werden Sexarbeiter*innen als Opfer ohne Handlungsmacht dargestellt oder pauschal mit Kriminalität, Drogen und Gewalt in Verbindung gebracht. Hinzu kommt ein sogenanntes sekundäres Stigma: Nicht nur die Sexarbeitenden selbst, sondern auch ihre Familien, Partner*innen oder Kinder können Vorurteilen ausgesetzt sein. In der Soziologie spricht man in Anlehnung an Erving Goffman27 von einem „beschädigten sozialen Status“, der dazu führt, dass Betroffene ihre Tätigkeit oft verbergen müssen, um nicht gesellschaftlich ausgeschlossen zu werden. Das hat Folgen für ihre Gesundheit, ihre ökonomische Sicherheit und die Möglichkeit, ihre Rechte einzufordern.
In diesem Rahmen sprechen Betroffene oft auch von Hurenfeindlichkeit (engl.: whorephobia): Sie bezeichnet die Abwertung, Stigmatisierung oder Diskriminierung von Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind oder mit ihr assoziiert werden. Der Begriff umfasst sowohl individuelle Vorurteile als auch strukturelle Formen der Ausgrenzung. Hurenfeindlichkeit manifestiert sich in gesellschaftlichen Normen, Gesetzen und kulturellen Vorstellungen, die Sexarbeitende entwerten oder kriminalisieren. Hurenfeindlichkeit ist stark verstrickt mit anderen Diskriminierungsformen wie Frauenfeindlichkeit oder Klassismus. So kann sich Hurenfeindlichkeit beispielsweise auch als eine Form sozialer Kontrolle über Frauen ausdrücken, die deren sexuelle und ökonomische Autonomie einschränkt. Sexarbeiterinnen werden oft auch als „schlechte Frauen“ dargestellt, was dazu führt, dass andere Frauen sich von ihnen distanzieren, um nicht selbst stigmatisiert zu werden. Hurenfeindlichkeit kann sich in verschiedenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen zeigen, darunter:
- Gesetzgebung, die Sexarbeit oder deren Kund*innen kriminalisiert oder stark reguliert
- Mediale Darstellungen, die Sexarbeiter*innen stereotypisieren
- Gesellschaftliche Einstellungen, die Sexarbeit als moralisch verwerflich oder per se bedauernswert ansehen
Dass eine solche Haltung nicht nur vereinzelte politische Meinungen, sondern auch ein generelles gesellschaftliches Klima widerspiegelt, zeigt sich auch in Luxemburg. Tatsächlich ist es sehr schwierig, Sexarbeitende zu finden, die bereit sind, öffentlich zu sprechen. Im Rahmen meiner Recherchen habe ich online Dutzende Sexarbeitende unterschiedlicher geschlechtlicher Identitäten angeschrieben. Nur eine Handvoll hat überhaupt geantwortet. Fast alle lehnten ein Gespräch ab. Das hat mehrfache Gründe: Für viele Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus ist Sexarbeit oft der einzige Weg, Geld zu verdienen. Diese Menschen bleiben aus verständlichen Gründen gerne unterm Radar, um nicht abgeschoben zu werden. Auch ist das Misstrauen gegenüber Außenstehenden aufgrund von Gewalterfahrungen besonders groß, vor allem bei trans Sexarbeiter*innen. Hinzu kommt die gesellschaftliche Stigmatisierung der Sexarbeit. „Viele haben schlechte Erfahrungen mit Journalist*innen gemacht“, berichtete 2021 Tess Funck von der Beratungsstelle dropIn in einem Journal-Artikel.28 „Oft beschweren sie sich, dass sie nachher komplett falsch zitiert werden.“
Diese Erfahrung hat auch Jones bei Recherchearbeiten gemacht: „Die komplexen Realitäten von Sexarbeitenden finden in den Medien selten Beachtung. Sie bevorzugen oft eher sensationelle Geschichten von Ausbeutung, Missbrauch und Leid.“ Auch Luxemburger Medienberichte sind oft dominiert von Opfernarrativen, insbesondere im Zusammenhang mit Menschenhandel und Zwangsprostitution. Typisch sind anonyme Bilder von Polizeiautos oder klischeebesetzte Straßenszenen, die zur Stigmatisierung beitragen. Queere, trans und männliche Perspektiven aus der Sexarbeit werden kaum sichtbar gemacht oder detailliert behandelt. Auch Statistiken oder qualitative Analysen fehlen weitgehend, was die Lebensrealitäten dieser Gruppen zusätzlich unsichtbar macht.
Und selbst wenn manche Sexarbeitende in Luxemburg noch keine negativen Erfahrungen mit Medien gemacht haben, bringen viele diese negativen Erfahrungen aus dem Ausland mit nach Luxemburg. Nicht selten wird Sexarbeit beispielsweise auch medial komplett verzerrt dargestellt. Besonders drastisch wurde dies beim vermeintlichen Dokumentarfilm Lovemobil deutlich, der 2021 vom NDR zurückgezogen wurde, nachdem sich herausgestellt hatte, dass alle gezeigten Szenen mit Schauspieler*innen inszeniert waren. Solche Fälle tragen maßgeblich zum Misstrauen gegenüber Medien und damit auch zur Unsichtbarkeit echter Lebensrealitäten von Sexarbeitenden bei.
Trotz dieses schwierigen medialen Umfelds und gesellschaftlicher Ablehnung setzen sich Sexarbeiter*innen zumindest im Ausland zunehmend selbstbewusst und öffentlich für ihre Rechte ein. Nicole Schulze kritisiert insbesondere, dass Bär sie nicht einmal beim Namen genannt habe und ihr jegliche Handlungsmacht abgesprochen habe. Die Stimmen von Sexarbeitenden würden zu oft übergangen oder ignoriert, vor allem, wenn sie der politischen Agenda widersprechen.
Das Opfernarrativ hält sich hartnäckig. Dabei muss Sexarbeit nicht zwangsläufig gefährlicher oder belastender sein als andere prekäre Beschäftigungen. Wer in der Fleischindustrie ohne Schutzkleidung Schweine zerlegt oder ohne Versicherung täglich bis zu 14 Stunden Amazon-Pakete liefert, lebt unter Umständen mit deutlich höheren Risiken als so manche Menschen in der Sexarbeit – doch kaum jemand stuft diese Branchen pauschal als „unmoralisch“ ein. Warum also gilt gerade Sexarbeit so häufig als moralisch verwerflich? Warum verspüren so viele Menschen das Bedürfnis, Sexarbeiter*innen „retten“ zu wollen, während Beschäftigte in anderen prekären und gefährlichen Branchen kaum diese Aufmerksamkeit erhalten?
Der Soziologe Wíner Ramírez Díaz liefert hierfür eine Erklärung: Sexarbeit berühre unsere tiefsten Vorstellungen von Sexualität. Es gehe um die zentrale Frage, ob Sex auf Unterdrückung beruht oder vielmehr ein Raum für Freiheit und Ausdruck sei. Diese Debatte, so Díaz, werde maßgeblich von heterosexuellen und heteronormativen Normen bestimmt: „Warum existiert Sex überhaupt? In welchem Kontext ist er legitim? Der Staat entscheidet, welche Berufe als ‚würdig‘ gelten und sichtbar sein dürfen und welche unsichtbar bleiben müssen. Sexarbeit ist von dieser Logik nicht ausgenommen.“
Diese Unterscheidung zwischen vermeintlich „würdigen“ und „unwürdigen“ Tätigkeiten ist, wie Díaz betont, historisch tief verwurzelt und beruht auf gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Dabei spielen laut ihm insbesondere Vorstellungen von „Biomacht“29 eine zentrale Rolle – wiederum ein Begriff des Sozialwissenschaftlers Michel Foucault, der damit die subtile Kontrolle und Normierung menschlicher Körper durch staatliche und gesellschaftliche Institutionen beschreibt. Sexarbeit sei, so Díaz, ein exemplarisches Beispiel für diese Mechanismen: Staaten versuchten kontinuierlich, diese Form von Arbeit zu regulieren und zu kontrollieren. Dies könne entweder geschehen, indem man Sexarbeit legalisiert und steuerlich davon profitiert (wie etwa in Deutschland), oder indem man Kund*innen kriminalisiert (wie in Frankreich). Jones erklärt, dass diese Haltung tief in patriarchalen Vorstellungen wurzele: „Sexarbeit gilt nach dieser Logik als eine Tätigkeit, die Frauen nicht ausüben sollten – sie erscheint unweiblich und stellt traditionelle Vorstellungen davon infrage, dass Frauen nicht die volle Kontrolle über ihren Körper haben dürfen.“
Dahinter, so Díaz, verberge sich ein tiefsitzendes Bedürfnis, insbesondere nicht nur weibliche, sondern auch migrantische, rassifizierte und LGBTQIA+-Körper staatlich und gesellschaftlich zu regulieren und kontrollieren. Die Moralvorstellungen gegenüber Sexarbeit seien somit weniger Ausdruck tatsächlicher Sorge um das Wohlergehen der Betroffenen, sondern vielmehr Ausdruck einer gesellschaftlich etablierten „Biomacht“, die bestimmt, welche Körper und Tätigkeiten sichtbar und akzeptabel sind – und welche nicht. Während die Risiken in anderen prekären Arbeitsbereichen oft stillschweigend toleriert werden, gerate Sexarbeit vor allem deshalb in den moralischen Fokus, weil sie unmittelbar die gesellschaftlichen Vorstellungen von Sexualität und Körperlichkeit infrage stelle.
„Was ich in meiner Arbeit beobachte: Ob trans Frauen, cis Frauen oder Männer verschiedener sexueller Orientierungen – alle berichten von vielfältigen Erfahrungen“, bekräftigt Ramírez Díaz.
Berrend teilt diese Sicht: „Die Erfahrungen variieren stark. Einige Kund*innen suchen nur Gespräche, was als leicht verdientes Geld gesehen wird. Andere Erlebnisse sind nett oder skurril.“ Allerdings gebe es beim dropIn auch viele Berichte über Gewalt. „Wir unterstützen die Betroffenen dann dabei, wenn sie Anzeige erstatten wollen.“ Bei der Polizei bestätigen sie, dass es sporadisch zu solchen Fällen komme: „In dem Kontext haben wir dann auch schon Verdächtige festgenommen.“
Fachstellen wie das dropIn berichten, dass ein Teil ihrer Klient*innen mit Suchtproblemen lebt und Sexarbeit als kurzfristige, verfügbare Einnahmequelle nutzt.
Trotzdem: „Sexualität ist nicht nur Zwang, sondern auch Raum für Ausdruck und Freude“, bekräftigt Ramírez Díaz. „Viele Sexarbeiter*innen erzählten mir: ‚Dieser Kunde war attraktiv. Ich hatte Spaß und wurde sogar dafür bezahlt.‘“ Sexarbeit könne für viele Menschen ein Weg sein, körperliche Autonomie und sexuelle Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen, erklärt auch Jones. Und Ramírez Díaz fügt hinzu, dass auch das stereotype Bild, Kund*innen seien ausschließlich alte, verzweifelte Männer, nicht stimme: „Menschen nutzen sexuelle Dienstleistungen aus vielen Gründen: fehlende Zeit für Beziehungen, der Wunsch nach unverbindlichen Begegnungen oder sexuelle Neugier.“
Ein weiterer Teil hurenfeindlichen Stigmas ist das Thema der sogenannten „Beschaffungsprostitution“. Damit ist gemeint, dass manche Menschen Sexarbeit nutzen, um eine Drogensucht zu finanzieren – zum Beispiel nach Alkohol, Zigaretten, Kokain oder Heroin. Sie ist in Luxemburg vor allem dort sichtbar, wo besonders prekäre Lebenslagen zusammentreffen: im Umfeld des Bahnhofs, auf der Straße und in Übergangssituationen ohne stabiles Einkommen oder Wohnraum. Fachstellen wie das dropIn berichten, dass ein Teil ihrer Klient*innen mit Suchtproblemen lebt und Sexarbeit als kurzfristige, verfügbare Einnahmequelle nutzt. In der Praxis verschränken sich hier mehrere Risiken: kurze, versteckte Verhandlungen (etwa aufgrund zeitlicher und räumlicher Beschränkungen auf der Straße), Druck zu niedrigeren Preisen, gelegentlicher Versuch von Kund*innen, Schutzmaßnahmen auszuhandeln oder zu verweigern, sowie die Notwendigkeit schneller Barzahlungen. Für Betroffene, die konsumreduzierend oder substituierend arbeiten möchten, bleiben stabile Wohnung, gesicherter Aufenthaltsstatus, Zugang zu medizinischer Versorgung und verlässliche Einkünfte zentrale Stellschrauben. Entsprechend weisen internationale Hilfsangebote darauf hin, dass wirksame Antworten nicht in weiterer Kriminalisierung liegen, sondern in Harm-Reduction, niedrigschwelliger Gesundheitsversorgung, Wohn- und Einkommenssicherung sowie rechtlichen Rahmenbedingungen, die Sicherheit und Verhandlungsräume statt Verdrängung schaffen.
Doch das Verkaufen von Sex zur Finanzierung einer Sucht ist nur ein Teil des Bildes. Neben Menschen mit schwerer Abhängigkeit gibt es auch solche, die nie oder nur gelegentlich konsumieren – etwa alle paar Monate bei besonderen Anlässen. Viele Sexarbeiter*innen haben keinerlei problematischen Konsum. Das öffentliche Bild reduziert Sexarbeit jedoch häufig auf den Aspekt der Drogensucht und verstärkt dadurch das Stigma: Sexarbeitende erscheinen pauschal als suchtkrank, fremdbestimmt und unfähig, Grenzen zu setzen.
Die gelebte Realität von Sexarbeiter*innen in Luxemburg
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen prägen die Arbeitsrealität von Sexarbeiter*innen massiv – das wird besonders deutlich am Beispiel der Straßensexarbeiterin Nicole Schulze. Schulze, die seit vielen Jahren als Sexarbeiterin tätig und Mitglied im deutschen Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen (BesD) ist, arbeitet regelmäßig in Luxemburg. Ihre Erfahrungen zeigen, wie konkrete politische Entscheidungen unmittelbar Einfluss auf die Sicherheit und Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter*innen nehmen.
Schulze beschreibt eindrücklich, welche Auswirkungen die strikte Eingrenzung der Straßensexarbeit in Luxemburg auf ihre tägliche Arbeit hat. Sie könne nur in dieser geographischen und zeitlichen Begrenzung arbeiten und müsse die Verhandlungen mit ihren Kunden deswegen oft extrem kurz halten. „Ich muss ständig darauf achten, nicht aufzufallen“, erzählt sie. Doch gerade diese Kürze birgt erhebliche Risiken: „Weil ich im Voraus weniger Zeit habe, alle Details genau zu klären, kann es passieren, dass Kunden später sexuelle Praktiken verlangen, die ich eigentlich gar nicht anbiete.“
Die eingeschränkte Möglichkeit für Verhandlungen führt auch dazu, dass sie oft Situationen erlebt, die sich kaum kontrollieren lassen. „Es kommt vor, dass mich ein Kunde anspricht und ich direkt mitgehe, ohne genau zu wissen, was mich erwartet“, sagt Schulze. Dies könne in dunklen, isolierten Räumen enden, in denen sie im Notfall keine Hilfe rufen könnte – ein Szenario, das sie mit deutlicher Sorge schildert. Ihre Arbeitssituation in Luxemburg empfindet Schulze deshalb insgesamt als risikoreicher.
Besonders problematisch sieht Schulze zudem das bestehende Bordellverbot in Luxemburg. Da keine offiziellen, geschützten Orte existieren, sei sie gezwungen, in Hotels oder Privatwohnungen der Kunden zu arbeiten. Diese Orte entziehen sich jedoch weitgehend einer Kontrolle. Die Folge ist eine weitere Verschärfung des Risikos, Opfer von Gewalt zu werden, und die Schwierigkeit, im Notfall Unterstützung zu erhalten.
Schulzes Erfahrungen verdeutlichen die Komplexität der Thematik: Restriktive Gesetze, die angeblich dem Schutz von Sexarbeiter*innen dienen, erhöhen in der Realität oft deren Verletzlichkeit. Ihre Berichte sind ein starker Hinweis darauf, dass gut gemeinte politische Maßnahmen nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung der tatsächlichen Lebensrealität von Sexarbeiter*innen führen.
Die strukturellen Herausforderungen, die Nicole Schulze schildert, sind kein Einzelfall. Auch andere Sexarbeiter*innen berichten von ähnlichen Spannungen zwischen individueller Lebensrealität und politischen Rahmenbedingungen. Ihre Geschichten zeigen, wie vielfältig die Motive, Wege und Erfahrungen in der Sexarbeit sind – und wie sehr diese von gesellschaftlichen Zuschreibungen und gesetzlichen Vorgaben geprägt werden. Eine dieser Geschichten ist die von Miro, der als männlicher Sexarbeiter mit Migrationsgeschichte ganz eigene Perspektiven auf das Thema eröffnet.
Ich habe Miro über ein Online-Portal für queere Sexarbeiter*innen kontaktiert. Gut ein Dutzend Escorts in Luxemburg habe ich auf diesem Portal angeschrieben und für ein Gespräch angefragt – auf Wunsch auch anonym. Miro war die einzige Person, die geantwortet hat.
Jetzt sitzt Miro – der eigentlich anders heißt – mir gegenüber in einem Café nahe dem Luxemburger Hauptbahnhof. Ursprünglich stammt er aus der Ukraine, lebt aber seit über 25 Jahren in verschiedenen europäischen Ländern, zuletzt acht Jahre in Luxemburg. Sein Weg in die professionelle Sexarbeit verlief schrittweise und war anfangs mehr Zufall als bewusste Berufswahl.
„Als ich jünger war, habe ich regelmäßig trainiert und war ziemlich fit“, erinnert sich Miro. „Damals kamen gelegentlich Männer auf mich zu und boten mir Geld für Sex an. Ehrlich gesagt hat mir das damals gefallen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte er Sexarbeit jedoch nicht aktiv gesucht; die Angebote kamen spontan und waren situationsabhängig. „Wenn ich jemanden attraktiv fand, nahm ich das Angebot an. Wenn nicht, habe ich einfach abgelehnt. Ich war jung und mochte die Bestätigung.“
Sein Einstieg in die professionelle Sexarbeit erfolgte aus einer konkreten Notlage heraus: Als seine Mutter schwer erkrankte und auf teure Medikamente angewiesen war, wurde das zusätzliche Einkommen essenziell. „Die Medikamente meiner Mutter kosteten monatlich zwischen 300 und 400 Euro, das war für mich in Italien – mit meinem damaligen Monatsverdienst von rund 700 Euro – kaum zu bewältigen.“ Er erinnerte sich an die früheren Erfahrungen und entschied sich bewusst für die Sexarbeit. „Ich hatte damals eine klare Wahl zu treffen. Das Geld war notwendig, und die Angebote waren vorhanden. Warum also nicht?“
Die professionelle Tätigkeit war dennoch anders, als er es erwartet hatte. „Anfangs war ich sehr wählerisch und nahm nur Kunden an, die ich auch persönlich attraktiv fand. Doch schnell verstand ich, dass ich Sexarbeit als Geschäft betrachten musste, wenn ich damit ausreichend verdienen wollte. Plötzlich ging es nicht mehr um persönliche Vorlieben, sondern um den finanziellen Aspekt.“ Die Dynamik änderte sich stark: Wo früher spontane Begegnungen standen, waren nun konkrete Absprachen und Erwartungen zu erfüllen.
Miro beschreibt die Unterschiedlichkeit seiner Kunden und deren Bedürfnisse als eine zentrale Herausforderung seines Berufs. „Einige Kunden sehen Sexarbeit als rein geschäftlichen Austausch. Andere entwickeln eine emotionale Verbindung, suchen nach Intimität und Zuneigung, nicht nur nach körperlichem Vergnügen. Es erforderte Übung, diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig professionelle Distanz zu wahren.“

Mittlerweile arbeitet Miro vorwiegend als BDSM-Master. Dieser Wechsel war für ihn ein natürlicher Übergang. „BDSM bietet viel klarere Grenzen als traditionelles Escorting. Alles, was passieren darf und soll, wird vorab detailliert ausgehandelt. Das macht die Arbeit psychologisch einfacher und emotional weniger belastend“, erklärt er. Gerade die klaren Rollenverteilungen im BDSM erlauben es ihm, eine gewisse Distanz aufrechtzuerhalten, die im traditionellen Escorting oft schwieriger sei, insbesondere wenn Kunden emotionale Bedürfnisse entwickelten.
Sein Kundenspektrum ist dabei breit gefächert: Von Männern aus der Geschäftswelt, die in ihrem Alltag die Kontrolle haben und diese bei ihm bewusst abgeben wollen, bis hin zu Menschen, die erstmals ihre verborgenen Wünsche erkunden möchten. „Ich habe viele Stammkunden, einige leben in Beziehungen, in denen sie ihre BDSM-Vorlieben nicht offen ausleben können. Andere sind Single und möchten einfach neue Erfahrungen sammeln. Diskretion ist dabei immer entscheidend“, betont Miro.
„Es existiert immer noch das verbreitete Bild, dass alle Sexarbeiter*innen verzweifelt oder gezwungen sind“, sagt Miro kritisch. „Natürlich gibt es Menschen, die Sexarbeit aus finanzieller Not wählen – wie ich zu Beginn –, aber es gibt auch viele, die sich bewusst und freiwillig dafür entscheiden. Die Realität ist komplexer als das stereotype Bild.“
Trotz dieser Herausforderungen und Stigmatisierungen ist Miro selbstbewusst und stolz auf seinen Lebensweg. Dennoch ist ihm klar, dass er diesen Beruf nicht für immer ausüben möchte. „Momentan funktioniert diese Arbeit gut für mich. Ich genieße die Unabhängigkeit, meine eigenen Regeln und meinen eigenen Zeitplan festzulegen. Trotzdem weiß ich, dass ich mich irgendwann beruflich verändern werde.“ Er beschreibt Sexarbeit als emotional und körperlich durchaus belastend. „Es ist keine Tätigkeit, die man für immer macht. Aber aktuell komme ich gut damit zurecht.“
Für Miro war seine Tätigkeit als Escort und BDSM-Master eine Lernerfahrung, die ihm tiefe Einblicke in menschliche Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte ermöglichte. „Ich habe durch diesen Job enorm viel über mich selbst und andere gelernt. Ich habe faszinierende Menschen kennengelernt – Kunden, andere Sexarbeiter*innen und Menschen aus der Branche. Es ist ein einzigartiges Leben, das sicherlich nicht für jeden geeignet ist. Aber für diejenigen, die es verstehen, macht es absolut Sinn.“
Während Miro von Selbstbestimmung, stabilen Rahmenbedingungen und einem gewissen Maß an Kontrolle über seinen Berufsalltag berichten kann, zeigt sich in anderen Bereichen der Sexarbeit ein ganz anderes Bild. Besonders auf der Straße treffen strukturelle Unsicherheiten, rechtliche Grauzonen und gesellschaftliche Marginalisierung aufeinander. Um diese Spannungen besser zu verstehen, ist ein Perspektivwechsel notwendig – hin zu jenen, die unter deutlich prekäreren Bedingungen arbeiten.
Es ist spät in der Nacht und leichter Regen fällt auf die Hollericher Straße in Luxemburg. Trotz der späten Stunde und der offiziellen Erlaubnis zur Straßensexarbeit zwischen 20:00 und 3:00 Uhr ist kaum jemand unterwegs. Nur eine einzelne Frau steht an einer Straßenecke. Sie ist Schwarz, etwa Mitte dreißig bis vierzig Jahre alt und spricht Englisch mit einem leichten Akzent. Nennen wir sie Brianna. Nach einer kurzen Verhandlung erklärt sie sich bereit, für 25 Euro zehn Minuten zu reden.

Brianna stammt aus Jamaika, ist zunächst nach Spanien gekommen und von dort aus weiter nach Luxemburg gereist, um in der Straßensexarbeit zu arbeiten. Früher habe sie deutlich besser verdient, sagt sie, aber in letzter Zeit sei das Geschäft schlecht geworden. Auf die Frage, wie ihre Kund*innen sie behandeln, antwortet Brianna zurückhaltend, doch deutlich: „Manche sind nett, aber viele können auch echt böse Typen sein. Sie können gewalttätig werden.“
Brianna beschreibt damit eine Realität, die im starken Gegensatz zur Sexarbeit in sicheren und kontrollierten Bordellen, über Online-Portale oder Escort-Agenturen steht. Ihre tägliche Arbeit auf der Straße ist geprägt von einer ständigen Balance zwischen der Notwendigkeit, Geld zu verdienen, und der realen Gefahr körperlicher Gewalt.
Ihre Situation spiegelt eine tiefere gesellschaftliche Problematik wider, in der Migration und Sexarbeit eng miteinander verwoben sind. Gerade migrantische Sexarbeiter*innen wie Brianna, die möglicherweise ohne gesicherten Aufenthaltsstatus oder mit prekärer Aufenthaltserlaubnis in Luxemburg leben, erleben besonders deutlich die Schattenseiten restriktiver europäischer Migrationspolitik. Diese politische Realität zwingt viele Migrant*innen in prekäre Arbeitsbedingungen, da sie vom regulären Arbeitsmarkt weitgehend ausgeschlossen bleiben.
Personen ohne gültigen Aufenthaltstitel sind bereits systematisch von sozialen Sicherungssystemen ausgeschlossen. Ihre Existenz in Europa bedeutet oft permanentes Verbergen und die ständige Angst vor Abschiebung. Sexarbeit ist dabei nicht das eigentliche Problem, sondern vielmehr die fehlende politische Bereitschaft, grundlegende strukturelle Bedingungen wie eine humane Migrationspolitik und einen gerechten Zugang zum Arbeitsmarkt zu schaffen.
Das Gespräch mit Brianna verläuft freundlich, doch kurz. Ihr Misstrauen gegenüber Fremden, insbesondere Journalist*innen, ist spürbar und verständlich angesichts der Risiken, denen sie möglicherweise ausgesetzt ist. Das luxemburgische Modell mag in Teilen richtig gedacht sein, doch in der Praxis benötigt es deutlich mehr, um tatsächlich Schutz und Würde für diejenigen zu gewährleisten, die am meisten gefährdet sind.
Nicole, Miro, Brianna. Drei Sexarbeiter*innen mit drei radikal unterschiedlichen Erfahrungen. Im dropIn erklärt mir die diplomierte Sozialpädagogin Eve Ravenel, dass es vor allem die Menschen auf der Straße sind, die erhöhter Gefahr für Gewalt ausgesetzt sind: „In einem Jahr kann es drei oder vier besorgniserregende Situationen geben.“ Solche Vorfälle seien oft so absurd und brutal, dass es schwer sei, sie Außenstehenden überhaupt zu vermitteln. Ein Beispiel sei der Fall einer Frau aus Bulgarien, die weder Englisch noch eine der Landessprachen beherrschte. Zudem hatte die Frau vermutlich eine Lernschwierigkeit oder eine kognitive Beeinträchtigung.

Ravenel erinnert sich daran, dass es schwer war, der Frau verständlich zu machen, dass sie schwanger war. Im siebten Monat kam sie dann mit massiven Blutergüssen in die Anlaufstelle – offenbar war sie gezielt angegriffen worden, möglicherweise mit dem Ziel, dass sie das Baby verliert. „Ihr Bauch war getroffen, sie blutete bereits, wir mussten sie sofort ins Krankenhaus bringen“, berichtet Ravenel. Das Baby lebte noch und es hieß, es könne nur durch Kaiserschnitt zur Welt kommen, wenn es soweit wäre. Doch kurz darauf verschwand die Frau spurlos von den Straßen Luxemburgs. Weder das dropIn-Team noch andere Sexarbeiter*innen wussten, wo sie sich befand. Die Angst war groß, sie tot oder schwer verletzt wiederzufinden. Wochen später tauchte die Nachricht auf: Sie hatte es bis nach Berlin geschafft und wurde dort in einem Bahnhof gefunden, als ihre Wehen einsetzten. Passant*innen riefen einen Krankenwagen und sie brachte ihr Kind im Krankenhaus zur Welt.
Während die Straßensexarbeit also ein besonders hohes Risiko berge, seien die Probleme in der Wohnungssexarbeit meist anderer Art, erklärt Ravenel: „Hier berichten uns die Betroffenen eher von unangemessenem Verhalten seitens der Kund*innen – Situationen, die zwar belastend, aber weniger häufig gewalttätig sind.“
Ich möchte wissen, wie die Erfahrungen der Sexarbeitenden mit der Polizei sind: Melden sie Fälle bei der Polizei? Nimmt diese sie ernst? Ravenel betont, dass es unterschiedliche – gute und schlechte – Erfahrungen gibt. In einzelnen Fällen hätten Polizist*innen sensibel reagiert und es ermöglicht, dass sie als Sozialpädagogin während einer Vernehmung anwesend war, um einer Sexarbeiterin Sicherheit zu geben. Ohne diese Unterstützung, so ist sie überzeugt, hätte die Frau ihr Erlebnis nicht im Detail schildern können – und die Ermittlungen wären ins Stocken geraten.
Andererseits gebe es aber auch negative Vorfälle, die Ravenel als Belege institutioneller Gewalt beschreibt. Ein Beispiel sei der Fall einer Frau, die einen Polizisten direkt auf Gewalt, die sie erlebt hatte, ansprach und zur Antwort bekam: „Du bist auf der Straße, so ist das nun mal.“ Solche Bemerkungen machten deutlich, dass viele Betroffene sich von Institutionen abgelehnt fühlten und ihre Beschwerden nicht ernst genommen würden. „In meiner beruflichen Erfahrung im dropIn habe ich sowohl mit korrekt handelnden Polizist*innen zu tun gehabt als auch mit solchen, die wenig oder falsch über das Thema informiert waren und die besser geschult werden müssten, um die Nuancen dieser Arbeit zu verstehen“, bekräftigt Ravenel.
Generell zeige sich, dass das Vertrauen in die Polizei stark schwanke. Menschen, die auf der Straße lebten oder bereits früh Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen gemacht hätten, brächten meist ein tiefes Misstrauen mit. Hinzu komme die Situation von Migrant*innen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus: Für sie sei der Gang zur Polizei oft undenkbar, aus Angst, aufzufliegen und abgeschoben zu werden. „Institutionelles Misstrauen entsteht selten durch ein einzelnes Ereignis“, fasst Ravenel zusammen. „Es ist das Zusammenspiel vieler kleiner Erfahrungen, die Betroffene dazu bringen, Hilfe nicht mehr in Anspruch zu nehmen.“ Wenn dann noch eine Biografie hinzu kommt, in der erlebte Gewalt bereits als Norm wahrgenommen wird – was bei Menschen auf der Straße häufiger der Fall sei als bei Menschen, die in Privaträumen arbeiten – dann wird es zunehmend schwer, sich überhaupt ein Leben ohne solche Gewalt vorzustellen – und demzufolge auch etwas dagegen zu unternehmen.
Man muss hier jedoch aufpassen, nicht in stigmatisierende Stereotypisierungen zurückzufallen. Nicht alle Sexarbeiter*innen haben schon in frühen Jahren Gewalt erlebt. Es handelt sich hier um einen Teil von besonders marginalisierten, sozial und ökonomisch benachteiligten Sexarbeiter*innen, deren Erfahrungen sich stark von denen anderer unterscheiden, wie der Fall von Nicole Schulze und insbesondere der von Miro zeigen.
Das dropIn des Roten Kreuzes
Das dropIn des Luxemburger Roten Kreuzes liegt nahe des Luxemburger Bahnhofs und bietet seit 1998 eine umfassende medizinische, soziale, psychologische und materielle Unterstützung für Sexarbeiter*innen. Vor Ort kümmert sich ein multidisziplinäres, sechs-köpfiges Team aus Pflegekräften, Sozialarbeiter*innen, psychosozialen Fachkräften und Berater*innen um Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind. Dabei reicht das Angebot von festen Terminen über offene Sprechstunden bis hin zu basalen Diensten wie Duschen, Kleiderwaschen oder der Bereitstellung von Präventionsmaterialien wie Kondomen und Gleitmittel. Ziel ist es, nicht nur akute Unterstützung zu bieten, sondern eine langfristige, vertrauensvolle Beziehung zu den Klient*innen aufzubauen.
Ashanti Berrend betont, dass Vertrauen die Grundlage ihrer Arbeit bildet. Sexarbeiter*innen würden oft erst einmal kleinere Dienste in Anspruch nehmen, wie das Abholen von Kondomen oder einen schnellen Kaffee, bevor sie umfangreichere Unterstützung akzeptierten. Die direkte Kontaktaufnahme erfolgt auch durch Streetwork-Programme, die es ermöglichen, Sexarbeiter*innen in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld zu erreichen und somit wichtige persönliche Beziehungen aufzubauen.
Ein zentraler Aspekt in der Arbeit des dropIn ist die bewusste Wahl des Begriffs „Sexarbeit“ anstelle von „Prostitution“. Laut Claire Marchal spiegelt der Begriff „Sexarbeit“ die Realität besser wider und repräsentiert die Autonomie und Vielfalt der betroffenen Personen. Der Begriff ist inklusiver, weniger stigmatisierend und respektiert verschiedene Geschlechtsidentitäten und Lebenswege.
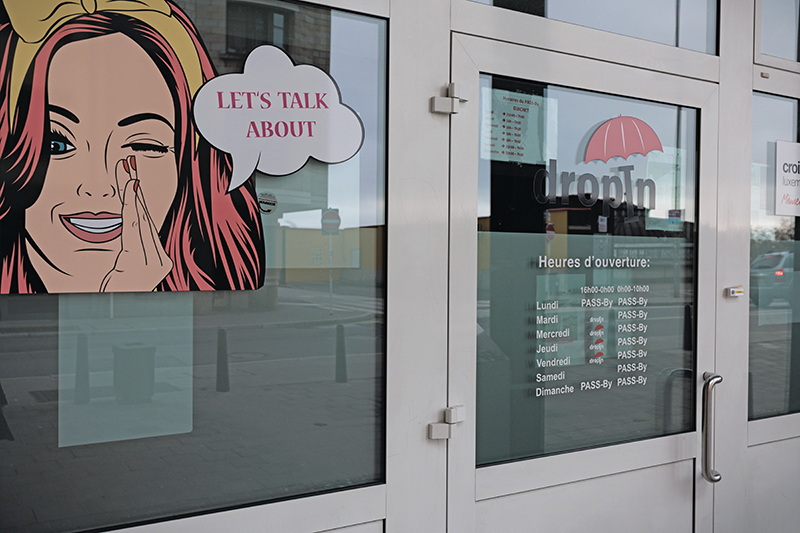
Die Klient*innen des dropIn sind überwiegend Menschen, die auf der Straße oder in Privatwohnungen arbeiten und manchmal auch mit Suchterkrankungen zu kämpfen haben. Sie sind besonders vulnerabel und benötigen grundlegende Unterstützung wie Essen, medizinische Versorgung und einen sicheren Aufenthaltsort. Viele Klient*innen stammen aus osteuropäischen, lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern und befinden sich aus wirtschaftlichen Gründen oder familiärer Verpflichtungen in der Sexarbeit.
Die Vielfalt der gesetzlichen Rahmenbedingungen in den umliegenden Ländern beeinflusst direkt die Arbeit und Lebenswege der Sexarbeiter*innen in Luxemburg. Marchal berichtet, dass viele Menschen aus Osteuropa oder von außerhalb Europas Luxemburg als ein Land der Möglichkeiten wahrnehmen, dann jedoch oft von der Realität enttäuscht werden. Das dropIn versucht, diesen Menschen realistische Perspektiven aufzuzeigen und sie unabhängig von ihrem rechtlichen Status zu unterstützen.
Die zunehmende Digitalisierung der Sexarbeit stellt das dropIn-Team vor neue Probleme, etwa die effektive Präsenz auf Online-Anzeigenportalen und gezielte Unterstützung der Sexarbeiter*innen in diesem Kontext. Die Digitalisierung wird hier nicht nur als Herausforderung gesehen, sondern auch als notwendiger Handlungsraum, in dem neue Projekte strukturiert begleitet und soziale Hilfsangebote weiterentwickelt werden müssen.
Berrend weist darauf hin, dass das Thema Gewalt gegenüber Sexarbeiter*innen weiterhin präsent und aktuell sogar zunehmend problematisch ist. Die verbleibenden Kund*innen – insbesondere viele junge Männer – würden sich oft aggressiver verhalten und Preise drücken. Manchmal kommt es zu physischen Übergriffen. Marchal und Ravenel ergänzen, dass es innerhalb der Sexarbeiter*innen-Gemeinschaft trotz Konkurrenz zunehmend Solidarität gibt, insbesondere wenn es um den Schutz vor Gewalt geht. So berichten Frauen in Wohnungen, dass sie sich zusammenschließen, um sichere Orte zu schaffen, an denen mehrere Personen Kund*innen empfangen können. In lateinamerikanischen Communities gibt es sogar WhatsApp-Gruppen und spezielle Apps, in denen gefährliche Kund*innen gemeldet werden – Telefonnummern erscheinen dort grün oder rot, je nachdem, ob sie als sicher oder riskant eingestuft werden. Auch auf der Straße tauschen Sexarbeiter*innen Informationen aus, etwa indem sie Kolleg*innen warnen, wenn eine Person auffällig oder aggressiv wirkt.
Der Wunsch, die Sexarbeit zu verlassen, wird laut dropIn-Team selten geäußert. Obwohl es in Luxemburg ein offizielles Ausstiegsprogramm mit teils staatlich finanzierten Wohnungen gibt, kommen, wie wir im Kapitel über die Geschichte der Sexarbeit gesehen haben, nur wenige Anfragen hierfür. Eine Wohnung allein sei nicht ausreichend, um den komplexen Prozess des Ausstiegs aus der Sexarbeit nachhaltig zu gestalten. Vielmehr sei eine umfassende emotionale, psychologische und soziale Begleitung notwendig.
Ein weiterer wichtiger Bereich der dropIn-Arbeit ist die Prävention im Bereich sexuell übertragbarer Infektionen (STIs), insbesondere die HIV-Prävention mittels PrEP30. Besonders bei männlichen Sexarbeitern sei das Interesse an PrEP hoch, doch derzeit sei die Verschreibung nur im Centre hospitalier de Luxembourg möglich. Hier sieht Berrend klaren Handlungsbedarf, um das Angebot auszuweiten und den Zugang für Sexarbeiter*innen zu erleichtern. Ravenel betont, dass Tests auf STIs der am häufigsten beanspruchte Gesundheitsdienst sei – dicht gefolgt von Verhütung. An dritter Stelle stehen gynäkologische Untersuchungen.
Doch die Erfahrungen im Umgang mit dem Gesundheitssystem sind sehr unterschiedlich. Manche Klient*innen berichten von guter und unkomplizierter Versorgung, etwa im Fall einer Straßensexarbeiterin, die nach einem Risikokontakt sofort Zugang zur HIV-PEP31 erhielt. Andere hingegen fühlen sich von Ärzt*innen nicht ernst genommen oder erhalten nur unvollständige Behandlungen, was das bereits vorhandene Misstrauen gegenüber Institutionen verstärkt.
Das dropIn-Team hält sich hinsichtlich politischer Positionierungen, etwa zum Nordischen Modell, bewusst zurück. Die Kommunikationsbeauftragte Caroline Fréchard betont, dass ihre primäre Aufgabe die direkte Unterstützung von Menschen in Not sei, nicht politische Analyse oder Aktivismus. Dennoch informiert das Team Sexarbeiter*innen umfassend über verschiedene Gesetzesmodelle und deren Auswirkungen, um deren Autonomie und Entscheidungsfähigkeit zu stärken.
Abschließend ist festzuhalten, dass das dropIn des Luxemburger Roten Kreuzes einen essenziellen Beitrag zur Unterstützung und zum Schutz von Sexarbeiter*innen leistet. Durch eine pragmatische, nicht wertende und menschenzentrierte Arbeitsweise bietet es den Menschen wertvolle Unterstützung, informiert über Rechte und Möglichkeiten und stellt somit eine wichtige Ressource in der komplexen Realität der Sexarbeit in Luxemburg dar.
Wohin soll es gehen?
Am Ende dieser intensiven Recherche, die mich durch komplexe Gespräche, widersprüchliche Meinungen und vielseitige Realitäten geführt hat, ist eine Erkenntnis besonders klar: Politik rund um Sexarbeit kann nicht isoliert betrachtet werden. Sie ist eingebettet in soziale, migrationspolitische und gesellschaftliche Strukturen. Das bedeutet, dass Lösungen, die vermeintlich ausschließlich auf Sexarbeit abzielen, scheitern müssen, solange sie nicht gleichzeitig auch diese größeren Zusammenhänge berücksichtigen.
Die Trierer Sexarbeiterin Nicole Schulze brachte es deutlich auf den Punkt, als sie forderte, dass Luxemburg Sexarbeitende direkt in die politische Entscheidungsfindung einbinden müsse. „Ich würde mir wünschen, dass dieses kleine, wunderbare Land sich mit uns an einen Tisch setzt und anfängt mit uns zu reden“, betont sie. „Damit wir gemeinsam die Situation besprechen und für alle ändern können. Es gibt viele Bereiche in der Sexarbeit. Luxemburg sollte alle sehen und hören.“ Diese Aussage ist keine bloße Forderung, sondern Ausdruck einer grundlegenden demokratischen Praxis: Entscheidungen, die Menschen direkt betreffen, sollten niemals ohne deren Beteiligung getroffen werden. Nothing about us without us ist nicht nur eine Parole, sondern ein notwendiges politisches Prinzip.

Gerade wenn man die komplexe Realität von Sexarbeiter*innen betrachtet, wird deutlich, dass insbesondere migrantische Personen häufig aufgrund fehlender legaler und fairer Alternativen in der Sexarbeit landen. Ob nun Menschen aus Osteuropa, Afrika oder Lateinamerika – sie alle teilen häufig die Erfahrung, dass restriktive Migrations- und Arbeitsmarktpolitiken sie regelrecht in die Sexarbeit drängen. Ein echter Wandel in der Sexarbeitspolitik wäre also nur dann möglich, wenn gleichzeitig eine humane und gerechte Migrationspolitik umgesetzt würde. Solange es hier keine Perspektiven gibt, bleiben viele Alternativen schlicht nicht verfügbar.
Im Laufe meiner Recherche wurde mir immer bewusster, wie leicht politische Debatten über Sexarbeit von Vorurteilen, moralischen Vorstellungen und fehlenden Einblicken in die Realität der Betroffenen bestimmt werden. Die Art und Weise, wie Sexarbeitende, etwa Nicole Schulze, in öffentlichen Diskussionen behandelt werden – herablassend, entmündigend und respektlos –, verdeutlicht, wie tief gesellschaftliche Stigmatisierung verankert ist. „So fängt man doch kein Gespräch an!“, warf Nicole Schulze der Politikerin Dorothee Bär zurecht vor. Tatsächlich beginnt ein konstruktiver Dialog nicht mit Vorwürfen oder Bevormundung, sondern mit Zuhören und der ernsthaften Bereitschaft, andere Perspektiven anzuerkennen.
In Luxemburg scheint die Diskussion um Sexarbeit aktuell an einem entscheidenden Wendepunkt zu stehen. Das hybride Modell, das hier momentan praktiziert wird – irgendwo zwischen Abolitionismus und Legalisierung –, bietet auf den ersten Blick eine pragmatische Zwischenlösung, zeigt bei genauerem Hinsehen jedoch deutliche Schwächen. Vor allem mangelt es an Klarheit und einer langfristigen, verbindlichen Perspektive, was zahlreiche Sexarbeitende in unsicheren und riskanten Arbeitsbedingungen zurücklässt. Diese Situation wird zusätzlich durch Gesetze verschärft, die zwar gut gemeint sind, in der Praxis jedoch oft genau das Gegenteil bewirken: Sie erhöhen die Gefahr und treiben Sexarbeitende weiter in die Unsichtbarkeit und Verletzlichkeit.
„Luxemburg muss seine Vision klären“, meint Lannier. „Im Moment hat man das Gefühl, dass das Land zwischen verschiedenen Rechtssystemen hin und her schwankt, ohne eine klare langfristige Strategie zu haben. Und irgendwann wird das nicht mehr tragbar sein.“
Das belgische und neuseeländische Modell der Entkriminalisierung der Sexarbeit
– mit Zugang zu umfassenden Arbeits- und Sozialrechten – könnte auch in Luxemburg als Vorbild dienen. Studien aus Neuseeland haben gezeigt, dass sich die Situation dort drastisch verbessert hat: Gewalt gegen Sexarbeiter*innen sinkt, Schutzmaßnahmen können besser durchgesetzt werden und das Vertrauen in Polizei und staatliche Behörden wächst.
Ein transparenter, von gegenseitigem Respekt und offener Kommunikation geprägter Dialog zwischen Politik, Gesellschaft und Sexarbeitenden könnte ebenfalls entscheidende Verbesserungen bewirken. Das Comité prostitution, das in Luxemburg über gesetzliche Regelungen und Maßnahmen zur Sexarbeit berät, könnte in diesem Prozess eine Schlüsselrolle spielen. Doch dafür müsste es Sexarbeitende aktiv und gleichberechtigt einbeziehen. Das Comité ist hier auch aktiv gewillt, aber es ist aufgrund des vorherrschenden Misstrauens vieler Sexarbeitenden gegenüber Behörden und staatlichen Institutionen keine leichte Aufgabe, Betroffene zu finden, die sich zudem ehrenamtlich einbringen müssen. Aber nur so könnten Entscheidungen getroffen werden, die nicht an der Realität der Betroffenen vorbei gehen, sondern tatsächlich zur Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen beitragen.
Zudem braucht es eine breitere gesellschaftliche Diskussion darüber, was eigentlich als moralisch oder unmoralisch betrachtet wird – und warum. Wie der Soziologe Wíner Ramírez Díaz betont, hängt die Debatte um Sexarbeit eng mit Vorstellungen von Sexualität zusammen, die tief in heteronormativen und patriarchalen Strukturen verankert sind. Das gängige Bild der Sexarbeit – arme, weibliche Opfer auf der einen Seite, brutale männliche Täter auf der anderen – ist nicht nur verkürzt, sondern auch politisch aufgeladen. Es schreibt die (weiße, heterosexuelle, cisgeschlechtliche) Frau als ewiges Opfer fest und ignoriert die Vielfalt an Geschlechter- und Machtverhältnissen, die in patriarchalen Gesellschaften wirken. Wie Díaz betont, existieren im Patriarchat unterschiedliche Formen von Männlichkeiten und Weiblichkeiten, die jeweils unterschiedlich privilegiert oder marginalisiert sind. Diese Komplexität wird in öffentlichen Debatten häufig ausgeblendet – ebenso wie die Realität queerer Sexarbeit: lesbische, schwule, bisexuelle und vor allem trans Sexarbeiter*innen, die überdurchschnittlich häufig in der Branche tätig sind, kommen in der dominanten Erzählung kaum vor. Die Vorstellung, Sexarbeit sei per se Unterdrückung durch „den Mann“, reproduziert stereotype Geschlechterbilder und macht jene unsichtbar, die nicht in dieses binäre Schema passen. Dabei ist gerade die Sicht mehrfach marginalisierter Sexarbeiter*innen auf die Branche essenziell, um politische Maßnahmen für alle Betroffene wirksam und gerecht zu gestalten – und nicht nur für eine kleine Gruppe vergleichsweise privilegierter Sexarbeiter*innen.
Es wird Zeit, diese Machtstrukturen sichtbar zu machen, sie kritisch zu hinterfragen und konstruktiv zu verändern. Luxemburg hat jetzt die Chance, eine fortschrittliche, inklusive und menschenwürdige Politik zur Sexarbeit zu entwickeln, die im besten Fall sogar als Vorbild für andere Länder dienen könnte. Doch dafür muss sich Luxemburg trauen, zuzuhören, alte Denkmuster abzulegen und den Menschen, um die es letztendlich geht, echte Mitsprache und Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen.
Wie beginnt man also ein Gespräch über Sexarbeit? Vielleicht genau so: Indem man zunächst einmal nichts sagt – sondern zuhört.
Interview mit der Ministerin für Gleich-stellung und Diversität Yuriko Backes
2024 sagten Sie im Rahmen des ersten Meetings des Comité prostitution: „Historically, prostitution and society’s attitude towards it is a classic topic for equality policy.“ Worin sehen Sie die Aufgabe der Gleichstellungspolitik in Bezug auf Sexarbeit in Luxemburg?
Zu dieser Aussage stehe ich nach wie vor. Zunächst einmal lohnt sich ein geschichtlicher Rückblick. Es war die erste Frauenministerin Marie-Josée Jacobs, die sich der Frage annahm, wie wir als Gesellschaft und als Politik mit dem Thema Prostitution umgehen sollen. Die Schaffung des dropIn im Bahnhofsviertel der Stadt Luxemburg 1998 war damals ein wichtiges Statement als erste Anlaufstelle für Sexarbeitende in Luxemburg, unter erheblichem Widerstand einiger Organisationen. Dieser Widerstand hat sich mittlerweile gelegt, denn das dropIn wird im sozialpolitischen Gefüge Luxemburgs nicht mehr in Frage gestellt.
Seitdem liegt das Thema in der Kompetenz des Gleichstellungsministeriums, obwohl noch andere Ministerien in Teilbereichen Verantwortung tragen. Das Gleichstellungsministerium ist konkret zuständig für die Betreuung der Sexarbeiter*innen auf dem Straßenstrich in Zusammenarbeit mit dem dropIn. Darüber hinaus koordinieren wir in einem übergeordneten Sinne die Politik zu diesem Thema. Die Aufgabe unserer Gleichstellungspolitik in Bezug auf Sexarbeit ist die eines sachlichen, wertfreien Blicks auf diese gesellschaftliche Realität, von der ‒ wie wir alle wissen – mehrheitlich Frauen betroffen sind.
Inwieweit ist Sexarbeitspolitik heute Teil der Gender-Equality-Strategie Ihres Ministeriums?
Die Regierung hat im ersten Halbjahr 2025 drei nationale Aktionspläne verabschiedet. Der erste bezieht sich auf die Gleichstellung von Frauen und Männern, der zweite auf die Bekämpfung geschlechtsbasierter Gewalt und der dritte bezieht sich auf die Stärkung der Rechte von LGBTIQ+ Personen. Die drei Pläne sind als Ganzes zu betrachten und stellen die Grundlage unserer gleichstellungspolitischen Akzente dieser Legislaturperiode dar. Wir betrachten die Pläne in einer Kontinuität als offene Dokumente, deren Haltbarbarkeit über 2028 hinausgeht.
Besonders in Bezug auf die Pläne zur Gewalt bzw. zu LGBTIQ+ sehen wir Schnittstellen zur Sexarbeitspolitik. Sexuelle Aufklärung und Prävention, Stärkung des bestehenden psychosozialen Netzwerks, die institutionelle Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ministerien und Fachkomitees (Comité Prostitution, Comité Traite, Comité Violences fondées sur le genre, Comité LGBTIQ+) … das sind alles Punkte, die ein Ganzes ergeben, mit welchen das Ministerium auch das Thema Sexarbeit abdeckt.
Luxemburg hat seit 2018 ein neues Gesetz, das den Verkauf von Sex legalisiert, aber den Kauf von Sex bei besonders vulnerablen Personen kriminalisiert. Es gilt als ein Mittelweg zwischen dem Nordischen Modell in Frankreich, der Regulierung in Deutschland und der Entkriminalisierung in Belgien. Wie beurteilen Sie die tatsächliche Wirkung des luxemburgischen Gesetzes? Wird die Schutzabsicht erfüllt oder führt es zu mehr Unsichtbarkeit und Risiko?
Ich wünsche mir eine tabufreie und entspannte Debatte zu diesem Thema, die alle Fragen rechtlicher und gesellschafts-politischer Natur erörtert, und gegebenenfalls in ein Modell resultiert, in dem sich in erster Linie die Betroffenen wiederfinden.
Bei meinem Amtsantritt habe ich mir den Weg hin zum aktuellen luxemburgischen Modell genau angesehen. Es war das erste Mal, dass sich die hiesige Politik umfassend mit dem Thema auseinandergesetzt hatte, auch öffentlich im Rahmen von Pressekonferenzen und Parlamentsdebatten. Die damalige Regierung hatte mit Hilfe einer informellen Plattform Prostitution, zusammengesetzt aus Vertreter*innen verschiedener Ministerien, der Polizei, den Justizbehörden, dem dropIn und der HIV-Berodung sowie der Sozialdirektion der Stadt Luxemburg, und mittels einer Konsultationsdebatte im Parlament die Entscheidung getroffen, erstens einen nationalen Aktionsplan auszuarbeiten und zweitens ein Gesetz im Rahmen des Aktionsplans zu verabschieden, mit der Zielsetzung, den Kampf gegen den Menschenhandel zu verstärken und besonders vulnerable Gruppen zu schützen, insbesondere Minderjährige, indem man den Klienten bestraft, sollte er in Kenntnis der jeweiligen Lebenssituation der vulnerablen Person sein.
Beides wurde evaluiert im Rahmen eines Berichts der Plattform, der zu Corona-Zeiten im Dezember 2021 ausgearbeitet wurde. Die Bilanz ist eher gemischt. Zum einen wurden im Rahmen des Nationalen Aktionsplans wichtige Projekte wie die EXIT-Strategie ausgearbeitet, das Streetwork erweitert und Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen umgesetzt.
Andererseits wurde in Bezug auf das 2018er Gesetz festgestellt, dass ein Straftatbestand geschaffen wurde, der in der Praxis nicht angewandt wird. Es bestätigte sich demnach die anfängliche Skepsis der Staatsanwaltschaft sowie des Staatsrats im Hinblick auf die Durchführbarkeit der Beweisführung, ob es sich bei einer Person, die Sexarbeit verrichtet, um eine vulnerable Person handelt. Auch in Bezug auf die vorgesehene Straffreiheit für den Kunden, wenn er als Zeuge auftritt, bestätigten sich die Bedenken der Gerichtsbarkeiten, da ein potenziell Angeklagter in der Regel frei nach dem Rechtsgrundsatz Nemo tenetur se ipsum accusare keine Aussagen trifft, die ihn belasten.
Welche Schritte unternimmt Ihr Ministerium, um sicherzustellen, dass Sexarbeitspolitik die Lebensrealitäten marginalisierter Gruppen (z. B. Migrant*innen, trans Personen, Geflüchtete) gezielt einbezieht?
Generell versucht das Ministerium, dem Konzept der Intersektionalität verstärkt Rechnung zu tragen. In Bezug auf Sexarbeit ist es ja beispielsweise schon so, dass das dropIn, welches integral vom Gleichstellungsministerium finanziert wird, überwiegend Sexarbeitende betreut, die durchaus der Lebensrealität marginalisierter Gruppen entsprechen. Aber natürlich muss die Regierung sich bei weiteren politischen Maßnahmen ‒ zum Beispiel einer Neuauflage des Nationalen Aktionsplans ‒ auf eine Bestandsaufnahme stützen, die die Diversität von Personen in der Sexarbeit anerkennt und integriert.
Viele Gesetze zu Sexarbeit entstehen ohne direkte Mitsprache von Sexarbeitenden. Auch am Comité Prostitution wird kritisiert, dass dort keine Sexarbeitenden vertreten sind. Würden Sie hier entsprechende Änderungen unterstützen?
Ganz klar, ja … aber das ist leichter gedacht als getan. In einem Land, wo jeder jeden kennt, ist der Wunsch nach Anonymität nur allzu verständlich. Es gibt in Luxemburg keine Organisation, die die Interessen der Sexarbeit vertritt. Hinzu kommt die Tatsache, dass Sexarbeit als berufliche Aktivität nicht anerkannt ist, was eine gewerkschaftliche Mitgliedschaft unmöglich macht. In anderen Ländern wie Deutschland oder Frankreich, wo es solche Organisationen gibt und vereinzelt Sexarbeitende auch in Gewerkschaften aktiv sind, ist das anders.
Das Comité Prostitution hat zusammen mit dem dropIn diese Herausforderung erörtert und nach Wegen gesucht, wie man den Austausch mit den Betroffenen auf eine Art und Weise organisieren kann, die die Anonymität wahrt.
Welche kurzfristigen und langfristigen Prioritäten und Ziele verfolgen Sie im Bereich der Sexarbeit?
Im Koalitionsvertrag 2023-2028 steht nichts, was an politischen Prioritäten und Zielen in Bezug auf Sexarbeit zu erfüllen ist. Das heißt allerdings nicht, dass das Ministerium inaktiv ist. Wir werden uns deshalb die Empfehlungen des Comité Prostitution genau ansehen, insbesondere die Idee, eine Studie in Auftrag zu geben, die die Sexarbeit in Luxemburg ganzheitlich beleuchtet.
Manche Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, Luxemburg verfolge mit seiner aktuellen Gesetzgebung in der Sexarbeitspolitik „keine klare Vision“. Teilen Sie diese Einschätzung?
In Teilen kann ich das nachvollziehen, in Teilen aber auch nicht, weil ich mich mit dem Begriff „Vision“ in Bezug auf Sexarbeit schwertue. Sexarbeit ist und bleibt ein sehr komplexes und vor allem ein sehr sensibles Thema, dem ich mich mit dem nötigen Wissen und Fingerspitzengefühl widmen möchte, ohne den Versuch zu unternehmen, Schnellschüsse in Richtung hochtrabender Versprechungen und Visionen zu unternehmen.
Wo möchten Sie idealerweise am Ende Ihrer Arbeit als Ministerin stehen, was die Lebenssituation, Rechte und Sichtbarkeit von Sexarbeitenden betrifft?
Ich wünsche mir eine tabufreie und entspannte Debatte zu diesem Thema, die alle Fragen rechtlicher und gesellschaftspolitischer Natur erörtert, und gegebenenfalls in ein Modell resultiert, in dem sich in erster Linie die Betroffenen wiederfinden. Vielleicht gelingt uns das noch in dieser Legislaturperiode, vielleicht bedarf es aber auch etwas länger aufgrund der gebotenen Gründlichkeit.
14. Oktober 2025

Jeff Mannes ist Soziologe, Sexualpädagoge und freischaffender Autor. Vor elf Jahren zog er von Luxemburg nach Berlin, wo er heute für die schwule Präventionskampagne ICH WEISS WAS ICH TU (IWWIT) der Deutschen Aidshilfe arbeitet. 2018 machte er sich zudem als Stadtführer selbstständig. Mit BerlinGuide.de bietet er multimediale Touren an, die sich mit der sexuellen und queeren Geschichte der Stadt, der Nazizeit, der kinky Szene und der Clubkultur beschäftigen. Jeff Mannes schreibt regelmäßig für Berlins meistgelesenes Stadtmagazin SIEGESSÄULE, wo er in seiner Kolumne „Sex-Positionen“ über Sexualität, Körperpolitik und queeres Leben reflektiert.
1 Siehe https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/amnesty-international-publishes-policy-and-research-on-protection-of-sex-workers-rights/ (letzter Aufruf: 29. Oktober 2025)
2 Siehe World Health Organization: Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations, 1. Juli 2014. https://www.who.int/publications/i/item/9789241507431 (letzter Aufruf: 29. Oktober 2025)
3 BDSM bezeichnet ein breites Spektrum einvernehmlicher sexueller Praktiken und Beziehungsformen, die von Bondage & Discipline (Fesselung & Disziplin) über Dominance & Submission (Dominanz & Unterwerfung) bis hin zu Sadism & Masochism (Sadismus & Masochismus) reichen.
4 Post-Pornografie ist eine Form der Sexualdarstellung, die künstlerisch, kritisch und subversiv arbeitet – und dabei versucht, neue, vielfältige und selbstbestimmte Bilder von Sexualität sichtbar zu machen. Sie entstand in den 1980er-Jahren – u. a. im Umfeld feministischer und queerer Bewegungen – als Reaktion auf die Kritik, dass traditionelle Pornografie meist heteronormative, sexistische und stereotype Körper- und Geschlechterbilder reproduziert. Siehe beispielsweise sexschoolhub.com oder der pornografische Film UEFU (U Equals Fucking U), der über den Schutz vor einer HIV-Übertragung durch erfolgreiche medikamentöse Therapie aufklärt: https://www.hivplusmag.com/love-sex/2021/3/26/new-kind-gay-porn-hardcore-sex-message
5 Der Begriff „trans“ (auch transgeschlechtlich oder transgender; veraltet: transsexuell) bezieht sich auf einen Teil der geschlechtlichen Identität eines Menschen. Trans Menschen haben ein Geschlecht, das nicht dem entspricht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.
6 Intersektionalität beschreibt ein Analyse-Modell, das untersucht, wie verschiedene Formen von Diskriminierung und Unterdrückung – wie Rassismus, Sexismus, Klassismus, Queer- oder Behindertenfeindlichkeit – nicht isoliert, sondern miteinander verflochten wirken und sich gegenseitig verstärken können. Der Begriff wurde Ende der 1980er Jahre von der US-amerikanischen Juristin Kimberlé Crenshaw geprägt. Sie verwendete die Metapher einer Straßenkreuzung (intersection), um zu veranschaulichen, wie verschiedene Diskriminierungsformen gleichzeitig auf eine Person einwirken können – ähnlich wie ein Unfall an einer Kreuzung durch Verkehr aus mehreren Richtungen verursacht werden kann. Crenshaw untersuchte damals u. a. den Fall DeGraffenreid v. General Motors. Fünf Schwarze Frauen verklagten General Motors, nachdem diese fast alle Schwarzen Frauen entlassen hatte. Das Gericht wies die Klage jedoch ab. Es stellte fest, dass General Motors Schwarze Männer und weiße Frauen beschäftigte und daher keine rassistische oder sexistische Diskriminierung vorliegen könne. Es betrachtete Rassismus und Sexismus also als voneinander getrennt. Intersektionalität betont jedoch, dass Diskriminierung nicht einfach additiv ist, sondern durch das Zusammenwirken verschiedener sozialer Kategorien wie Geschlecht, „Rasse“/Ethnizität, Klasse, sexuelle Orientierung, Behinderung oder Alter komplexe und spezifische Erfahrungen von Benachteiligung entstehen. Diese Perspektive ermöglicht ein tieferes Verständnis dafür, wie soziale Ungleichheiten strukturell verankert sind und sich in den Lebensrealitäten von Menschen manifestieren.
7 Angela Jones benutzt im Englischen die geschlechtsneutralen Pronomen „they/them“. Im Deutschen gibt es entsprechende Neopronomen, wie bspw. „dey/deren“. Da sich diese allerdings noch nicht wirklich etabliert haben, werden in diesem Artikel auf Personalpronomen in Bezug auf Angela Jones verzichtet und stattdessen der Name benutzt.
8 Vom Autor übersetzt. Bernadette Barton und Breanne Fahs, „Were the Feminist Sex Wars Inevitable? – Smashing the Binary“, in: Bernadette Barton, Barbara G. Brents und Angela Jones, Sex Work Today – Erotic Labor in the Twenty-First Century, New York University Press, 2024, S. 314.
9 Der Begriff „White Saviorism“ (dt. „weißes Retter*innen-Syndrom“) ist eine kritische Beschreibung eines Systems, in dem weiße Personen als paternalistische Befreier*innen, Retter*innen oder Förderer*innen von BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color), insbesondere aus dem Globalen Süden auftreten. Oft geschieht dies mit der Annahme, dass BIPOC aus dem Globalen Süden ohne die Hilfe weißer Menschen nicht in der Lage wären, ihre eigenen Probleme zu lösen. Dieses Verhalten basiert auf einer Haltung der weißen Überlegenheit und führt häufig dazu, dass die tatsächlichen Bedürfnisse und Stimmen der betroffenen Communitys ignoriert oder übergangen werden. Im Kontext der Sexarbeit bezeichnet „White Saviorism“ das Phänomen, dass meist weiße Aktivist*innen oder Organisationen versuchen, Sexarbeiter*innen, insbesondere aus marginalisierten Gruppen, zu „retten“, ohne deren eigenen Stimmen, Erfahrungen und Bedürfnisse angemessen zu berücksichtigen.
10 Josée Hansen, „Mir wëlle méi“, in: d’Lëtzebuerger Land, 23. März 2018. https://www.land.lu/page/article/997/333997/FRE/index.html
11 Vgl. Heike Mauer, Intersektionalität und Gouvernementalität. Die Regierung von Prostitution in Luxemburg, Opladen, Verlag Barbara Budrich, 2018, S. 159ff.
12 TNS ILRES & Ministère de l’égalité des chances, Etude sur la prostitution au Luxembourg avril-mai 2012, 18. Juni 2012. https://statistiques.public.lu/en/actualites/conditions-sociales/conditions-vie/2012/06/20120521.html (letzter Aufruf: 29. Oktober 2025)
13 Vgl. Krüsi et al., Criminalisation of clients: reproducing vulnerabilities for violence and poor health among street-based sex workers in Canada-a qualitative study, 2014. https://bmjopen.bmj.com/content/4/6/e005191 (letzter Aufruf: 29. Oktober 2025)
14 Auch das nordirische Justizministerium kommt 2019 in einer Untersuchung zum Schluss, dass es keine Belege dafür gebe, dass das Nordische Modell, das in Nordirland 2015 eingeführt wurde, zu einer Abnahme des Angebots oder der Nachfrage sexueller Dienstleistungen geführt habe. Vgl. Department of Justice Northern Ireland, Assessment of Review of Operation of Article 64A of the Sexual Offences Order (Northern Ireland) 2008: Offence of Purchasing Sexual Services, 2019.
15 STI steht für (eng.:) Sexually Transmitted Infections, also für sexuell übertragbare Infektionen. Zu STIs gehören zum Beispiel HIV, Syphilis, Gonorrhoe oder Chlamydien. Der Begriff STI wird manchmal den Begriffen STD (Sexually Transmitted Diseases) und Geschlechtskrankheiten vorgezogen, um deutlich zu machen, dass nicht jede Infektion auch zwangsläufig (sofort) zu einer Erkrankung mit Symptomen führen muss.
16 Vgl. https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/evaluation-des-gesetzes-zur-regulierung-des-prostitutionsgewerbes-sowie-zum-schutz-von-in-der-prostitution-taetigen-personen-prostituiertenschutzgesetz-prostschg–266228
17 Vgl. https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2025/06/24/pressemitteilung-evaluation-prostschg/
18 Cis (auch cisgeschlechtlich oder cisgender) bezieht sich auf einen Teil der geschlechtlichen Identität eines Menschen. Im Gegensatz zu trans Menschen ist das Geschlecht von cis Menschen übereinstimmend mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.
19 https://www.lessentiel.lu/de/story/sexarbeiterinnen-bieten-wieder-ihre-dienste-an-589842902919
20 Ein Akronym für Black, Indigenous, and People of Color, also Schwarze, indigene und sonstige Menschen nicht-weißer Hautfarbe.
21 Die 5 146 Besuche beziehen sich nicht auf einzelne Menschen, sondern auf Besuchsdaten. Manche Menschen gingen vermutlich mehrmals im Jahr 2023 ins dropIn. Zudem sind die Zahlen nicht repräsentativ für die Gesamtzahl an Sexarbeitenden und deren Verteilung unter den Geschlechtern in Luxemburg.
22 Vgl. Croix-Rouge Luxembourgeoise (2024): La Croix-Rouge en Chiffres 2023.
23 Vgl. transrespect.org/research
24 Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Rechtsgutachten zur Freiwilligkeit in der Prostitution, 2025, S. 89. https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/266222/ea8784deb9facce667614f8da1fea49f/evaluation-prostschg-gutachten-freiwilligkeit-in-der-prostitution-data.pdf
25 idem
26 https://www.youtube.com/watch?v=-4wKB3J8Tf0
27 Vgl. Erving Goffman, Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität, Berlin, Suhrkamp Verlag, 2012.
28 https://journal.lu/de/luxemburg-und-die-sexarbeit
29 Begriff geprägt durch den französischen Sozialwissenschaftler Michel Foucault. Biomacht beschreibt eine Form der Macht, die sich nicht mehr primär durch direkte Unterdrückung oder Gewalt äußert, sondern durch die Regulierung und Kontrolle des Lebens und der Körper selbst. Diese Art der Macht zielt darauf ab, Bevölkerungen zu überwachen, zu steuern und zu optimieren, indem sie biologische und soziale Prozesse wie Geburtenraten, Mortalität, Gesundheit und Sexualität beeinflusst.
30 PrEP steht für Prä-Expositions-Prophylaxe und bezeichnet eine vorbeugende Maßnahme, bei der Menschen ohne HIV antiretrovirale Medikamente einnehmen, um eine Ansteckung mit dem HI-Virus zu verhindern. Richtig angewendet schützt die PrEP mindestens genauso gut wie Kondome vor einer HIV-Infektion.
31 PEP steht für Post-Expositions-Prophylaxe und bezeichnet eine kurzfristige medizinische Behandlung mit antiretroviralen Medikamenten, die nach einem möglichen HIV-Risikokontakt eingenommen werden, um eine Infektion zu verhindern.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
