- Armut, Gesellschaft, Politik
Das Märchen vom reichen Luxemburg
Einführung ins Dossier
Armut frisst sich durch alle Lebensbereiche derjenigen, die von ihr betroffen sind. Sie schreibt sich nicht nur in Psychen, sondern auch in Körper ein. Sie schränkt das soziale und das kulturelle Leben ein, erschwert die Bildung und belastet die Gesundheit. Natürlich ist Armut nicht gleich Armut. Aber selbst da, wo die Hose nicht kaputt, das Gebiss in Ordnung und das Mittagessen halbwegs ausgewogen ist, also da, wo wir nicht von extremer Armut sprechen, erschwert ein Mangel an Geld das Leben in vielfältiger Art und Weise. Nicht selten befinden sich die Betroffenen in einem Kreislauf, aus dem es nur schwer ein Entkommen gibt.
Was Luxemburg angeht, kommt erschwerend hinzu, dass unser Land in der Außenwahrnehmung nicht gerade dafür bekannt ist, dass es seiner Bevölkerung finanziell besonders schlecht geht. Da hat das Nation Branding ganze Arbeit geleistet. Die Nebenwirkung: Menschen sind hier beinahe unsichtbar, wenn sie entgegen der Erzählung über das reiche Finanzzentrum doch von Armut betroffen sind. Und dadurch werden sie umso vulnerabler: Sie riskieren die weitere Prekarisierung ihrer Lebenssituation, können weniger am öffentlichen Leben teilnehmen und finden sich immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt.
Irgendwie schweigt man bei uns ganz besonders gern, wenn es um Armut geht. Irgendwie ist das Märchen, dass wer will, auch kann, hier besonders wirksam. Und gerade deswegen ist das Dossier in diesem Monat keines zur globalen Armut, sondern konzentriert sich auf Luxemburg. Dies scheint uns im Superwahljahr von besonderer Bedeutung zu sein, denn im Wahlkampf bestünde durchaus die Möglichkeit, Antworten auf die unzähligen und in diesem Dossier versammelten Problemlagen zu geben. Dabei haben wir sowohl unterschiedliche Expert*innen aus der Sozialwissenschaft und der Praxis der Sozialarbeit als auch Betroffene zu Wort kommen lassen.
Sozialarbeit und Armut
Über gute Sozialarbeit als wichtiges Instrument im Kampf gegen Armut berichtet Ginette Jones, Präsidentin der Entente des offices sociaux asbl, in ihrem grundlegenden Beitrag. Die Autorin verdeutlicht, welche sozialstaatlichen Absicherungen es gibt, zeigt aber auch die Schwachstellen im System auf; etwa bei bürokratischen Reflexen auf komplexe Situationen armer Menschen. Sie skizziert außerdem Perspektiven, wie sich gute Sozialarbeit in der Zukunft weiter entwickeln müsste, um noch wirksamer gegen Armut eingesetzt werden zu können.
Robert Urbé, jahrzehntelanger Koordinator der Caritas Luxemburg und Herausgeber des legendären Sozialalmanach, geht in einem weiteren Grundlagentext der Frage nach, wie Armut eigentlich definiert wird. Er veranschaulicht, wie das Armutsrisiko berechnet wird, wie aussagekräftig der Armutsrisikoindikator ist und was er über die Lebensrealität armer Menschen aussagt. Ein Ergebnis: Ausländer*innen unterliegen in Luxemburg einem höheren Armutsrisiko als Luxemburger*innen, Mieter*innen einem höheren als Hausbesitzer*innen, Kinder einem höheren als Erwachsene. Darüber hinaus stellt Urbé den „Indikator für das Armutsrisiko oder die soziale Exklusion“ vor, ein in der EU ermittelter Indikator, bei dem Luxemburg im vergangenen Jahr auf dem wenig schmeichelhaften 18. Platz landete.
Armut, Klasse und Gesundheit
Doch wie fühlt es sich eigentlich an, in Luxemburg von Armut betroffen zu sein? Marco Welter, der über einen Aufruf bei Twitter auf die Redaktion zugekommen ist, hat anhand zahlreicher Episoden aus seiner eigenen Biografie über die Zusammenhänge zwischen Armut und der luxemburgischen Klassengesellschaft reflektiert. Auf beeindruckend ehrliche Art und Weise und dabei durchaus an den französischen Schriftsteller Edouard Louis erinnernd zeigt der Autor, wie die Klassenfrage im Laufe eines Lebens immer virulenter werden kann – sogar dann, wenn man die eigene soziale Herkunft zu überwinden versucht hat. Vielleicht gerade dann.
Carole Reckinger von der Caritas macht in ihrem Beitrag mehr als deutlich: Armut ist ein Gesundheitsrisiko, und Krankheit ist ein Armutsrisiko. Nur durch tiefgreifende gesamtgesellschaftliche Anstrengungen, so ihre These, kann dieser Teufelskreis durchbrochen werden. Von der Politik fordert sie die Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen, um dies zu erreichen. Wer sich für dieses Thema interessiert, bekommt am 24. und 25. März übrigens die Gelegenheit, es beim neu geschaffenen Caritas Forum zu vertiefen: Am ersten Tag sprechen Richard Wilkinson und Gerhard Trabert um 18.30 Uhr im Cercle Cité über Armut und Gesundheit, am Folgetag findet von 9 bis 17 Uhr ein Symposium zum Thema im Centre Jean XXIII statt. Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.caritas.lu/
caritasforum.
Wohnen, Arbeiten, Essen
Was es bedeutet – und zwar gerade für arme Menschen –, wenn mehrere Krisen sich verbinden, zeigt Marco Hoffmann, ebenfalls Caritas, in seinem Artikel über die Wohnungs- und Energiekrise. Als Mittel im Kampf gegen diese Doppelkrise empfiehlt er positive Diskriminierung (Bevorzugung marginalisierter Menschen mit dem Ziel der Herstellung von Chancengleichheit), Investitionen in energetische Gebäudesanierungen (gerade bei Gebäuden, in denen von Energiearmut betroffene Menschen leben; ohne dass die Kosten auf deren Mieten umgelegt werden) sowie Unterstützung von Hausbesitzer*innen, die sich aus eigenen Mitteln keine Sanierungen leisten können. Wenn, so die These des Autors, die richtigen politischen Schalthebel bedient werden, könnte politisches Handeln hier nicht nur die Energie- und Wohnungskrise abschwächen, sondern ganz nebenbei auch noch einen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten.
Auch Raoul Schaaf, Direktor des Centre national de défense sociale (CNDS), beginnt seinen Beitrag mit einem beherzten Plädoyer für mehr Chancengleichheit durch gezielte politische Maßnahmen, bevor er die zentralen Initiativen der CNDS präsentiert. Diese zielen darauf ab, auf der einen Seite straffällig gewordene Personen zu resozialisieren, andererseits aber auch präventiv dafür zu sorgen, Marginalisierung zu verhindern. Das Aktionsfeld der CNDS reicht dabei von der Vollekskichen, einem sozial-inklusiven Gastronomieangebot, über die Initiative CNDS Wunnen, in der es um nachhaltige Wohnlösungen für ehemals obdachlose Menschen geht, bis hin zu Nei Arbeecht, wo, ganz auf die Kreislaufwirtschaft setzend, gespendete Möbel, Elektrogeräte oder andere Gegenstände repariert und zu günstigen Preisen weiterverkauft werden. Alle Initiativen setzen sowohl darauf, Menschen in prekären Situationen beruflich zu integrieren, als auch Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die sich jeder leisten kann.
Während die Initiativen des CNDS auf Verbindung und Verständigung ausgelegt sind, war die 15. Ausgabe der REPIS-Konferenz (Rencontre participative pour l’inclusion sociale) des European Anti Poverty Network zum Thema Armut und Wohnen Ende Februar hochgradig konfrontativ. Rebecca Baden konnte für forum beobachten, wie hier zwei Welten aufeinanderprallten: Von Armut betroffene Bürger*innen thematisierten ihre Probleme und Kritikpunkte bei einem Treffen mit der Familien- und Integrationsministerin Corinne Cahen (DP) und Henri Kox (déi gréng), dem Minister für Wohnungsbau, im direkten Austausch.
Arm arbeiten, illusionslos denken, politisch handeln
Sylvain Hoffmann, Direktor der Chambre des salariés, nimmt Luxemburg als Europameister beim Thema Armut am Arbeitsplatz unter die Lupe: Die Risikoquote, zu den working poor zu gehören, liegt im Großherzogtum bei erschreckenden 13 %. Nach zahlreichen aufschlussreichen Differenzierungen in Bezug auf diese zweifelhafte Meisterschaft skizziert der Autor mögliche Lösungen: eine strukturelle Erhöhung des Mindestlohns sowie einen nationalen Aktionsplan zur Förderung von Tarifverträgen.
Petra Stober verweist in ihren knappen, aber sehr dichten Ausführungen auf die Relation zwischen Reichtum und Armut und die Relativität gefühlter wie erlebter Armut. Sie räumt mit liberalen Märchen und Coaching-Mythen auf und macht sehr deutlich, dass sowohl Armut als auch Reichtum Teil des kapitalistischen Programms sind. Angesichts einer klar auf zivile Ruhigstellung ausgerichteten Digitalisierung entlarvt sie auch die letzten schönen Bildungsversprechen als rhetorische Opiate.
In einer abschließenden Schlussfolgerung fasst Michel Pauly – nicht nur, aber vor allem – für gestresste Politiker*innen, die keine Zeit zur Lektüre eines ganzen Dossiers haben, noch einmal zusammen, welche Einsichten sich aus den Dossier-Beiträgen in diesem Monat ziehen lassen: Hier finden sich knapp formuliert die konstruktivsten Vorschläge für die Wahlprogramme – falls die Parteien die Bekämpfung von Armut wirklich ernst nehmen wollen. Und wenn sie die Brenzligkeit der Situation erkannt haben, sollten sie das alle dringend tun.
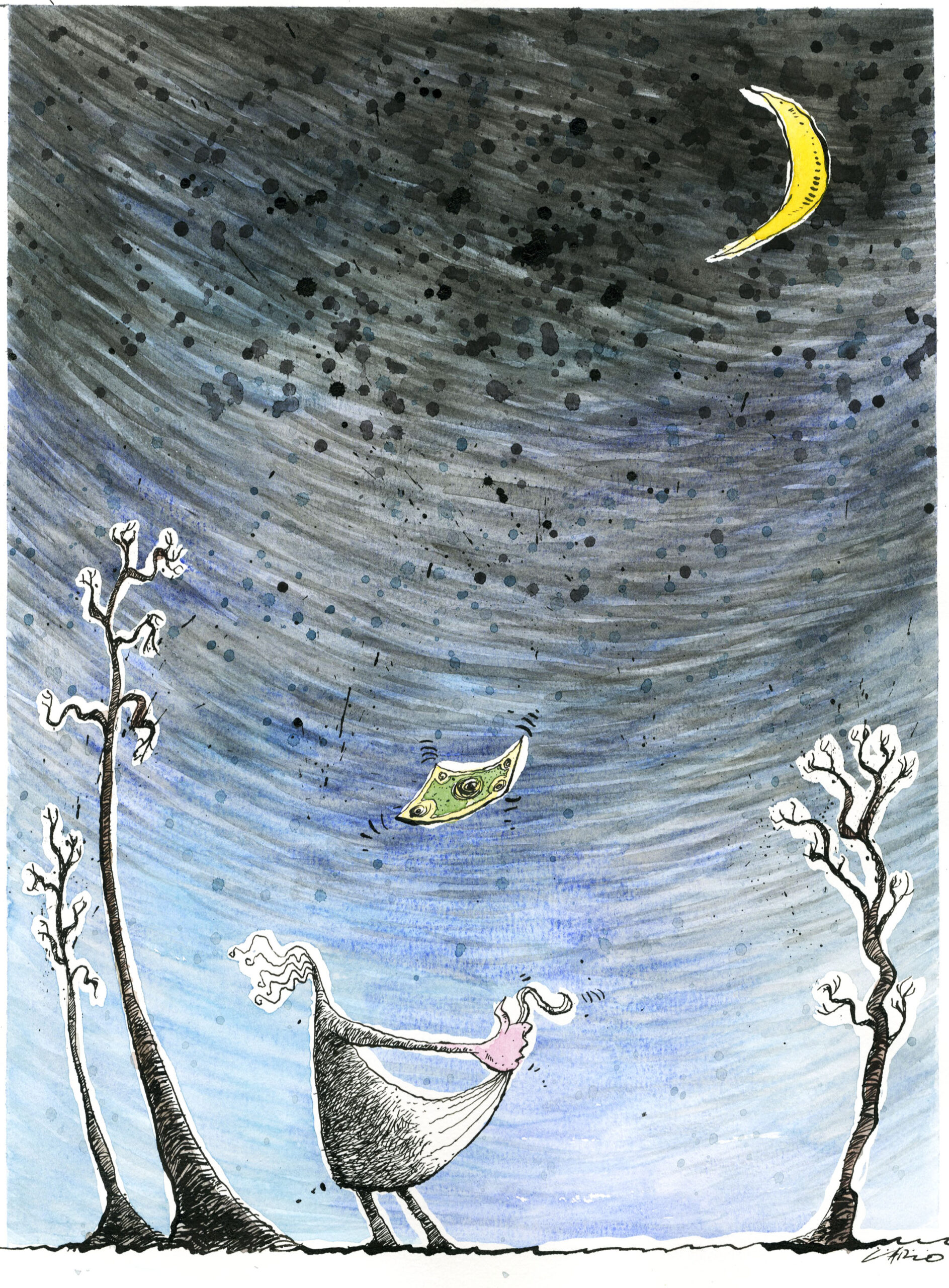
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
