- Gesundheit, Zeit
Die kostbare Zeit
Wie Menschen ihre letzten Tage verbringen
Lesezeit: 8 Minuten
Mit der Diagnose einer schwerwiegenden Erkrankung sind Menschen mit ihrem Lebensende konfrontiert. Eine Verschiebung von Werten, eine Änderung der Lebenseinstellung und eine Veränderung in der Wahrnehmung der verbleibenden Lebenszeit sind die Folge.
Zeit ist zu schnell, für den, der sich freut,
zu langsam, für den, der wartet,
zu lang, für den, der traurig ist,
zu kurz, für den, der glücklich ist.
Die Zeitwahrnehmung ist ein kognitiver Prozess, der objektiv physikalische Zeit auf subjektiv psychische Zeit abbildet. Dieser Prozess wird hauptsächlich mit psychophysiologischen Methoden untersucht, wobei Probanden Reize mit zeitlichen Eigenschaften, wie einer Ereignisreihenfolge oder einer Intervalldauer, präsentiert werden und das Verhalten, beispielsweise eine Reihenfolge-Einschätzung, sowie die Handlung, wie z. B. ein Tastendruck, erhoben werden. Die psychische, also subjektiv wahrgenommene bzw. erlebte Zeit, steht zwar in einem engen systematischen Zusammenhang mit der physikalisch gemessenen Zeit, ist aber nicht völlig synchron mit ihr. Die Zeitwahrnehmung wird in vielfacher Weise durch verschiedene situative und psychische Faktoren beeinflusst. So verändert die Art eines Ereignisses dessen wahrgenommene Dauer. Ein emotionell erregender Reiz wird als länger eingeschätzt als ein leeres Schätzintervall. Wahrgenommene Zeit kann ebenfalls durch intentionale Bindung verkürzt werden. Bei Kindern bis zum 14. Lebensjahr ist die Zeitwahrnehmung wesentlich ungenauer als bei Erwachsenen.1
Die Zeit vergeht im Fluge, ich habe nicht genug Zeit, die Zeit läuft davon, es kam mir vor wie eine Ewigkeit, die Zeit stand still.
Jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens wohl die Erfahrung gemacht haben, dass die Zeit sehr unterschiedlich schnell wahrgenommen wird, wohl wissend, dass die mit der Uhr gemessene Zeit gleich schnell vergeht.
Diagnose
Menschen, die die Diagnose einer schweren oder unheilbaren Erkrankung erhalten, erfahren unmittelbar eine Bedrohung ihres Lebens. Es kommt zur Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des eigenen Lebens sowie dem Lebensende und dem Sterben an sich. Eine schwere Erkrankung kann mit sich bringen, dass ein Bewusstsein für die Begrenzung der noch verbleibenden Lebenszeit entwickelt wird. Manchmal wird die Lebenszeit bereits überblickt, es wird von Wochen oder Tagen anstelle von Monaten oder Jahren gesprochen, und wird dadurch als besonders wertvoll und kostbar wahrgenommen. Jeder Tag, jeder Augenblick ist ein wertvoller Teil meines zu Ende gehenden Lebens.
„Solange ich noch da bin, möchte ich von meinem Leben profitieren.“
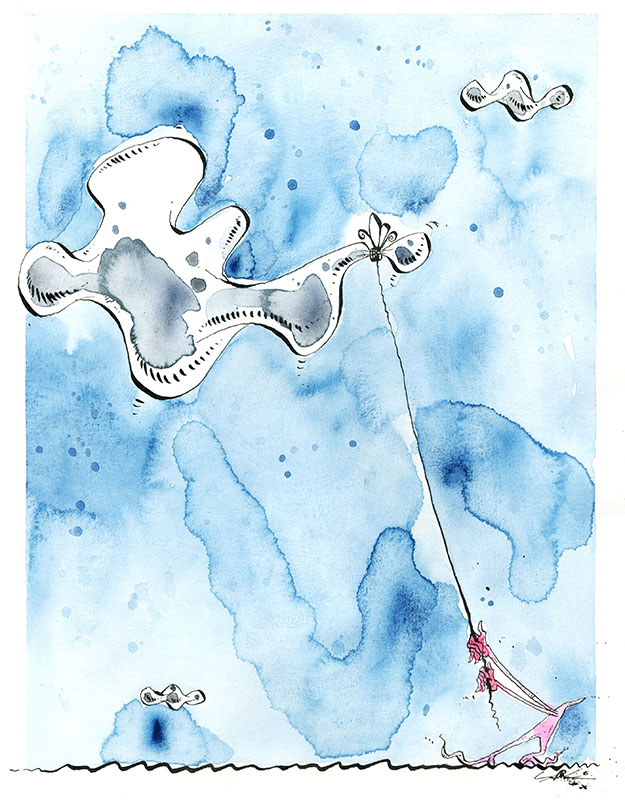
Lebenszeit
In der Lebensphase mit einer schweren und unheilbaren Erkrankung erheben sich viele Fragen über die verbleibende Zukunft. „Wieviel Zeit habe ich noch zu leben?“, „Habe ich noch genug Zeit, um meine Angelegenheiten zu regeln?“, „Wie lange werde ich wohl noch alleine gehen können?“, „Werde ich die Geburt meines Enkels noch erleben können?“, „Wer weiß, ob ich zu Weihnachten noch da bin?“. „Meine Zeit läuft bald ab.“
Die Patienten werden über die Diagnose und Prognose ihrer Erkrankung vom Arzt aufgeklärt und haben manchmal, vielleicht, ein vages Gefühl dafür, wie lange sie noch leben werden und ob ein bestimmter zukünftiger Zeitpunkt noch erlebt werden kann oder ob es schon zu spät ist.
Einem an Krebs erkrankten Mann im Terminalstadium wird der Besuch der Enkelin für den nächsten Sonntag angekündigt. Sie kommt vom Studium aus dem Ausland zu ihrem geschwächten, bettlägerigen Großvater zu Besuch. Der Patient erwidert, der Sonntag sei zu spät, denn am Sonntag würde er nicht mehr leben. Die Enkelin wird daraufhin gebeten, wenn möglich, früher zu Besuch zu kommen. Sie kann am Freitag einen schönen Tag mit ihrem Großvater verbringen, welcher am darauffolgenden Tag ruhig verstirbt.
Werte
Mit der Diagnose einer Erkrankung wird der Patient meist einer kurativen Therapie zugeführt, mit dem Ziel, die Erkrankung zu heilen oder wenigstens symptomfrei zu halten. Im Laufe der Behandlung kann sich herausstellen, dass die Erkrankung nicht mehr vollständig geheilt werden kann. In der Folge kommt es zum Übergang von der kurativen zur palliativen Behandlungsstrategie, was bedeutet, dass das Ziel der Heilung aufgegeben werden muss und nun das palliative Ziel der bestmöglichen Lebensqualität mit der Erkrankung angestrebt wird. Dies beinhaltet bestmögliche Kontrolle von etwaigen Symptomen wie Schmerzen, Atemnot oder andere, um trotz der Erkrankung eine komfortable Lebenssituation zu gewährleisten. Bei fortschreitender Erkrankung adaptieren sich viele Menschen schrittweise an den Verlauf und damit auch an körperliche Veränderungen und finden, manchmal unerwartet, trotz zunehmender Einschränkungen weiterhin Sinn und Erfüllung in ihrem Leben. Mit der Verschiebung von Werten verändern sich die Wünsche, werden manchmal bescheidener, ohne an persönlichem Wert einzubüßen, wie man das vielleicht annehmen könnte.
Eine sehr atemnötige Patientin kommt für die medizinische und pflegerische Palliativbehandlung und, für den Fall, eine vorgestellte zukünftige Situation nicht mehr aushalten zu können, mit einer Anfrage nach Euthanasie zur Aufnahme. Die Patientin erfüllt die Kriterien zur Durchführung einer Euthanasie und es werden die benötigten Dokumente vorbereitet. Bei einer Euthanasie bestimmt der Patient den Tag und die Uhrzeit seines Lebensendes selbst. Die Patientin setzt sich jeden Tag mit der Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für ihr Lebensende auseinander. „Wann ist der Tag, an dem ich gehe? Ich weiß nicht, wann der richtige Tag ist, aber heute ist noch nicht der Tag.“ Die Patientin überlegt wochenlang, wann der richtige Zeitpunkt wäre, zu sterben. In der Zwischenzeit kann die Patientin durch die medizinische Symptomkontrolle, Zuwendung und angenehme Atmosphäre vermehrt an Lebensqualität hinzugewinnen. Sie kann viele angenehme Tage im Kreise der Angehörigen und Freunde verbringen, profitiert von den Besuchen ihres Hundes, vom Appetit beim guten Essen und einem Glas Wein, von Spaziergängen mit dem Rollstuhl und sonnigen Tagen auf der Terrasse. Jeder gelebte Tag ist für die Patientin wertvoll. Mit dem Fortschreiten der Erkrankung nimmt die Atemnot zu und eines Tages äußert die Patientin, dass heute der Tag gekommen sei, an dem sie sterben werde. Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich sehr rasch und sie verstirbt ruhig innerhalb weniger Stunden in Anwesenheit der Angehörigen.
Dringlichkeit
Menschen, die die Diagnose einer unheilbaren und schweren Erkrankung erhalten, erleben häufig eine Zäsur in ihrem Leben. Nichts ist mehr so, wie es bisher war. Die Lebenszeit ist begrenzt und es müssen nun Prioritäten gesetzt werden. Manches lässt sich nicht mehr aufschieben und muss jetzt erledigt werden. Es ist vielleicht wichtig, das Vermögen zu regeln, den Betrieb zu übergeben, die Heizung und den Computer zu erklären, den Schreibtisch zu räumen, den Hund abzugeben oder es kann zur besonderen Dringlichkeit werden, die Kinder versorgt zu wissen.
Bei einer Frau wird ein bereits sehr fortgeschrittener Krebs diagnostiziert und der Arzt schätzt die Lebenserwartung der Patientin als sehr kurz ein. Die Patientin leidet an einigen belastenden Symptomen und ist auf den Rollstuhl angewiesen. Im Gespräch äußert sie, dass sie wisse, dass sie bald sterben werde und ihre größte Sorge im Moment die noch ungeklärte Versorgung ihrer beiden noch minderjährigen jugendlichen Töchter sei. Können die Töchter in der bisherigen Wohnung bleiben? Wer schaut nach ihnen? Wie werden sie in Zukunft finanziell versorgt sein? Die alleinerziehende Patientin ist sehr bemüht, mit Unterstützung einer Sozialarbeiterin die Versorgung ihrer Töchter zu regeln und schnell voranzubringen. Wider Erwarten lässt es der Gesundheitszustand der Patientin so weit zu, dass sie in Begleitung Termine auf den Ämtern wahrnehmen und Gespräche führen kann. Über mehrere Wochen findet die Patientin trotz zunehmender Verschlechterung des Gesundheitszustandes die Kraft, die Versorgung der Kinder zu bewerkstelligen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Bemühungen verstirbt die Patientin innerhalb weniger Tage.
Eine Patientin kommt mit einer sehr fortgeschrittenen Krebserkrankung zur Aufnahme. Sie ist an den Rollstuhl gebunden und bei jeglicher Fortbewegung auf Hilfe angewiesen. Die Patientin ist bereits über Monate durch die Aufenthalte im Krankenhaus und zuhause in ihrem Bewegungsradius sehr eingeschränkt. Die einzige Tochter hat vor Kurzem ein Haus 150 km entfernt im Ausland gekauft. Der größte Wunsch der Patientin besteht darin, die Stadt und das Haus zu besuchen, in dem ihre Tochter zukünftig leben wird, um sich von der guten Versorgung ihrer Tochter zu überzeugen. Mit Unterstützung einer spezialisierten Organisation für den Transport und die Betreuung vor Ort kann die Patientin die lange Fahrt antreten und mit ihrer Tochter ein Kaffeekränzchen im neu gekauften Haus halten. „Es war einer der schönsten Tage seit Monaten.“ „Sie hat gut gekauft, ja, dort kann sie leben.“ Die Patientin verstirbt kurze Zeit später.
Weltbild
Mit der erlebten Bedrohung und Fragilität des Lebens, dem zunehmenden Verlust der Gesundheit und der mit der Erkrankung einhergehenden Einschränkungen, kann es zu einer Änderung des Weltbildes kommen. Familie, Freunde und andere Beziehungen können wertvoller und wichtiger oder auch klarer abgelehnt werden. Geld kann an Relevanz verlieren, kleine Dinge wie ein schöner, sonniger Tag, Vogelgezwitscher, ein angenehmer Besuch der besten Freundin, freundliche Menschen, die Lieblingsspeise, Abwesenheit von unangenehmen Symptomen und Schmerzen usw. können einen persönlich höheren Stellenwert erlangen. Scheinbar Unwichtiges kann an Bedeutung gewinnen und bisher Wichtiges kann in den Hintergrund rücken.
Scheinbar Unwichtiges kann an Bedeutung gewinnen und bisher Wichtiges kann in den Hintergrund rücken.
Der Patient leidet an einer sehr fortgeschrittenen Krebserkrankung, ist überwiegend mobil, kognitiv klar und unruhig. Er zeigt sich sehr heimatverbunden und äußert als einen seiner größten Wünsche, sich nach monatelangem Krankenhausaufenthalt von seinem Haus, seinem Heimatdorf und dem Elternhaus verabschieden und ein letztes Mal das Grab seiner Eltern besuchen zu können. Dem Patienten kann mit Unterstützung von Freiwilligen ein Besuch und eine Begehung von diesen persönlich bedeutsamen Orten ermöglicht werden. Dies stellt für den Patienten einen weiteren Schritt auf dem Weg des Abschlusses seines Lebens und zur Erlangung innerer Ruhe dar.
Lebensqualität
Was Lebensqualität in der letzten Lebensphase für den einzelnen Menschen bedeutet, ist naturgemäß sehr unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab. Wie hat der Mensch bisher gelebt? Was hat ihn ausgemacht? Was hat ihn biografisch geprägt? Wie ist die aktuelle Lebenssituation bezüglich der Beziehungen, seiner Versorgung, seiner Wünsche und Bedürfnisse? Wie lange lebt der Mensch schon mit der Erkrankung? Wann wurde die Diagnose gestellt? Hatte der Mensch Zeit, sich mit der Erkrankung und dem nahenden Lebensende auseinanderzusetzen und vorzubereiten oder überschlagen sich die Ereignisse?
Lebensqualität hat sehr subjektiv empfundene Inhalte und es braucht daher eine sehr individuelle Zuwendung und genaues Hinhören, welche Bedürfnisse in der aktuellen Lebenssituation im Moment im Vordergrund stehen und für den betreffenden Menschen jetzt ein Stück Lebensqualität darstellen. Mit der fragilen gesundheitlichen Situation können sich die Bedürfnisse auch sehr rasch ändern. Ein Ausflug, der heute attraktiv erscheint, kann morgen wegen übergroßer Müdigkeit uninteressant sein. Ein Lieblingsgericht, auf das heute Appetit da ist, kann morgen unbedeutend sein.
Ein Patient lebt seit einigen Monaten mit der palliativen Diagnose eines Kopftumors in der Einrichtung. Er ist kognitiv klar und weiß, dass er eine kurze Lebenserwartung hat. Es ist ihm sehr wichtig geworden, die verbleibende Zeit so viel wie möglich mit seiner Familie zu verbringen. Der Patient und seine Angehörigen können, trotz der Halbseitenlähmung des Patienten und damit sehr erschwerter Mobilität, einen guten Lebensrhythmus in der letzten Lebensphase erreichen. Der Gesundheitszustand bleibt wider Erwarten über mehrere Monate weitgehend stabil. Das Ehepaar hat die Gewohnheit, seinen jährlichen Hochzeitstag in einem bestimmten Hotel im Ausland mit einem Wellnesswochenende zu feiern und anschließend ein paar Flaschen Wein vom befreundeten Winzer aus der Gegend mitzubringen. Mit Unterstützung einer spezialisierten Organisation kann der Patient mit seiner Frau seinen Hochzeitstag im gewohnten Hotel verbringen. Die Hotelleitung empfängt das Ehepaar sehr freundlich ein letztes Mal und verabschiedet sich bei seinen langjährigen Gästen mit der Einladung zum Aufenthalt und zu einem Festtagsmenü. Anschließend wird beim Winzer, der hurtig mit einer Flasche Wein und Gläsern in den Krankenwagen klettert, unter Tränen auf ein letztes Glas angestoßen. Der Patient und seine Frau erleben einen besonderen Tag im letzten Lebensabschnitt des Ehemannes. Er stellt wohl einen weiteren Schritt auf dem Weg zum endgültigen Abschied dar.
In diesem Sinne kann eine Lebenseinstellung nach dem lateinischen Spruch „Carpe diem – Nutze den Tag! Genieße den Augenblick!“ zu einem gelingenden Ausklang des Lebens beitragen.
Martina Thill ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin und arbeitet seit 2011 bei Omega 90.
1 PD Dr. Roland Thomaschke, „Zeitwahrnehmung“, in: Markus Antonius Wirtz (Hg.), Dorsch. Lexikon der Psychologie, Bern, Hogrefe, 2021.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
