- Gesellschaft, Politik
forum_story: Die Ukraine und wir
INHALTSVERZEICHNIS
Im Konflikt mit Russland seit jeher
Von Anfang an politische Fehler gemacht
Die Revolution der Würde – der Maidanaufstand
Die Ukraine überlebt, dank der USA
Das schwierige Verhältnis zu Russland
Luxemburgische Soft Power bei Crémant und Rieslingpastete
Ein Krieg, der sich ankündigte und auf den keiner vorbereitet war
Krieg, Frieden, Vergebung und Diplomatie
Europäische Integration ja, aber …
Ein Wettlauf gegen die Zeit: mit der Ambulanz an die Front und zurück
Kein schlimmerer Feind und falsche Freunde
Die Ukraine und wir
Ще не вмерла України ні слава, ні воля
„Weder der Ruhm noch die Freiheit der Ukraine sind bisher gestorben.“
Aus der ersten Zeile der ukrainischen Nationalhymne

Die Ukraine erlangte 1991 ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion und für viele im Westen fängt hier die Geschichte der Ukraine erst an. Doch die Wurzeln der aktuellen Ukraine lassen sich bis ins frühe Mittelalter zurückverfolgen, als Kyjiw im 9. Jahrhundert das Zentrum des mächtigen Kyjiwer Rus (862-1242), eine Föderation auf dem Gebiet des heutigen Belarus, der Ukraine und eines Teils Russlands, war. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Territorium der Ukraine von wechselnden Mächten wie Polen, dem Osmanischen Reich, Russland und später der Sowjetunion besetzt und beherrscht. Damit einhergehend kam die brutale und konsequente Unterdrückung der ukrainischen Kultur und Sprache. Die Geschichte der Ukraine ist geprägt von Episoden unbeschreibbaren Leids, wie des vom Sowjetregime durchgeführten Genozids Holodomor in den 1930er Jahren. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Ukraine zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion zerrieben. Ein weiteres einschneidendes Ereignis war der Supergau des Atomkraftwerks von Tschernobyl. Über all diese Herausforderungen und Jahrhunderte hinweg hat sich in der Ukraine eine starke nationale Identität und der Wunsch nach Unabhängigkeit bewahrt.
Bei meiner ersten Reise in die Ukraine 2005 stehen auf dem Maidan Platz noch orange Zelte und Flaggen, die gleichnamige friedliche Revolution1 war erst vor wenigen Wochen zu Ende gegangen. Abends in einem Club umarmt mich ein junger ukrainischer Student, küsst mich auf die Wange und sagt: „We’re free! Soon we will be in the European Union with you!“ Nach den turbulenten Jahrzehnten, die der Unabhängigkeit von 1991 folgten, dachten viele Ukrainer*innen, jetzt würde alles besser werden.
Um die Geschichte der Ukraine zu erzählen, lohnt es sich, in die Vergangenheit zu reisen. Zum Beispiel in die Westukraine nach Ostroh, ein kleines verschlafenes Dorf im Oblast (ukrainisch „Region“) Riwne. Während des Holodomor2 war Ostroh das Grenzgebiet zwischen der „polnischen Ukraine“, die zur Zweiten Polnischen Republik gehörte, und der Ukrainischen SSR (Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik), die zur UdSSR gehörte. Ostroh war auch eine Demarkationslinie für den Holodomor. Abends, wenn die Sonne sich über Ostroh legte, schlichen die Menschen auf der polnischen Seite ans Flussufer. Sie brachten Weizen, Brotlaibe und Gemüse zu den alten Barken, die hier am Ufer lagen. Bei Dunkelheit ruderten die Menschen auf die andere Flussseite. Wenn sie die sowjetische Seite erreichten, standen bereits abgemagerte Menschen am Ufer. Die kalten Hände rissen das Essen an sich und verschwanden im Dunkeln, manchmal ließen sie ein Kind bei den polnischen Samaritern zurück, damit sie es in ihre Obhut nahmen. In Polen starben die mangelernährten Kinder dann oft trotzdem an Überfütterung aufgrund des schnellen Wechsels zu einer normalen Ernährung. Dies ist eine der vielen Geschichten des Holodomor, die in der Familie von Nicolas Zharov erzählt werden. Zharov ist einer unserer Protagonisten der forum_story, er ist der Präsident und Mitbegründer der LUkraine ASBL.
Er hat diese Geschichte seiner Vorfahren schon oft erzählt und selbst noch viel öfter gehört. Mit 17 Jahren kommt Nicolas Zharov in Luxemburg an. Im gleichen Jahr findet die Orange Revolution statt. In dieser Zeit fängt er auch an, sich stärker für die Politik und die Geschehnisse in seinem Heimatland zu interessieren. Seine Organisation hat sich dank ihm und der Arbeit hunderter freiwilliger Helfer*innen einen Namen gemacht. Häufig habe ich in der Ukraine mitbekommen, dass Soldat*innen oder Helfer*innen einem entgegnen: „Ah LUkraine!“, sobald man erzählt, dass man aus Luxemburg kommt.
Granit und Orangen

„Die erste friedliche Revolution war die Revolution auf Granit3, ich war viel zu jung, um sie mitzuerleben, aber die Orange Revolution war ein richtiger wind of change Moment für unsere junge Ukraine“, erzählt Zharov. „Beide Male, sowohl bei der Granit- als auch bei der Orangen Revolution, waren es die Studierenden, welche die friedlichen Proteste starteten, und bei der Orangen Revolution fühlte ich mich als junger Student sofort angesprochen.“ Er realisiert und beobachtet damals zum ersten Mal, wie Russland versucht, eine russische Sichtweise in die ukrainischen Diskurse und Medien einzuschleusen. Russische Expert*innen treten im Fernsehen auf und erklären den Ukrainer*innen ihr eigenes Land. Laut Zharov besteht das größte Vermächtnis von Präsident Juschtschenko4 (2005-2010) darin, dass er eine neue, unabhängige ukrainische Identität, basierend auf den Grundwerten der Demokratie, versucht hat, aufzubauen. Dabei wurde viel investiert in Kultur- und Gesellschaftspolitik: „Für die großen Baustellen jedoch hatte selbst Juschtschenko nicht genügend Ressourcen, im Kampf gegen ‚Klans‘ in Wirtschaft und Politik und gegen die Korruption“, erklärt Zharov. Das Land sei damals aufgebaut worden von Menschen, die bereits vom Sowjetsystem profitiert hatten. Diese Menschen nannte man in der Ukraine „rote Bosse“ oder „rote Direktoren“. Sie waren die alte und neue Elite, welche sich Ende der 1980er und Anfang der 1990er zu Schleuderpreisen bei Privatisierungen große Teile der Wirtschaft ersteigern konnten. Jene „Klans“ und „roten Direktoren“ behielten ihre Macht bis weit in das erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts und später fand man sie auch in der Politik wieder, „um sich noch weiter zu bereichern“, so Zharov.
Diese Entwicklung sieht unser zweiter Gesprächspartner ähnlich. François Bausch, luxemburgischer Verteidigungsminister von 2018 bis 2023, hat die russische Invasion 2022 und die europäische Reaktion darauf miterlebt. Er kennt die Geschichte Russlands aus dem Effeff, wohl auch wegen seiner Vergangenheit als „alen Trotzkist“. Er sah die politische Entwicklung der Ukraine zu Beginn des Jahrtausendwechsels als sehr positiv. Doch auch er unterschätzte damals, wie aggressiv Russland auf die ukrainischen Bemühungen, sich demokratischer und transparenter zu gestalten und sich an einem westlichen Modell zu orientieren, reagieren würde.
Im Konflikt mit Russland seit jeher
2003 kam es bereits beinahe zu einem ersten bewaffneten Konflikt zwischen der neuen Russischen Föderation und der unabhängigen Ukraine. Der Tuzla-Insel-Zwischenfall ereignete sich im Oktober 2003 und führte zu einer ernsthaften diplomatischen Krise zwischen Russland und der Ukraine. Die Spannungen entstanden, als Russland begann, einen Damm vom russischen Festland zur ukrainischen Tuzla-Insel im Asowschen Meer zu bauen. Die Ukraine betrachtete dies als Bedrohung ihrer territorialen Integrität und verstärkte daraufhin ihre militärische Präsenz in der Region. Der Konflikt wurde schließlich durch diplomatische Verhandlungen entschärft, aber er verdeutlichte die anhaltenden Spannungen zwischen den beiden Ländern hinsichtlich der Kontrolle über strategische Gebiete. Nach dem Tuzla-Insel-Zwischenfall unterzeichneten die Ukraine und Russland ein Abkommen, welches das Asowsche Meer und die Straße von Kertsch als gemeinsame Binnengewässer beider Staaten anerkannte, um den Konflikt zu lösen. Diese diplomatische Lösung bringt uns zu unserem dritten Protagonisten: Jean Asselborn. Dieser übernahm 2004 das Amt des luxemburgischen Außenministers. Einer seiner ersten bilateralen Termine war ein Staatsbesuch seines ukrainischen Amtskollegen, Außenminister Kostjantyn Hryschtschenko, in Luxemburg. Damals war Jean Asselborn es noch nicht gewohnt, mit erfahrenen Karrierediplomaten zu verhandeln, aber er lernte schnell: „Das war der Startschuss, danach habe ich sie alle kennengelernt, alle ukrainischen Akteure von Janukowitsch bis Selenskyj“, schmunzelt der Außenminister a. D. Im Sommer 2024 bin ich zu Gast bei den Asselborns in Steinfort, die Verabredung beim Ex-Minister war unkompliziert und entspannt.
2004 hatte Asselborn das Ruder im Hotel St. Maximin, dem Außenministerium Luxemburgs, übernommen. Zeitgleich beginnt für die junge Demokratie der Ukraine eine turbulente Zeit. Die luxemburgisch-ukrainischen Beziehungen sollten sich im Laufe der nächsten Jahre verändern und sich später nachhaltig verfestigen. Im Gegensatz zu vielen anderen politischen Akteuren redet Jean Asselborn ganz offen über diplomatische Fehler und verpasste Chancen.
Luxemburg in der Ukraine
2005 übernahm Luxemburg die EU-Ratspräsidentschaft. Während dieser Periode muss sich Jean Asselborn intensiv mit der Ukraine beschäftigen. Dabei übernimmt er oft die Rolle des Schlichters: „Kurz nach der Orangen Revolution gab es einen politischen Machtstreit zwischen Präsident Wiktor Juschtschenko und der Premierministerin Julia Tymoschenko.“
Aus ökonomischer und politischer Sicht versuchte die luxemburgische Regierung, die Beziehungen zu dem jungen Land zu verbessern und Arcelor sollte hierbei helfen.

Präsident Poroschenko die Geschicke des Außenministeriums in Kyjiw leitete, 2017. © MAEE
Der Konflikt zwischen Juschtschenko und Tymoschenko begann nach ihrer Zusammenarbeit während der Orangen Revolution. Trotz gemeinsamer Ziele gerieten sie in Konflikt über politische Strategien und wirtschaftliche Fragen, insbesondere im Hinblick auf Gasverträge mit Russland. Zudem hatten sie unterschiedliche Ansichten bezüglich der Verteilung von Macht und Regierungsposten, was zu einer dauerhaften Krise führte. „Jede Reise in die Ukraine oder jeder Austausch mit der Regierung in Kyjiw war von dieser Zankerei begleitet“, erinnert sich Jean Asselborn. Aus ökonomischer und politischer Sicht versuchte die luxemburgische Regierung, die Beziehungen zu dem jungen Land zu verbessern und Arcelor sollte hierbei helfen. Kryworischstal in Krywyj Rih5 in der Südukraine, das größte Stahlwerk der Ukraine, wurde erstmals 2004 privatisiert. Diese Privatisierung war jedoch äußerst umstritten. Das Unternehmen war für lediglich 800 Millionen US-Dollar an ein ukrainisches Konsortium verkauft worden, was deutlich unter dem geschätzten Marktwert lag. Die Transaktion führte zu Korruptionsvorwürfen und Kritik, da ausländische Unternehmen vom Bieterverfahren ausgeschlossen waren. Nach der Orangen Revolution und der Wahl von Präsident Wiktor Juschtschenko entschied die neue Regierung, die ursprüngliche Privatisierung für ungültig zu erklären. 2005 wurde Kryworischstal erneut und diesmal in einem transparenten und wettbewerbsorientierten Verfahren zum Verkauf angeboten. Arcelor (heute ArcelorMittal) erwarb das Stahlwerk für 4,8 Milliarden US-Dollar – ein deutlich höherer Preis als beim ersten Verfahren. Der Kauf galt zu diesem Zeitpunkt als eine der bedeutendsten Auslandsinvestitionen in die Ukraine und wurde als Erfolg für Transparenz und faire Marktpraktiken angesehen. Es war ein Sieg für die ukrainische Regierung und ein Signal, um weitere ausländische Investoren anzuziehen. Jean Asselborn erinnert sich an diese Zeit und auch an seine Rolle in diesem Deal: „Ich traf den Präsidenten Juschtschenko am Rande der UN-Vollversammlung in seinem Hotel in New York, wo wir erste Gespräche geführt haben und den Grundstein dieser Kooperation einleiteten.“ Dieser Milliardendeal sollte zeigen, dass die Ukraine ein aufstrebendes Land ist, in welches es sich zu investieren lohnt, auch für europäische Firmen. Luxemburg wurde mit dieser Übernahme zu einem sichtbaren Akteur in der ukrainischen Wirtschaft. Nicolas Zharov sieht die Investments ausländischer Firmen aus dieser Periode ebenfalls als wichtige Meilensteine an, übt jedoch auch Kritik: „Die reichen Oligarchen behielten bei diesen Deals die Macht und die Investments brachten für die einfachen Menschen keine spürbaren Verbesserungen. Die Verbesserung der Lebensbedingungen wurde vielmehr durch das Engagement der Zivilgesellschaft gefördert, die für mehr Fortschritt, Demokratie und Beteiligung kämpfte.“

© Vladislav Khomenko / Kommersant / AFP
Von Anfang an politische Fehler gemacht
Die internationalen privatwirtschaftlichen Milliardeninvestitionen in die Ukraine gingen nicht einher mit einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik für die Ukraine. Es fehlte an einer kohärenten Vision für ein Land, welches 40 Millionen Einwohner hat. Die europäische Politik tat sich schwer, der Ukraine eine nachhaltige politische Perspektive zu bieten, das heißt eine konkrete Roadmap hin zu einem EU-Beitrittskandidatenstatus. Retrospektiv sieht Jean Asselborn die Rolle der EU im Umgang mit der Ukraine kritisch. 2005, während der luxemburgischen EU-Ratspräsidentschaft, bereiste Asselborn die Ukraine mehrmals. Unter anderem wurde er begleitet von Benita Ferrero-Waldner, der österreichischen Diplomatin und EU-Kommissarin für Außenbeziehungen und europäische Nachbarschaftspolitik, sowie Javier Solana, dem spanischen EU-Außen- und Sicherheitsbeauftragten: „Ich habe mich noch vor Kurzem mit Carl Bildt, dem damaligen schwedischen Außenminister, und dem polnischen Politiker Radosław Sikorski über diese Zeit unterhalten. Im Nachhinein bin ich sehr skeptisch und glaube auch, dass wir Fehler gemacht haben“, reflektiert Asselborn. „Wir haben der Ukraine gesagt, man müsse sich entweder für Russland oder den Westen entscheiden.“ Laut dem früheren Außenminister waren es mehrere Länder, die diesen Druck auf die Ukraine ausübten, den Blick entweder nach Brüssel oder nach Moskau zu richten. Dies geschah auch, weil man schlicht und einfach schlecht informiert war, meint Jean Asselborn. „Damals wurde es uns so dargestellt, als ob im Osten der Ukraine die Menschen nach Moskau schauen und die andere Seite eben nicht.“ Sowohl in den Medien als auch in diplomatischen Kreisen herrschte diese Annahme, bemerkt Asselborn. Er hinterfragt die Rolle der EU wie auch seine eigene und ist sich bewusst, dass „wenige von den Top-Politikern sich diese kritischen Fragen stellen und noch weniger öffentlich Fehler zugeben“.
Die europäische Politik tat sich schwer, der Ukraine eine nachhaltige politische Perspektive zu bieten, das heißt eine konkrete Roadmap hin zu einem EU-Beitrittskandidatenstatus.

© Eric Feferberg / AFP
François Bausch erwägt auch, dass die EU taktische Fehler im Umgang mit der Ukraine in den letzten zwei Jahrzehnten gemacht hat. Laut Bausch hat die Präsidentschaft von Juschtschenko erst den Weg zu mehr europäischer Zusammenarbeit und Offenheit geebnet. Ferner wurden zeitgleich die transatlantischen Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine gefördert. Zwischen 2005 und 2008 war es die amerikanische Regierung unter Präsident George W. Bush, welche die Idee einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine begrüßte. Opposition gab es damals aus Berlin und Paris, und andere kleinere Bündnispartner reihten sich in diese Opposition ein. Das Thema wurde im ukrainischen Parlament, der Rada, hitzig diskutiert, es gab sogar Pläne für ein Referendum zum möglichen NATO-Beitritt. Im Endeffekt war es der NATO-Gipfel in Bukarest 2008, bei dem man der Ukraine, aber auch Georgien, auf Drängen von Russland, keine Mitgliedschaft anbot. Der damalige NATO-Generalsekretär de Hoop-Scheffer hielt dennoch ein Plädoyer für die spätere Mitgliedschaft beider Länder. Kurze Zeit später fiel Russland in die georgischen Teilrepubliken Abchasien und Südossetien ein und besetzt diese Regionen bis heute. Georgien und genauso später die Ukraine, welche nicht vom NATO-Schirm profitierten, waren „einfache“ Opfer für Russland. Prorussische Analysten behaupten immer wieder, dass Russland sich spätestens seit 2008 wieder vom Westen und der NATO bedroht fühlte. Mit dieser Argumentation legitimieren sie die aggressiven Expansionskriege von Russland in Georgien. Allerdings ist diese Darstellung „des in die Ecke gedrängten Bären“ mit Vorsicht zu genießen, weil die NATO und der Westen über Jahre hinweg den Kreml mit an den Tisch einluden, wenn es um Sicherheitspolitik ging. Auch auf den NATO-Gipfel von Bukarest 2008. Dutzende Diplomaten, Attachés und Militäroffiziere waren Teil der russischen Delegation auf diesem Gipfel und angeführt wurden sie von Wladimir Putin persönlich: „Es ist doch verrückt, dass Putin in Bukarest 2008 mit am Tisch saß, mitdiskutieren konnte und somit Russland eingebunden wurde, und es trotzdem zu diesen Kriegen kam“, sagt François Bausch.
Dirty deals done dirt cheap
Viele europäische Länder waren an einem der aufstrebendsten Märkte Osteuropas interessiert und somit wurde langsam aus dem Konkurrenzkampf um Teile des ukrainischen Marktes eine politische Auseinandersetzung. Russland hatte sich an der ukrainischen Wirtschaft festgeklammert und das Land teilweise mit Knebelverträgen im Energie- und Transitbereich an sich gebunden. „Putin und die russischen Oligarchen wollten natürlich das Monopol an der ukrainischen Wirtschaft behalten und darum ging es den Russen von Anfang an“, erklärt Jean Asselborn. Russland verschärfte in jenen Jahren den Ton gegenüber der Ukraine. Politisch gesehen unterstützte der Kreml großzügig seinen „mandschurischen“ Kandidaten6. Dieser Kandidat war Wiktor Janukowytsch7, der bereits in der Orangen Revolution mit seinem Vorhaben gescheitert war, die Ukraine enger an Russland zu binden. Doch der Kreml half dabei, die Wählerbasis von Janukowytsch vor allem im Osten der Ukraine zu mobilisieren, in genau jenem Donbass, wo Russland seit über 200 Jahren versucht, die Bevölkerung zu russifizieren8. Russland wollte diesen milliardenschweren Markt und Produktionsstandort mit allen Mitteln sichern und dies auch mit Hilfe korrupter Oligarchen. Nicolas Zharov von der LUkraine Organisation betont, dass es wichtig ist, die Ukraine jener Zeit auch zu verstehen, indem man die machtpolitischen Strukturen näher unter die Lupe nimmt. Reformansätze scheiterten nicht nur wegen der von Russland gesteuerten medialen Kampagnen und politischen Einflussnahme, sondern auch durch die Vormachtstellung einflussreicher Familien und lokaler „Klans“, die sich nach der Wirtschaft auch in die Politik ausbreiteten.
Besonders gut erinnert sich Jean Asselborn dabei an die rechte Hand von Janukowytsch, Premierminister Mykola Asarow, der 2010 und 2013 in Luxemburg auf Arbeitsvisite war: „Kurz nach den Maidan Protesten ist Asarow nach Moskau geflüchtet, man hatte damals schon bei seinen Besuchen in Luxemburg kein gutes Gefühl, es stank immer nach Korruption.“ In der Tat flüchtete Asarow kurz nach den Maidan Protesten 2013-2014 nach Russland, wo er bis heute durch Moskau Schutz als politischer Flüchtling genießt. Laut ukrainischer Staatsanwaltschaft soll Asarow mehrere Milliarden Euro an öffentlichen Geldern unterschlagen haben: „Er hat sich mit dem Flugzeug und den Goldbarren auf und davon gemacht“, kommentiert Asselborn noch immer ein wenig fassungslos.
Die Revolution der Würde – der Maidanaufstand
Die Revolution der Würde oder Maidanaufstand in Kyjiw begann im November 2013, als friedliche Proteste aufflammten gegen die Entscheidung der ukrainischen Regierung, ein Assoziierungsabkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen. So wird es zumindest oft in den Medien dargestellt. Doch die Gründe für die Proteste liegen in der tiefen Unzufriedenheit der ukrainischen Gesellschaft, wie Nicolas Zharov immer wieder betont. Es war eine Zeit der nicht eingehaltenen Versprechen und vor allem der nicht vorhandenen Aussicht auf nachhaltige Perspektiven und ein besseres Leben. Knapp zwölf Jahre nach der Unabhängigkeit der Ukraine wollten die Ukrainer*innen wirtschaftliche Perspektiven sehen und die lähmende Korruption angehen. Die Demonstrationen weiteten sich schnell zu landesweiten Protesten gegen Korruption, Polizeigewalt und das autoritäre Regime aus. In jeder Großstadt, aber auch auf dem Land, gab es eine Maidanbewegung. Im Februar 2014 eskalierte die Gewalt, als Sicherheitskräfte mit Scharfschützen auf Demonstrant*innen schossen. Insgesamt starben etwa 100 Menschen, viele von ihnen durch Schussverletzungen. Die „Himmlische Hundert“ (ukrainisch: Небесна Сотня) bezeichnet die rund 100 Demonstrant*innen, die während der Revolution der Würde 2014 in Kyjiw getötet wurden und als Märtyrer*innen und Held*innen der Ukraine verehrt werden. Die Ereignisse führten im Endeffekt zum Sturz von Präsident Wiktor Janukowytsch, der nach Russland flüchten musste. Die Ukrainer*innen hofften ab diesem Moment wieder auf schnelle und nachhaltige pro-europäische Reformen und vor allem auf ein Leben in Ruhe. Doch dann kam Russland dazwischen.
Nach diesen Protesten bot das Stadtzentrum rund um den Maidan-Platz ein bedrückendes und chaotisches Bild. Die Stadt war tief erschüttert von den Ereignissen der letzten Wochen und Monate und der Platz selbst war ein Ort der Zerstörung. Viele der provisorischen Barrikaden, die die Demonstrant*innen während der Auseinandersetzungen errichtet hatten, waren niedergebrannt oder zertrümmert. Überreste von brennenden Autoreifen und Schrott lagen verstreut auf dem Platz und die Asche zeugte von den heftigen Feuern, die die Nächte der Proteste durchzogen hatten. Auch einige der angrenzenden Gebäude, darunter das Gewerkschaftshaus, waren stark beschädigt oder ausgebrannt, an jeder Ecke gab es dunkle oder rostbraune Flecken, stille Zeugen der Brandzerstörung. Jean Asselborn war zu diesem Zeitpunkt im Rahmen eines Benelux-Außenministertreffens auch in Kyjiw, unter anderem mit Frans Timmermans und Didier Reynders. „Uns war es wichtig, Zeugen zu sein und unsere Anteilnahme zu zeigen, aber auch unsere Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Das Bild der Verwüstung, das sich uns zeigte, war grauenhaft“, erinnert sich der Ex-Minister. „Überall lag Asche, und auf dem Maidan-Platz roch es einfach überall nach Tod“, sagt der Minister nachdenklich und wiederholt sich den Satz noch einmal selbst.
Noch heute ist es schwierig für mich, am Maidan-Platz vorbeizugehen, ohne an die Revolution zu denken. Mein Blick richtet sich automatisch auf das imposante Hotel Ukraina, von dem aus Scharfschützen die Demonstrant*innen töteten. Jeder Schritt ist ein Schritt auf blutgetränktem Boden: Es ist unmöglich, über die Instytutska Straße zu gehen, ohne an die brennenden Barrikaden zu denken. Einen normalen Spaziergang auf dem Maidan gibt es nicht.
Am 25. Februar 2014 saß Jean Asselborn mit Sergei Lawrow, dem russischen Außenminister, auf einer Pressekonferenz in Moskau. Auf der Tagesordnung standen offiziell laut dem Pressebericht des luxemburgischen Außenministeriums: der Nahe Osten mit Syrien und dem Iran, Luxemburgs Vorsitz im Weltsicherheitsrat im März 2014, die „großen afrikanischen Dossiers“ und die „aktuellen Entwicklungen in der Ukraine“. Zur selben Zeit führt Präsident Putin mit seinen Repressions- und Sicherheitsapparaten eine Marathonsitzung durch, um Provokationen und die darauf folgende Annexion der Krim vorzubereiten. Wenige Stunden, bevor russische Spezialkräfte die ukrainischen Flughäfen auf der Krim stürmen und Saboteure auf der Krim aktiv werden, scheint Lawrow darüber nicht unterrichtet zu sein. Asselborn würde darauf wetten, dass Lawrow nicht ganz im Bilde war und absichtlich vom inner circle des Kreml nicht in Kenntnis gesetzt wurde: „Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass zu diesem Zeitpunkt im Kreml nicht jeder auf dem gleichen Wissensstand war. Für mich sah es so aus, als hätte man Lawrow nicht informiert“, betont Asselborn. Für Asselborn war Lawrow immer in erster Linie ein professionell agierender Diplomat und kein Politiker oder Propagandist. Nach diesem Einschnitt der Krim-Annexion hatte Asselborn jedoch das Gefühl, dass Lawrow langsam, aber sicher von einem kompetenten Diplomaten zu einem reinen Sprachrohr wurde. Und dies sollte sich in den nächsten Jahren noch verschlimmern.

Nur wenige Wochen nach der Maidan-Revolution kam es dann zur völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland. Im Westen sprachen Expert*innen zunächst von einer „Verzweiflungstat“ Russlands, um seine Macht in der Ukraine zu festigen. Doch dies war nicht der Fall, denn die Annexion war seit Langem geplant. Vielmehr verfolgte Russland eine langfristige Strategie: Die Annexion der Krim und die anschließenden Provokationen in der Ostukraine waren Teil eines Versuchs, den ukrainischen Staat zu destabilisieren und letztlich zu schwächen, indem man ihn zwang, den Regionen mehr Autonomie und Macht zu gewähren. Russland unterstützte dabei gezielt abtrünnige Bewegungen und Politiker*innen, sei es durch separatistische Kräfte oder den Einsatz seiner eigenen Armee. Dabei profitierte Russland von seinen Stützpunkten auf der Krim: Bis 2014 unterhielt Russland eine bedeutende Militärpräsenz auf der Krim, insbesondere durch die Schwarzmeerflotte, die in Sewastopol stationiert war und über etwa 25 bis 40 Schiffe, darunter Fregatten, Korvetten und U-Boote (auch mit nuklearen Kapazitäten), verfügte. Es waren zwischenzeitlich um die 25.000 russische Soldaten auf der Krim stationiert. Diese militärische Präsenz basierte auf einem Abkommen zwischen der Ukraine und Russland, welches nach der Unabhängigkeit der Ukraine weiterhin die Anwesenheit russischer Truppen ermöglichte. Dieser Umstand trug entscheidend zur schnellen Übernahme der Kontrolle über die Halbinsel bei.
Nach diesem Einschnitt der Krim-Annexion hatte Asselborn jedoch das Gefühl, dass Lawrow langsam, aber sicher von einem kompetenten Diplomaten zu einem reinen Sprachrohr wurde.
Im Laufe seiner politischen Karriere als Abgeordneter und späterer Minister verfolgte Bausch aufmerksam die außenpolitischen Entwicklungen in der Welt. Die friedlichen Revolutionen von 2005 und 2014 sieht er als sehr positiv: „Das war ein wichtiges Zeichen, weil historisch die Ukraine nie ein Teil von Russland war, und als Staat Russland sogar prä-datiert.“ Bausch hoffte, Russland würde friedlich auf diese Revolutionen reagieren: „Klar erwartete ich mir eine Reaktion, aber keine so brutale militärische Kampagne, wo ein Land besetzt wird“, erinnert sich François Bausch. Laut ihm hatte man im Westen den Kreml falsch eingeschätzt. Heute ist François Bausch davon überzeugt, dass es in Russland in den letzten 100 Jahren keinen richtigen politischen Wandel gab: „Wenn man sich die Geschichte Russlands seit der Oktoberrevolution [1917] anschaut, dann gibt es nur nahtlose Übergänge zu dem, was wir heute sehen, mit Ausnahme von Gorbatschow, der als Reformer jedoch weggeputscht wurde“, so Bausch. Michail Gorbatschow (Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU, 1985-1991) verlor nicht nur die Gunst des KGB in der Sowjetunion, sondern auch die Unterstützung bei den Partnern im Westen, weil seine Reformen besonders aus ökonomischer Sicht nicht schnell genug gingen. Das, was wir heute an der Spitze Russlands sehen, sind die gleichen Geheimdienstler, welche Boris Jelzin zum Präsidenten (1991-1999) machten und später Putin zur Macht verhalfen. Die blinde Unterstützung Jelzins als Nachfolger Gorbatschows durch den Westen war auch schon ein Fehler, so Bausch. Jelzin, der neue KGB-Kandidat, war von Anfang an nur als Übergangspräsident gedacht, um das vorzubereiten, was später kommen sollte: nicht das System Putin, sondern das System des autokratischen Klans, mit Putin an der Spitze. Ferner stellte sich Bausch schon zu Sowjetzeiten die Frage, wer in diesem System überhaupt zu Reichtum oder Wohlstand kommen konnte. Dies gelang nur den sogenannten Apparatschiks und einer handverlesenen Elite. Auch im heutigen Russland, sagt Bausch, gibt es die gleichen Systeme der Machtverteilung. Deshalb gibt es zwischen dem System heute und dem Stalinismus von gestern nicht nur Parallelen, sondern es existiert ein roter Faden der Kontinuität. Es ist für Bausch also nicht verwunderlich, dass das „neue“ Russland ab den 2000er Jahren aggressiv nach außen agiert und seine Nachbarländer bedrängt, destabilisiert und später annektiert. Bausch unterstreicht die Kontinuität der russischen Führung, von der stalinistischen Ära bis heute. „Was wir in Putins Russland sehen, ist kein neues Phänomen. Es ist das gleiche autokratische, auf dem Geheimdienst basierende System, das Russland seit über einem Jahrhundert regiert. Putin ist keine Anomalie; er ist ein logischer Teil einer langen Reihe von russischen Leadern, die versuchen, Russlands Einfluss mit Gewalt auszuweiten.“

Als 2014 der Krieg in der Ostukraine beginnt und die Krim annektiert wird, könnte die Ukraine nicht schlechter auf einen möglichen Konflikt mit Russland und den von Russland ausgestatteten und trainierten Separatisten vorbereitet sein. Die nationale Armee ist unterfinanziert und die funktionierenden Einheiten außer Land auf Friedens- und Auslandseinsätzen9. Seit der Staatsgründung war es ein fester Bestandteil ukrainischer Außenpolitik, sich an internationalen Missionen zu beteiligen. Dieses Vakuum ließ es in der ersten Phase des Krieges zu, dass paramilitärische ukrainische Gruppierungen das Terrain übernahmen: „Ja, anfangs waren es natürlich neben der Armee auch Gruppierungen mit nationalistischer Gesinnung und auch kleine extremistische Einheiten von Freiwilligen, die sich an den Kampfhandlungen beteiligten und in den Donbass reisten, um den Vormarsch der sogenannten prorussischen Separatisten zu stoppen“, meint Zharov. Die ukrainischen Streitkräfte, bestehend aus der regulären Armee und verschiedenen paramilitärischen Einheiten, konnten laut Zharov den Vormarsch der prorussischen Separatisten erfolgreich stoppen und die Eroberung mehrerer Städte verhindern. Die Rückeroberung von Mariupol 2014 durch Asow ist einer dieser Erfolge. Es ist an dieser Stelle unabdingbar, über das Asow-Bataillon zu reden: Es wurde am 12. November 2014 offiziell in die ukrainische Nationalgarde integriert. Ursprünglich als Freiwilligenmiliz im Mai 2014 gegründet, machte das Bataillon insbesondere bei der Rückeroberung von Mariupol auf sich aufmerksam. In den Jahren nach der Integration gab es erhebliche Bemühungen, extremistische Elemente aus der Einheit auszuschließen. Durch die rigorose Trennung der Asow-Bewegung und der Militäreinheit Asow sind weitere extremistische Elemente aus der Einheit verbannt worden und spielen kaum mehr eine Rolle. Trotz der Deradikalisierung und der strikten Trennung von Bewegung und militärischer Einheit wird das Bataillon weiterhin von der russischen Propaganda gezielt diskreditiert. Vor allem versucht Moskau, unter anderem linke politische Kreise in Europa zu überzeugen, dass die Ukraine ein Neonaziproblem habe und deshalb keine Unterstützung verdiene. Die russische Propaganda verschweigt jedoch, dass russische Neonazigruppen wie die „Rusich“ Seite an Seite mit der russischen Armee kämpfen.
„Putin ist keine Anomalie; er ist ein logischer Teil einer langen Reihe von russischen Leadern, die versuchen, Russlands Einfluss mit Gewalt auszuweiten.“
Der russische Vormarsch auf der Krim und die Provokationen in der Ostukraine stärkten jedoch den Zusammenhalt der ukrainischen Bevölkerung, so auch bei den Expats in Luxemburg: „Wir wollten damals, als der Krieg im Osten der Ukraine zu wüten anfing, alle Ukrainer*innen zusammenbringen in Luxemburg, um Einheit zu zeigen. Zum ersten Mal haben wir gemerkt, dass es eine riesige Community ist und dass diese zusammen Großes bewegen kann“, so Zharov. Gemeinsam gründeten sie LUkraine, erst als eine informelle Gruppe, die Hilfsgüter für die ukrainische Armee und betroffene Zivilgesellschaft in den Krisen- und Kriegsgebieten lieferte: „Unsere erste Aktion damals hieß Stop the Bleed, es ging darum, Hemostat-Klemmen und Medikamente zur Blutverdickung für Kriegsopfer zu sammeln. Viele Menschen, sowohl Soldat*innen als auch Zivilist*innen, starben, weil es an elementaren Geräten, Medikamenten und Verbandszeugs fehlte“, erinnert sich der Präsident der LUkraine ASBL.

© Anatolii Stepanov / AFP
Zharov meint, man müsse jedoch die Konflikte zwischen der Ukraine und Russland in zwei Epochen einteilen, einmal vor 2014 und einmal danach: „Vor 2014 gab es viele Konflikte mit Russland und die Animositäten entstanden vor allem bei Wahlen, wenn Russland seine Propagandamaschinerie auf Touren brachte. Dann waren auf einmal Freunde und Nachbarn im Zwist und man stritt leidenschaftlich in Bus, Metro und Bahn über Politik. Nach 2014 wurde die Propaganda Russlands noch stärker und wir waren permanent im Fadenkreuz des Kremls“, so Nicolas Zharov.

Die Ukraine überlebt, dank der USA
Nach der Annexion der Krim gab es keine direkte militärische Reaktion aus Washington gegenüber dem Kreml. Washington schickte keine Soldat*innen als Friedenswächter und versetzte seine Armee nicht in erhöhte Alarmbereitschaft. Das Ausbleiben einer harten Antwort aus Washington wird von vielen Politiker*innen, Aktivist*innen und Historiker*innen kritisiert. Bausch meint jedoch, dass die Krim-Annexion Auslöser für die USA war, die Ukraine langfristig militärisch zu unterstützen. Deutschland, Großbritannien und Frankreich glaubten „blauäugigerweise“, sie könnten Putin zur Vernunft bringen, indem sie ihn hofierten: „Paris und Berlin ging es natürlich nicht vorrangig um das internationale Recht und die Krim, hier ging es auch um die Sicherung nationaler energiepolitischer Interessen“, erzählt Bausch. Deutschland war 2014 mehr als zur Hälfte abhängig von russischem Gas und im Elysée war man daran interessiert, das Uran für den französischen Atompark zu sichern, so die Feststellung Bauschs. Die US-Regierung begann jedoch parallel, wenn auch ein wenig im Stillen, eine militärische Kooperation zwischen den USA und der Ukraine aufzubauen. Zwischen 2014 und 2021 verstärkte sich die militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und der Ukraine aufgrund der Annexion der Krim und des Konflikts im Osten der Ukraine. Die USA stellten bis 2021 Geräte im Wert von 2,5 Milliarden Dollar zur Verfügung, darunter Javelin-Panzerabwehrraketen, Patrouillenboote und Radarsysteme. Zudem wurden ukrainische Streitkräfte im Rahmen der Joint Multinational Training Group ausgebildet, um ihre Fähigkeiten und die Zusammenarbeit mit der NATO zu verbessern. Es fanden regelmäßig gemeinsame Militärübungen statt. Auch im Bereich der Cybersicherheit und des Informationsaustauschs leisteten die USA Unterstützung, um russischen Cyber-Angriffen entgegenzuwirken. Ziel war es, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken und ihre territoriale Integrität zu sichern. Es war ein Fehler, laut Bausch, dass die europäischen Partner nicht schon damals die Ukraine mehr unterstützten. Das deutsche Mantra „Wandel durch Handel mit Russland“ sollte sich auch in diesen Jahren weiter halten. Die europäische Naivität gegenüber Moskau kumulierte in der Unterschrift der Abkommen von Minsk10, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt waren. Es kam, wie es kommen musste: Russland brach die Vereinbarungen tagtäglich. Trotzdem glaubte man weiterhin in vielen europäischen Metropolen, man könne den Kreml mit Gesprächen in Schach halten.
Das schwierige Verhältnis zu Russland
Asselborn erinnert sich, dass das Verhältnis vom Westen zu Russland nicht immer schwierig war: Auf dem EU-Russland-Gipfel in Moskau 2005 sollte der Four Common Spaces-Vertrag abschließend verhandelt und unterzeichnet werden. Luxemburg war als EU-Ratspräsidentschaftvorsitzender mit Premierminister Juncker und Außenminister Asselborn vertreten. Als Repräsentant der EU-Kommission war der portugiesische Spitzenpolitiker José Manuel Barroso anwesend. Im Kreml saß man sich näher, denn die Tische „waren noch nicht so breit und überdimensional lang wie heute“. Es wurde intensiv diskutiert und auch mal in einer Pause gemeinsam gelacht. Asselborn erinnert sich: „Jean-Claude Juncker redete mit Putin auf Deutsch und ich mit Sergei auf Englisch. Ja, es waren Marathongespräche, aber es war eine Begegnung auf Augenhöhe und wir redeten eine gemeinsame diplomatische Sprache und es war möglich, zusammenzuarbeiten!“ Knapp fünf Jahre später, auf der bekannten Moskauer Parade des 9. Mai 2009, marschierten NATO-Truppen gemeinsam mit ukrainischen und russischen Soldaten auf dem Roten Platz. „Es ist einfach so schwer nachzuvollziehen, dass diese beiden Politiker, mit denen wir vorher noch ganz normal reden konnten, auf einmal zu solchen Barbaren wurden, welche die Ukraine bewusst in eine gewaltige Katastrophe stürzen würden!“, sagt Asselborn kopfschüttelnd und wütend. Auch noch 2007, bei dem knapp siebenstündigen Putin-Besuch in Luxemburg, gab es laut Asselborn keine Animosität: „Wir saßen uns gegenüber, die Stimmung war gut und wir redeten über den Import von polnischen Produkten, den Kosovo und mögliche gemeinsame Raketenbasen, oft waren wir nicht einer Meinung, aber man konnte sich austauschen.“ Auf die Nachfrage des Luxemburger Wortes11 an den damaligen Staatsminister Juncker, ob es sich bei Putin um einen „lupenreinen Demokraten“ handele, wie es der deutsche Kanzler Schröder formuliert hatte, entgegnete Juncker: „Wladimir Putin ist ein russischer Demokrat auf dem Weg in die Lupenreinheit, also zu westlichen Standards. Sehen Sie, trotz meines persönlich ausgezeichneten Verhältnisses mit dem Präsidenten der Russischen Föderation gibt es zwischen uns substantielle Meinungsverschiedenheiten … Wir haben uns am Donnerstag doppelt so lange unterhalten, als es ursprünglich geplant war. Das hatte vor allem auch damit zu tun, dass wir strittige Themen angesprochen haben. Das ist wichtig, damit man sich ins russische Denken hineinversetzen kann und von europäischer Warte aus betrachtet, Reaktionen der russischen Seite richtig verstehen und interpretieren kann.“

Luxemburgische Soft Power bei Crémant und Rieslingpastete
Die Frage der Menschenrechte versuchten luxemburgische Diplomat*innen konsequent bei jedem Austausch mit Russland zu thematisieren. Man konnte sowohl in offiziellen als auch informellen Unterredungen die Menschenrechtslage ansprechen, Bedenken äußern, über den Kadyrow-Klan reden oder über die Pressefreiheit. „Wir sprachen dies natürlich an, weil uns etwas daran lag, diese sensiblen Themen nach vorne zu bringen“, äußert sich Jean Asselborn. Während der Zeit, als das Großherzogtum im UN-Weltsicherheitsrat vertreten war, gab es auch hervorragende Beziehungen zu dem russischen UN-Botschafter Witali Tschurkin12. Auf jeden Fall, so resümiert Asselborn die Beziehungen zu Russland, war vor 2014 alles mehr oder weniger in Ordnung. Luxemburgs Investitionen in Russland waren in diesen Jahren auf Rekordniveau, dank dem Bank- und Finanzplatz, und so genoss man doch recht gute Beziehungen zu Moskau, merkt Jean Asselborn an. Die Finanz- und Bankenplätze Moskau und Luxemburg waren dank jahrelanger Annäherungspolitik, die sowohl im Kreml als auch auf dem Krautmaart salonfähig gemacht wurde, miteinander verbunden. Allein die gegenseitigen milliardenschweren Investitionen halfen damals, etwaige Wogen zwischen den beiden Hauptstädten auf diplomatischer Ebene zu glätten. Bereits zu Sowjetzeiten war Luxemburg ein privilegierter Partner und Bankier des Kremls. Mit der Gründung der East-West United Bank in Luxemburg 1974 unter Premierminister Pierre Werner, hatte Luxemburg zusammen mit der sowjetischen Gosbank (Zentralbank) dieses Projekt in die Wege geleitet, welches im Ausland für Verstimmungen sorgte. Im Februar 2024 ordnete ein Luxemburger Gericht die Liquidierung der East-West United Bank an. Sanktionen wirken, wenn auch langsam. Russland und Luxemburg teilen einige wenige historische Verbindungen, die hauptsächlich mit der Diplomatie und den europäischen Machtverhältnissen im 19. Jahrhundert zusammenhängen. Asselborn erzählt, Russland habe immer wieder im Rahmen von Banketten und Staatsbesuchen behauptet, es habe Luxemburg fast im Alleingang zur Unabhängigkeit verholfen. Diese Darstellung entbehrt jedoch jeglicher faktischer Grundlage. Luxemburgs Unabhängigkeit ist ein Resultat kollektiver Entscheidungen europäischer Mächte und nicht durch eine direkte russische Unterstützung entstanden.

Februar 2015 © Vasily Maximov / AFP
Asselborn schätzte Lawrow dennoch. Auf persönlicher Ebene war ihm der erfahrene Karrierediplomat Lawrow lieber als der undurchsichtige Geheimdienstler Putin. 2009 lud Asselborn den russischen Außenminister sogar zu seiner privaten Geburtstagsfeier nach Steinfort ein – ein Beispiel luxemburgischer „Soft Power“ bei Wein und Rieslingpastete. „Mit Lawrow konnte man meistens ganz normal reden“, erinnert sich Asselborn und fügt lächelnd hinzu, dass der gebürtige Moskauer besonders aufblühte, wenn Whisky floss und die Zigaretten qualmten. Doch auch Lawrow sollte ab der Krim-Annexion der Realität völlig entrückt sein und nur noch die Agenda des neuen russischen Weltbildes, des „Russki Mir“, nachplappern.

Ein vergessener Krieg
In Westeuropa wird oft vergessen, wie blutig und brutal die Zeit zwischen 2014 und 2022 für die Ukraine war. Der Konflikt im Donbass und auf der Krim entwickelte sich von 2014 bis 2021 zu einem langwierigen Krieg. Im Februar 2014, nach der Revolution der Würde, annektierte Russland die Krim, was international scharf verurteilt wurde. Kurz darauf, im April 2014, brachen in der Ostukraine Kämpfe aus, als prorussische Separatisten mit russischer Unterstützung in den Regionen Donezk und Luhansk sogenannte Volksrepubliken ausriefen. In den Jahren 2014 und 2015 kam es zu schweren Gefechten, insbesondere bei Ilowajsk und Debalzewe, wo die ukrainischen Truppen hohe Verluste hinnehmen mussten. Schätzungen zufolge starben in den ersten Kriegsjahren bereits hunderte ukrainische Soldat*innen und prorussische Separatisten und Soldaten. Auch die Zivilbevölkerung litt erheblich: Trotz der Minsker Abkommen von 2014 und 2015 setzte sich der Konflikt als Stellungskrieg mit sporadischen Gefechten fort. Bis 2021 hatte der Krieg mehr als 14.000 Menschen das Leben gekostet – darunter etwa 4.400 ukrainische Soldat*innen, 5.500 prorussische Kämpfer und rund 3.400 Zivilist*innen. In Kyjiw erinnert die Gedenkwand an den himmelblauen Mauern des Sankt-Michael-Klosters an die Opfer; sie erstreckt sich hunderte Meter um das halbe Kloster.
Die politische Landschaft der Ukraine zwischen 2014 und 2022 war geprägt durch die Präsidentschaften von Petro Poroschenko (2014-2019) und Wolodymyr Selenskyj (ab 2019). Beide Amtszeiten unterschieden sich in vielerlei Hinsicht. Poroschenko, der nach der Revolution der Würde ins Amt kam, konzentrierte sich auf den Kampf gegen die russische Aggression im Donbass und die Stärkung der ukrainischen Streitkräfte. Selenskyj, ein politischer Quereinsteiger, wurde 2019 mit dem Versprechen gewählt, die politische Szene zu erneuern. Er legte anfänglich großen Wert auf Friedensverhandlungen und Reformen zur Bekämpfung der Korruption. Während Poroschenko gegen Ende seiner Amtszeit von internationalen Beobachtern oft als nationalistisch wahrgenommen wurde, galt Selenskyj vor der russischen Invasion 2022 als eher moderater Präsident, der auf Dialog mit Russland setzte. Dennoch sahen sich beide Präsidenten ähnlichen Herausforderungen gegenüber – insbesondere im Hinblick auf den Konflikt im Donbass und die wirtschaftliche Stabilität des Landes. Angesichts der dramatischen Entwicklungen seit der Invasion 2022 erscheint der Poroschenko vorgeworfene Nationalismus heute eher als gesunde Selbsterhaltungspolitik.
Ein Krieg, der sich ankündigte und auf den keiner vorbereitet war
Bereits im Herbst 2021 begann Jean Asselborn, sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Gemeinsam mit seinen engsten internationalen Kollegen*innen versuchte er, auf mehreren EU-Gipfeln eindringlich vor einer Eskalation zu warnen. „Zu diesem Zeitpunkt war uns allen klar, dass sich die Lage dramatisch zuspitzt – mit Ausnahme der ‚üblichen Verdächtigen‘ innerhalb der EU“, erinnert sich Asselborn, wobei er unter anderem auf die ungarische Delegation anspielt. In dieser Phase intensivierte der Kreml seine Propaganda und versuchte mit aller Macht, die Welt davon zu überzeugen, dass Russland niemals in die Ukraine einmarschieren würde. Diese Behauptungen erschienen umso absurder, da Russland die Ukraine seit 2014 massiv destabilisierte, die Krim annektiert hatte und Teile der Ostukraine, insbesondere Luhansk und Donezk, besetzt hielt. Seit sieben Jahren beschossen russische und prorussische Kräfte nahezu täglich die ukrainischen Stellungen im Donbass mit Artillerie und Mörsern. Auch der Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 mit fast 300 Toten durch eine russische BUK-Rakete lag zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre zurück. Dennoch wurde in Europa kaum offen von „Krieg“ gesprochen – stattdessen redete man von Unruhen, Anti-Terror-Einsätzen, Auseinandersetzungen oder irreführend von einem Bürgerkrieg in der Ukraine.
„Jean, we need to talk!“
Im Dezember 2021 traf Jean Asselborn seinen russischen Amtskollegen Sergei Lawrow zum letzten Mal am Rande des OSZE-Ministertreffens in Schweden. Zu dieser Zeit versicherte Putin öffentlich, Russland werde niemals die Ukraine angreifen oder deren Souveränität verletzen. Der Ukraine-Konflikt dominierte das Treffen des OSZE-Ministerrats. Die westlichen Minister*innen verurteilten die fortwährenden Verletzungen des Völkerrechts durch Russland und den russischen Truppenaufmarsch in Belarus sowie in den russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk scharf. Auch Jean Asselborn warnte gemeinsam mit seinen europäischen Kolleg*innen, dass die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen ins Stocken geraten sei und die humanitäre Lage in den Konfliktgebieten zunehmend kritisch werde. Die OSZE und internationale Akteure machten unmissverständlich klar, dass Russlands Handlungen die europäische Sicherheit destabilisieren und internationales Recht brechen. Am Rande des Treffens zog Lawrow Asselborn beiseite und sagte: „Jean, we need to talk. You have to come to Moscow.“ Ein Treffen wurde vereinbart für den 14. Februar 2022, am Valentinstag, in der russischen Hauptstadt – doch dazu sollte es nie kommen. Bereits Ende 2021 mehrten sich die Anzeichen einer bevorstehenden russischen Aggression. „Wir erhielten zahlreiche Warnungen von offiziellen Stellen und mussten uns auf das schlimmste Szenario vorbereiten“, erinnert sich Asselborns luxemburgischer Kabinettskollege François Bausch. In den Wochen vor der Invasion schwand die Illusion vieler europäischer Staats- und Regierungschefs, dass ein Dialog mit Russland den Krieg noch abwenden könnte.

Mitte Januar 2022 erhielt Jean Asselborn ein geheimes Sicherheitsbriefing vom britischen Außenministerium und der britischen Botschafterin in Luxemburg, Fleur Thomas. Der Inhalt erschütterte ihn zutiefst: „Es wurde klar, dass Russland diesen Krieg unbedingt will. Sie trafen logistische Vorkehrungen, die nur im Kriegsfall notwendig sind.“ Die Briten berichteten, dass Russland Blutkonserven aus mehreren Großstädten an die Grenze zur Ukraine verlegte – ein eindeutiges Zeichen für bevorstehende Kampfhandlungen. Diese Informationen wurden auch von amerikanischen Geheimdiensten bestätigt. „Obwohl wir klare Hinweise hatten, versuchten einige Länder, darunter Deutschland, die Fakten anders zu deuten oder die Lage herunterzuspielen“, erklärt Asselborn.
Über informelle Kanäle suchte Asselborn den Kontakt zu bekannten SPD-Politiker*innen, darunter Dr. Rolf Mützenich, einem der prominentesten Putin-Versteher innerhalb der SPD, der sich im Verlauf des Krieges wiederholt kritisch über deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine äußerte. Jean Asselborn versuchte, die SPD-Kolleg*innen zu warnen, doch er stieß auf taube Ohren. Die estnische Premierministerin Kaja Kallas fasste Mützenichs Ansichten mit einem prägnanten Satz zusammen: „In einer Welt voller Gewalt wäre Pazifismus ein Akt des Selbstmordes.“
Als sich 2022 die Invasion ankündigt, wird auch Lawrow sich nur noch mit den abgestimmten Stichwörtern aus dem Kreml-Handbuch äußern: „Er war immer Diplomat, kannte die UN-Charta besser als jeder andere, konnte sie auswendig aufsagen und war immer gut darin, sich auf gemeinsame Werte zu berufen, um was zu erreichen. Aber damit war jetzt Schluss.“ Von einem Moment auf den anderen erzählte Lawrow auf einmal von „Nazis in der ukrainischen Hauptstadt“, „Banderisten“13 und es war ab diesem Zeitpunkt fast unmöglich, mit Lawrow zu reden, erinnert sich Asselborn. Ab diesem Moment war die russische Führung in einer anderen parallelen Realität unterwegs, abseits von Fakten und von klassischer Diplomatie: „Das muss man sich so vorstellen, als ob man auf einmal hört, dass ein guter Bekannter oder ein Arbeitskollege ein Mörder ist.“ Hinter den Kulissen ging die russische Propaganda sogar noch ein Stück weiter als vor den Kameras: „Lawrow sagte uns ganz offen: Das sind alle Nazis und weil es alle Nazis sind, gilt hier kein internationales Recht mehr!“ Auch andere russische Top-Diplomaten wie Alexander Wiktorowitsch Gruschko, ein von Luxemburg mit Medaillen ausgezeichneter Vize-Außenminister Russlands und Ständiger NATO-Vertreter in Brüssel war dann auf einmal wie ausgetauscht: „Menschen, mit denen man vorher ganz normal arbeitete, waren total realitätsfern“, bedauert Asselborn.
Seit der Invasion der Ukraine hat Jean Asselborn kein Wort mehr mit Sergei Lawrow gewechselt. „Ich habe alles darangesetzt, ihn nicht zu sehen“, fügt er entschlossen hinzu und bemerkt scharf: „Ja, das ist vielleicht keine rationale Außenpolitik, aber wenn man sieht, wie Ungarn und Russland sich gegenseitig Medaillen anheften, dann ist das doch einfach nur abstoßend!“ Nach zwanzig Jahren im Amt kann sich Asselborn nicht erinnern, je in einer solch chaotischen Zeit gelebt zu haben, in der internationales Recht derart mit Füßen getreten und außer Kraft gesetzt wird. „Deswegen sehe ich mit Putin an der Macht – oder solange er im Kreml ist – keinen Ausweg. Es ist unmöglich, das Verhältnis wieder zu normalisieren. Es gibt kein Vertrauen mehr, keine gemeinsame Basis und keine gemeinsamen Werte“, erklärt Asselborn entschieden. „Sie erinnern sich ja an meine Kommentare damals“, fügt er hinzu und spielt auf seine Äußerung im Jahr 2022 an, als er kurz nach der Invasion in einem Interview die physische Beseitigung Putins andeutete.

Für François Bausch markiert Russlands völkerrechtswidrige Invasion der Ukraine einen historischen Bruch in der Nachkriegszeit – und die größte Zerreißprobe für die Friedensordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden war. Die Vereinten Nationen bestehen laut Bausch aus einer Mischung von demokratischen und nicht-demokratischen Staaten, aber bisher hätten sich alle an die gleichen Grundprinzipien gehalten. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg werde dies nun durch Russlands Angriffskrieg infrage gestellt. Das Wichtigste dieser Prinzipien sei, dass Staatsgrenzen nicht durch Krieg verändert werden – auch wenn einige dieser Grenzen nach dem Zweiten Weltkrieg „künstlich“ gezogen wurden. „Das wurde immer respektiert“, betont Bausch und ergänzt: „Der fundamentale Unterschied zwischen den Interventionen der Russen oder der Amerikaner und dem Krieg gegen die Ukraine liegt darin, dass die Interventionen bislang aus ökonomischen Interessen geführt wurden – nicht aber, um Territorium zu erobern, zu halten und in das Land des Aggressors einzugliedern oder dort Scheinwahlen zu organisieren.“ Genau hier liege der entscheidende Unterschied, so Bausch. „Wir riskieren, eine der bedeutendsten Errungenschaften der Nachkriegszeit und des internationalen Rechts zu verlieren.“
Die Situation in der Ukraine und das aggressive Auftreten Russlands bereiten Bausch Kopfzerbrechen. Der ehemalige Verteidigungsminister analysiert gern komplexe geopolitische Zusammenhänge: „Russland ist ein riesiges Land, und man fragt sich oft, warum es sein Territorium weiter ausdehnen will, indem es seine Nachbarn angreift und annektiert“, erklärt Bausch. Er führt diese aggressive Expansionspolitik auf eine zentrale Überlegung zurück: „Fast 80 Prozent der russischen Bevölkerung lebt im westlichen Teil Russlands, quasi direkt vor der Haustür der Ukraine. Natürlich hat die russische Führung kein Interesse daran, dass ein so großes Land wie die Ukraine sich zu einem demokratischen Staat nach europäischem Vorbild entwickelt. Russland möchte verhindern, dass seine eigene Bevölkerung ‚nach drüben‘ blickt.“ Die eigentliche Bedrohung für das Regime sei die Demokratie, betont Bausch: „Der Kreml fürchtet, dass die russischen Bürger*innen sehen, wie sich ehemals sowjetisch besetzte Länder demokratisch und offen entfalten – das gilt ebenso für Georgien.“ Auch wenn die Ukraine noch weit von europäischen Standards entfernt sei, werde sie vom Kreml als direkte Gefahr wahrgenommen. Insbesondere, weil die ukrainische Zivilgesellschaft weiterhin nach einer noch demokratischeren und transparenteren Gesellschaft strebe.
Reaktionen
Danach ging alles sehr schnell, erinnert sich Jean Asselborn. Wenige Stunden nach den ersten Raketen auf ukrainische Großstädte bestand die erste große Herausforderung darin, sich um den Flüchtlingsstrom zu kümmern. Asselborn hatte Angst, dass es in dem damaligen Europa nicht offensichtlich war, dass sich jede Regierung direkt mit der Lage der Ukrainier*innen solidarisiert. Einerseits hatte die EU-Politik durch die Direktive 2001/55/EG14 des Rates vom 20. Juli 2001 einen Präzedenzfall geschaffen, um einen Mindeststandard im Falle einer massiven kriegsbedingten Migration zu gewährleisten. Andererseits gab es viele Bedenken, besonders aus denen an die Ukraine grenzenden Mitgliedstaaten: „Wir befürchteten, dass das Polen der PiS15 sich querstellt, aber die Stimmung in Polen kippte innerhalb eines Tages, sodass nichts mehr im Weg stand, sich zusammen mit den EU-Innenminister*innen um die zeitweise 3,3 Millionen Flüchtlinge zu kümmern.“ Asselborn verteidigt diese humanistische Herangehensweise und erklärt, diese erste Phase sei entscheidend gewesen, um schnellstmöglich Menschen in Sicherheit zu bringen. Asselborn begrüßt, dass sowohl die luxemburgische Regierung als auch private Akteure und wohltätige Organisationen einen der größten Flüchtlingsströme der Nachkriegszeit in Europa zusammen angegangen sind, um rapide und nachhaltige Lösungen zu finden. Fast zeitgleich jedoch fielen viele EU-Mitgliedstaaten in eine Art „Schockstarre“, als es darum ging, der Ukraine tatkräftig mit Waffen zu helfen: „Ich möchte jetzt keine Namen nennen, außer den bekannten wie Deutschland, aber in vielen Mitgliedstaaten herrschte direkt nach der Invasion ein Reflex, man solle keine Waffen in ein Kriegsgebiet liefern“, ruft Jean Asselborn sich ins Gedächtnis.

Erst im Mai 2022, auf dem informellen Gipfel in Berlin der NATO-Außenminister*innen16, kam es zu einem Umdenken hin zu mehr kohärenter militärischer Ukrainehilfe. Opposition gab es von Erdogan und Orbán, die durch ihren Außenminister Péter Szijjártó, respektive Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu vertreten waren – eine prinzipielle Opposition, die bis heute andauert und beide Länder immer wieder nutzen, um nationalpolitische Ziele und Agenden durchzuboxen. Laut Jean Asselborn hat vor allem die Dokumentation russischer Kriegsverbrechen im Norden von Kyjiw dafür gesorgt, dass es zu einem weiteren Umdenken in Europa kommt. „Borodjanka, Irpin, Bucha, all diese Kriegsverbrechen hatten wenigstens zur Folge, dass es breitere Mehrheiten für mehr Hilfe für die Ukraine gab!“
Bausch erklärt, dass sich weiterhin bei uns der Irrglaube hält, die europäischen Partner hätten am Anfang des Konfliktes im Alleingang der Ukraine geholfen: „Das ist Unsinn, es waren die Amerikaner, die von Anfang an der Ukraine geholfen haben.“ Die Sitzungen mit den EU-Minister*innen seien teils chaotisch gewesen, erinnert sich Bausch, und die Argumente verschiedener Länder waren es auch. „Wir haben in Luxemburg als Regierung, zwischen dem Verteidigungsministerium und der Armee entschlossen gehandelt. Von Anfang an haben wir die entbehrlichen Güter und Ressourcen unserer Armee aus eigenem Bestand direkt verschickt, und dann gingen wir ‚einkaufen‘ und besorgten Material für die Ukrainer*innen, was dringend gebraucht wurde“, so Bausch.

Auf den Ministertreffen gab es keinen Konsens, erinnert sich Bausch, vor allem die zentraleuropäischen und baltischen Länder „pushten“, um der Ukraine nach der Invasion mehr zu helfen. Bausch erinnert sich auch, dass sein schnelles Handeln von dem EU-Sicherheitsbeauftragten und Außenbeauftragten Josep Borrell in offiziellen Meetings kritisiert wurde: „Der wollte mir lauter Sachen und Absichten unterstellen“, erzählt Bausch kopfschüttelnd. Zu Beginn der Invasion zeigte sich die Uneinigkeit innerhalb der EU deutlich. Frankreich war unsicher in seiner Vorgehensweise und leistete teilweise verdeckte militärische Unterstützung. Deutschland war unentschlossen, die Bundesregierung zerstritten. „Wir haben über ein Jahr Zeit verloren, und als dann die Anfragen kamen, dass Europa eine Million Haubitzen-Geschosse liefern soll, haben wir das beschlossen, aber auf meine Frage hin an die Runde, ob wir das überhaupt hinbekommen, wusste keiner eine Antwort. Heute jedoch sind wir klüger und wissen, dass wir dabei gescheitert sind“, reflektiert Bausch.
Bausch und sein Team standen stets in direktem Kontakt mit der ukrainischen Botschaft in Brüssel und arbeiteten eng mit deren Team zusammen, wenn es um die Beschaffung militärischer Hilfe ging. „Ich habe den ehemaligen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow mehrmals getroffen, und wir hatten ein gutes Verhältnis. Unser Motto war nie ‚Räumt die Lager und Keller‘, sondern ‚Wir liefern das, was entscheidend ist und was die Ukraine wirklich braucht‘“, so Bausch. Leider hätten viele Länder nur „Überschuss“ oder veraltete Ausrüstung geliefert. Doch laut Bausch sei vor allem Qualität entscheidend, um der Ukraine durch moderne Technologie einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Luxemburg beschaffte beispielsweise 155 mm-Munition noch vor der gemeinsamen europäischen Initiative, worauf Bausch stolz ist: „Vom ersten Tag an, ohne eigene Rüstungsindustrie, haben wir mutig versucht zu helfen. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern die der ukrainischen Experten, die uns sagten, wenn alle von Anfang an so entschieden gehandelt hätten wie Luxemburg, wäre die Situation heute viel besser.“
„Vom ersten Tag an, ohne eigene Rüstungsindustrie, haben wir mutig versucht zu helfen.“
Der Krieg gegen die Ukraine habe Europa zwar endlich aufgerüttelt, aber wirklich aufgestanden seien die Europäer noch lange nicht, und der Weg sei noch weit. Das NATO-Ziel von 2 % des BIP für nationale Verteidigungsausgaben hält Bausch für irreführend: „Viel wichtiger ist, wofür das Geld ausgegeben wird und ob eine kohärente Strategie dahintersteht. Blindes Aufrüsten bringt nichts – das versteht inzwischen fast jeder.“ Er erinnert sich an Regierungstreffen im Jahr 2022: „Ich hatte freie Hand, bekam viel Rückendeckung und lieferte regelmäßig Updates. Doch einige Regierungsmitglieder taten sich schwer, ihre historischen Positionen aufzugeben, nach denen man mit Russland ehrlich verhandeln und Putin mit rationalen Argumenten überzeugen könne. Das war nicht als Vorwurf gemeint, aber ich war der Meinung, dass es dafür einfach zu spät war und alle vorherigen Versuche gescheitert waren.“ Diese Haltung änderte sich schnell, als Russland die diplomatischen Bemühungen konsequent abblitzen ließ.
Bausch kritisiert jene, die weiterhin fordern, keine Waffen an die Ukraine zu liefern: „Es ist egoistisch und naiv, sich der Verantwortung zu entziehen und zu sagen, man wolle nicht helfen. So funktioniert Solidarität nicht!“

Heute im zehnten Jahr nach der ersten Kriegshandlung auf der Krim beklagt die LUkraine ASBL das Ausbleiben starker militärischer Unterstützung, sowohl in Luxemburg als auch in anderen Ländern. „Die neue luxemburgische Regierung hat viel versprochen, aber sie muss noch liefern, um das Niveau der vergangenen Jahre zu erreichen“, so die Organisation. Ein besonders bitteres Beispiel sei die von der NATO versprochene Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen nach dem Angriff auf das Kinderkrankenhaus Ochmatdyt im Juli – doch den Sommer über wurde nichts geliefert, obwohl die Systeme einsatzbereit seien.
Die langsame Lieferung militärischer Hilfe macht es Russland leicht, weiter unschuldige Menschen in der Ukraine zu töten. „Am Ende geht es darum, so viele Menschenleben wie möglich zu retten.“ Zudem hätten einige NATO-Partner aus Zentral- und Osteuropa begonnen, ihre Militärhilfe zu verringern und stattdessen in ihre eigenen Verteidigungskapazitäten zu investieren. „Das ist ein Denkfehler“, sagt Nicolas Zharov. „Man kann die eigene Verteidigung nicht stärken, ohne der Ukraine zu helfen. Die Kursk-Inkursion der Ukraine zeigt, wie man Ressourcen klug einsetzen und die Aktion zum Feind hin verlagern kann.“
Zharov ist überzeugt, dass dieser Krieg weit von einer friedlichen Lösung entfernt ist. „Viele glauben noch immer, dass der Krieg gegen die Ukraine durch Diplomatie beendet werden kann, doch Russland hat kein Interesse an einer diplomatischen Lösung – es will die Zerstörung der Ukraine.“ Für den humanitären Helfer und mittlerweile führenden Lobbyisten der Ukraine in Luxemburg ist es unverständlich, dass man im dritten Kriegsjahr weiterhin so naiv mit dem russischen Imperialismus umgeht. „Im Krieg geht es um comparative advantages“, betont Zharov. Eine Schlüsselkompetenz Luxemburgs liege in der Satellitenüberwachung und -kommunikation, die der Ukraine bei offensiven Operationen und der Abwehr russischer Raketen- und Drohnenangriffe womöglich helfen könnte. Wenn die Partner der Ukraine in Europa ihre comparative advantages nicht einbringen, werde es äußerst schwierig, den Krieg ohne massive Verluste auf ziviler und militärischer Seite zu beenden. Er fordert mehr Engagement und einen stärkeren Einsatz von Luxemburg und anderen Ländern, um der Ukraine in dieser kritischen Phase beizustehen. Trotzdem ist die LUkraine Organisation sehr dankbar für jede gelieferte Hilfe an die Ukraine und weiß das große Engagement Luxemburgs zu schätzen.
Wenn Krieg zum Alltag wird
Der Präsident der LUkraine ASBL ist der Meinung, dass für die Mehrheit der Menschen heutzutage ein Krieg in ihrer Heimat oder auf ihrem Kontinent unvorstellbar ist. Auch die Presse spielt für ihn eine entscheidende Rolle: Sie kann dazu beitragen, dass die europäische Bevölkerung die Gefahr erkennt, die von Russlands Kriegen ausgeht. „80 Jahre ohne Weltkrieg, 30 Jahre ohne Krieg auf dem Balkan – die Menschen vergessen schnell, wie es ist, wenn der Krieg tobt, und es ist für sie unvorstellbar“, erklärt Zharov. „Wir Ukrainer sprechen aus bitterer Erfahrung, denn auch wir konnten uns vor 2014 nicht vorstellen, dass so etwas geschehen könnte. Dann griff Russland an und aus Frieden wurde über Nacht Krieg.“
„80 Jahre ohne Weltkrieg, 30 Jahre ohne Krieg auf dem Balkan – die Menschen vergessen schnell, wie es ist, wenn der Krieg tobt, und es ist für sie unvorstellbar.“
Deshalb sei es so wichtig, sich auf alle möglichen Szenarien vorzubereiten. „Selbst in Ländern wie Polen oder im Baltikum, wo die Bevölkerung besser vorbereitet ist als in Westeuropa, ist man noch weit von einer angemessenen Vorbereitung auf den Ernstfall entfernt.“ Für Zharov könnte dieser Ernstfall bald eintreten und auch die NATO könnte durch Russland in den Konflikt hineingezogen werden. „Es liegt allein in Russlands und Putins Händen und wenn es so weit kommt, bedeutet das auch, dass luxemburgische Soldatinnen und Soldaten in den Krieg ziehen müssten.“

Krieg, Frieden, Vergebung und Diplomatie
Oft glauben oder hoffen wir, dass Feindseligkeiten durch Mediation oder einen Waffenstillstand beendet werden könnten – doch diese Annahme basiert auf einer trügerischen Wahrnehmung. Kriege enden meist nicht am Verhandlungstisch, sondern durch Entscheidungen und Situationen auf dem Schlachtfeld. Beispiele dafür gibt es viele, etwa die Kapitulation Nazi-Deutschlands infolge einer militärisch ausweglosen Lage, als die Alliierten an der Elbe standen und die Sowjettruppen Berlin besetzten, oder der Rückzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan, wo der Konflikt sowohl militärisch als auch ökonomisch nicht mehr tragbar war. Danach erst kommen Verhandlungen. Nicolas Zharov teilt diese Einschätzung und fügt hinzu: „Die Ukraine kämpft seit 2014 gegen einen unerbittlichen Feind, der internationale Verträge bricht, Abkommen missachtet und sich an keinerlei Regeln hält. Verhandlungen gestalten sich in solchen Fällen äußerst schwierig.“ Die Arbeit seiner Organisation sei daher eine direkte Antwort auf die Gräueltaten der russischen Armee. „Unser Gegner will zerstören und möglichst viele Menschenleben auslöschen, während wir versuchen, Menschen zu retten. Wir sehen keine Verhandlungsangebote der Russen.“ Die Mitglieder seiner Vereinigung wollen sich mit ihrem Engagement für das Überleben der Ukraine und der Zivilbevölkerung einsetzen: Seit der russischen Sprengung des Staudamms von Nowa Kachowka im Sommer gräbt die Organisation in der Region Cherson Brunnen, um den Zugang zu sauberem Wasser sicherzustellen, da fast eine Million Menschen in den Frontgebieten seither ohne Trinkwasser auskommen müssen. An der gesamten Frontlinie evakuieren sie Siedlungen, die unter ständigem Beschuss stehen. Mehrere militärische Quellen lobten die Organisation aus Luxemburg und betonten, dass ohne LUkraine die Evakuierungen in verschiedenen Siedlungen des Donbass nicht gelungen wären. Zudem liefert die Organisation Feuerwehr- und Krankenwagen an die Front, stattet Kliniken aus und kümmert sich um Binnenvertriebene und gefährdete Personen. Die ASBL investiert ihre Spendengelder auch in militärische Unterstützung. „Wir haben die Möglichkeit, Teile der Gelder in militärische Projekte zu geben, und tun dies, wenn die Spender*innen es ausdrücklich erlauben“, versichert Zharov. Die Projekte der Organisation zeigen das Ausmaß des Krieges und verdeutlichen, wie weit wir vom Frieden entfernt sind.
Im Juli stehe ich im Stadtpark von Irpin, dem zerstörten Vorort nördlich von Kyjiw. An einem heißen Samstagmorgen pflanzen die Kinder der Vorschule Bäume für ihre Klassenkameraden, die bei der Bombardierung und Besetzung Irpins getötet wurden. Es sind 25 Bäume, jeder benannt nach einem Kind. Die LUkraine ASBL hat an diesem Projekt mitgewirkt und mehrere der Bäume gestiftet. Doch nach der Zeremonie stelle ich mir still die Frage: Wird es jemals Vergebung und Verzeihung geben? Und wie kann diese traumatisierte Gesellschaft, von der fast jeder betroffen ist, jemals heilen? Als die letzten Bäume gepflanzt sind, ertönt erneut ein Luftalarm – doch niemand reagiert.
Asselborn ist stoisch und atmet einmal tief durch. Ja, es braucht Diplomatie, aber auch Waffen und Unterstützung für die Ukraine. „Denn die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Putin muss direkt oder indirekt einsehen, dass dieser Konflikt mit militärischen Mitteln für Russland nicht zu lösen und zu gewinnen ist.“ In diesem Prozess der militärischen Unterstützung für die Ukraine dürfe man mit der Diplomatie trotzdem nicht nachlassen. Sobald die russische Verhandlungstür auf ehrliche Weise sich vielleicht nur fünf Zentimeter öffnet, müssen wir alles tun, um gemeinsam auf Augenhöhe zu verhandeln, so Asselborn. Hier kann und muss Europa vorne mitspielen, weil wir „in einer Welt leben mit einer geschwächten UN und einem ‚blockierten‘ Weltsicherheitsrat“.

„Natürlich muss man verhandeln“, meint auch Bausch energisch, aber wie? Man kann keine Friedensverhandlungen führen, während ein Land versucht, ein anderes zu zerstören. Friedensverhandlungen kommen erst ab dem Punkt, wo Russland ein für alle Mal einsieht, dass es militärisch nicht weiterkommt. „Im Moment denken die Russen, der Krieg sei militärisch zu gewinnen, doch das kann sich schnell ändern, indem man die Ukraine unterstützt“, so Bausch. „Angriffskriege enden immer so“, meint Bausch, „jene, die aggressiv versuchen, andere Länder zu unterwerfen, ziehen sich zurück oder kommen an den Verhandlungstisch, wenn sie militärisch geschlagen sind, oder merken, dass militärisch nichts mehr zu gewinnen ist“, so Bausch. Wenn uns noch irgendetwas an der Charta der UN liegt, muss dieser Krieg enden. Der einfachste Weg wäre, dass Russland sofort seine Truppen abzieht, meint Bausch. Für den grünen Politiker ist die Krim womöglich das größte Problem bei späteren Verhandlungen: „Die Krim wurde seit 2014 durch die Besatzer russifiziert, es wird schwer werden, hier Auswege zu finden, ob mit Pufferzonen, entmilitarisierten Zonen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass es diesbezüglich seitens der Ukraine kleine Verhandlungsouvertüren gibt, auf jeden Fall viel mehr als auf russischer Seite.“ Je länger dieser Krieg andauert und man der Ukraine nicht dabei hilft, den Krieg zu gewinnen, desto größer sei jedoch die Gefahr einer innenpolitischen Erosion in Europa. Russland fördert und unterstützt gerade dieses Szenario aktiv mit seiner Propaganda.
Wenn uns noch irgendetwas an der Charta der UN liegt, muss dieser Krieg enden.
Russland beginnt allmählich zu begreifen, dass es trotz seiner petrochemischen Ressourcen nicht den globalen wirtschaftlichen Einfluss besitzt, den es sich erhoffte, meint der ehemalige Minister. Er betont: „Die Welt kann ohne Russland wirtschaftlich überleben, aber Russland nicht ohne die Weltwirtschaft. Derzeit hält China die russische Wirtschaft am Leben – ohne China wäre es schnell vorbei.“ Bausch äußert deutliche Kritik an Peking. Die Unterstützung Russlands sei ein strategischer Fehler, der Chinas diplomatisches Gewicht schwäche. Zwar habe China kein direktes Interesse am Krieg in der Ukraine, doch solange Europa und die USA dort gebunden seien, habe Peking im Pazifikraum freie Hand, seine eigenen Ziele zu verfolgen, so Bausch. Diese Situation käme dem chinesischen Regime insgeheim entgegen.
Auch in Russland sei die Moral am Boden, erklärt Bausch weiter. Daher investiere Russland alles in eine neue Offensive im Donbass. Eine militärische Niederlage dort könnte verheerende Folgen haben, auch für den Kreml, der weiterhin Angst vor Protesten und Aufständen habe. Die Sanktionen beginnen ihre Wirkung zu zeigen und in den kommenden Monaten werden immer mehr Russen die wirtschaftlichen Folgen spüren. Die hohen Verluste unter russischen Soldaten verschärften die innenpolitische Lage zusätzlich. Dies ändert aber wenig an der russischen Taktik, die ukrainische Bevölkerung mit potentiellen Kriegsverbrechen tagtäglich zu terrorisieren. Russland setzt seine Angriffe auf das ukrainische Energienetz und auf Städte mit Gleitbomben und Marschflugkörpern fort. Russland tötete im August 2024 fast 1.000 Zivilist*innen – einer der blutigsten Monate seit Kriegsbeginn.

In der Ukraine, sowohl beim Militär als auch bei zivilen Helfern, werde ich oft gefragt: „Hat der Westen eine Strategie, um der Ukraine zum Sieg über Russland zu verhelfen? Warum kommt die militärische Hilfe so spät und oft so spärlich? Wo bleiben die versprochenen Lieferungen?“ Es ist ein beschämendes Gefühl und man findet oft keine Antwort. Nicolas Zharov kennt das Problem. Die „Sommeroffensive“ 2023 sei ein gutes Beispiel dafür, wie der Westen der Ukraine „hilft“: Die europäischen und transatlantischen Partner hätten von der Ukraine militärische Erfolge gefordert, ohne das nötige Material bereitzustellen, um diese Ziele zu erreichen. „Es kam, wie es kommen musste“, erklärt Zharov, „die Offensive scheiterte, weil die Planungen und Konzepte nicht in Kyjiw, sondern in Washington und Brüssel entwickelt wurden. Es war eine politische, keine militärisch-strategische Operation. Der bisherige Held der ukrainischen Verteidigung, General [Walerij] Saluschnyj, einstiger Held der ersten Stunde der Invasion, wurde daraufhin abgesetzt.“
Zharov ist überzeugt, dass die Ukraine nur durch asymmetrische Vorstöße und Strategien eine Chance hat, die Atommacht Russland zu besiegen. Doch er zweifelt daran, dass der Westen eine nachhaltige und ganzheitliche Strategie verfolgt.
Zharov ist überzeugt, dass die Ukraine nur durch asymmetrische Vorstöße und Strategien eine Chance hat, die Atommacht Russland zu besiegen. Doch er zweifelt daran, dass der Westen eine nachhaltige und ganzheitliche Strategie verfolgt. „Russland kann weiterhin seine überteuerten fossilen Energieprodukte verkaufen, es gibt zu viele Schlupflöcher. Mit diesen Einnahmen hat Russland seine Kriegswirtschaft ausgebaut, während in Europa weiterhin darüber gestritten wird, ob die Ukraine die russischen Flughäfen angreifen darf, von denen jede Nacht Raketen auf ukrainische Zivilisten abgeschossen werden.“
Die Front zu Hause
Auf die Frage, ob Russland in Luxemburg aktiv sei, antwortet Nicolas Zharov mit klaren Worten: „Ja, Russland ist ein Feind Luxemburgs, der hier intensiv agiert und über diverse Netzwerke versucht, Einfluss zu nehmen.“ Zharov betont jedoch, dass seine Organisation weder Polizei noch Gericht sei, sondern lediglich verdächtige Aktivitäten an die Behörden weiterleiten könne: „Wir übermitteln natürlich Informationen über Firmen und Personen und melden verdächtige Vorfälle“, so Zharov weiter. Russland nutze die kleinsten Fehler und Schwächen, denn „Russland versteht nur Macht und Stärke“. Es reiche nicht, die richtigen Schlüsse zu ziehen oder Reden zu halten – es gehe darum, diese auch in die Tat umzusetzen, erklärt der Luxemburgisch-Ukrainer. Es gehe dabei nicht nur um den Krieg gegen die Ukraine, sondern um den schleichenden Abbau der Demokratie, der liberalen Werte und der Rechtsstaatlichkeit im Westen.
Russland sei in Luxemburg auch durch Soft-Power-Diplomatie äußerst aktiv: „Im INL [Institut national des langues] werden seit kurzem Russisch-Kurse angeboten, während Russland gleichzeitig eine andere Kultur zerstört. Auch russischsprachige Theaterstücke und Comedy-Shows werden in Luxemburg aufgeführt – all das ist Teil der russischen Einflussnahme.“ Interessanterweise finden jene kulturellen Veranstaltungen in vom luxemburgischen Kulturministerium unterstützten Häusern statt. Viele dieser Shows werden vom Centre culturel et scientifique de Russie in Luxemburg mit organisiert. Das Institut wird von Rossotrudnitschestwo finanziert. Die russische Regierungsorganisation ist unter dem Deckmantel der kulturellen Zusammenarbeit tätig und verbreitet dabei gezielt russische Propaganda im Ausland. Sie fördert russische Soft-Power und steht im Verdacht, die außenpolitischen Interessen des Kremls zu unterstützen. Rossotrudnitschestwo steht seit 2022 auf der Sanktionsliste der EU.

© Philippe Schockweiler
Zharov betont, dass keine Hintertüren offen bleiben dürfen, durch die russische Unternehmen und Start-ups nach Luxemburg gelangen könnten. Da es keinen globalen Einreisestopp für russische Staatsangehörige gebe, fehle auch in Luxemburg die notwendige Kontrolle. „Solange Wege nach Moskau führen, gibt es auch Wege, über die russischer Einfluss und Propaganda zu uns gelangen“, erklärte er im Gespräch. Die Beziehungen zwischen Luxemburg und Russland seien vor allem wirtschaftlicher und privater Natur. Ob es sich dabei um gezielte Geheimdienstoperationen oder sogenannte „nützliche Idioten“ handle, könne Zharov nicht mit Sicherheit sagen. „Ich denke, es läuft hauptsächlich über die vielen Verstrickungen und Verbindungen, die über Jahre hinweg zwischen Moskau und Luxemburg entstanden sind. In diesen halboffiziellen Kanälen werden weiterhin Politik und Geschäfte gemacht, da private Beziehungen nicht von den Sanktionen betroffen sind.“
Diese historischen Verbindungen haben es für Ukrainerinnen und Ukrainer in Luxemburg jahrelang schwer gemacht, ihre Geschichte zu erzählen, ohne dass ihre Realität durch russische „Talking points“ infrage gestellt wurde. Zharov sieht darin den Erfolg der russischen Propaganda, die es geschafft habe, westliche Eliten die Ukraine durch die Brille des russischen Imperialismus sehen zu lassen. Erst 2023 erkannte Luxemburg den Holodomor als Genozid an. Frühere Versuche von Zharov und der LUkraine ASBL scheiterten: „Vor knapp acht Jahren bekamen wir die Antwort, der Holodomor sei kein Genozid, sondern lediglich stalinistische Misswirtschaft gewesen. Das war erschreckend, obwohl Historikerinnen und Historiker weltweit sich einig sind. Viele glauben immer noch, Russland und die Ukraine seien Bruderstaaten im Streit, nein. Russland versucht nun bereits zum dritten Mal in 200 Jahren, die Ukraine auszulöschen.“
Der Finanzsektor war lange ein Einfallstor für russisches Geld und Investitionen in Luxemburg. Laut Bausch habe das Land es in den letzten Jahren versäumt, sich unabhängigere und nachhaltigere wirtschaftliche Standbeine zu schaffen, um die Abhängigkeit des Finanzsektors von Steuereinnahmen zu verringern. „Deshalb hat Luxemburg sich historisch oft in dunkele Nischen im Finanzsektor begeben, in die es besser nicht hätte gehen sollen“, erklärt Bausch. Doch in den letzten Jahren habe das Land begonnen, sich aus dieser problematischen Position zu befreien. Für Bausch sind die Sanktionen gegen Russland richtig und notwendig, und er fordert eine Ausweitung dieser Maßnahmen: „Während meiner Zeit in der Regierung gab es keinen Widerstand gegen die Sanktionen.“
Europäische Integration ja, aber …
Jean Asselborn gilt als klarer Unterstützer der Ukraine und hat sich stets für die Integration des Landes in die EU starkgemacht. Doch inzwischen blickt er etwas kritischer auf die Zukunft der Ukraine in der Europäischen Union: „Natürlich müssen die Ukraine und Moldau in die EU, und bei Moldau könnte das sogar relativ schnell gehen. Aber bei der Ukraine wäre ich im Moment vorsichtiger.“ Asselborn betont, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer ein klares Signal benötigen, doch er hält es für falsch, bereits ein festes Datum für den Beitritt zu nennen. Präsident Selenskyj fordert, dass der Beitritt innerhalb der nächsten fünf Jahre geschehen soll.

© Philippe Schockweiler
Nicolas Zharov, Präsident der LUkraine ASBL, sieht genau hier den Denkfehler vieler europäischer Politikerinnen und Politiker. „Die russischen Angriffe auf unser Land sind keine bloße Statistik – es geht um Menschenleben, um die Zukunft unseres Landes und unserer Kinder“, erklärt Zharov. „Deshalb engagiere ich mich. Der Ansatz der europäischen Politik mag oft richtig sein, doch es mangelt an der Umsetzung.“ Für Zharov ist klar: Ein Beitrittsdatum in ferner Zukunft würde nicht nur in Kyjiw, sondern auch in Moskau registriert werden – und der Kreml würde alles daran setzen, dies zu verhindern, wie schon in den vergangenen 20 Jahren.
Asselborn warnt zudem, dass der Westen dabei sei, Georgien an Russland zu verlieren: Prorussische Kräfte seien dabei, die georgische Demokratie systematisch zu untergraben und einen Keil zwischen Georgien und den Westen zu treiben. „Russland macht nichts ohne Hintergedanken, und was wir derzeit in Georgien sehen, ist genau das, was Russland vor zehn Jahren in der Ukraine getan hat“, so Asselborn. Diese Ansicht teilen viele Politikerinnen und Politiker der Europäischen Union. In der Ukraine kennt man diese Argumente nur zu gut – sie kursieren seit fast 20 Jahren, doch die Geschichte hat gezeigt, was passiert ist.
Ich muss dabei immer an den jungen Studenten denken, vom Anfang der Geschichte, der mich vor 19 Jahren in einer Kyjiwer Diskothek umarmte, mir die Wange küsste und mit mir auf die baldige EU-Mitgliedschaft der Ukraine anstoßen wollte. Wie es ihm wohl heute geht? Was er wohl macht?

Asselborn reflektiert offen über die Rolle der EU, der Kommission und der NATO gegenüber der Ukraine und gesteht Fehler ein: „Wir haben keine Glaskugel, aber im Nachhinein ist man immer schlauer.“ Asselborn jedoch ist von dem Mut der Ukrainer*innen berührt: „Dieser Wille, diese Sehnsucht nach Demokratie und Eigenständigkeit, macht die Ukraine so einzigartig. Es ist ein Merkmal ihrer Demokratie und ich denke dabei oft an unseren eigenen Freiheitskampf als Europäer vor 80 Jahren.“
Bausch bedauert, dass in unserer heutigen Zeit häufig die feinen Unterschiede verloren gehen. Für den grünen Politiker ist die Welt heute oft nur noch schwarz oder weiß und jeder müsse sofort eine Position beziehen. „Ich unterstütze die Ukraine, auch mit Waffenlieferungen, obwohl es in der Ukraine weiterhin Probleme in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit gibt. Doch diese beiden Tatsachen schließen sich nicht aus – die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung.“ Bausch kritisiert, dass solche Differenzierungen häufig untergehen, egal ob es um die Ukraine, die USA, China oder Russland geht. Besonders tragisch sei, dass durch dieses Blockdenken und eine hochmütige Haltung Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden.
Luxemburgische Hilfe vor Ort
Humanitäre Helfer aus Luxemburg im Donbass
Philippe Jacob und Grégory Fonseca sind beide momentan in der Ukraine, um zu helfen. Die beiden jungen Männer nutzen jede freie Minute, um sich zu engagieren und Menschen in Not zu evakuieren.
Sein Pass ist mittlerweile voll mit Stempeln aus der Ukraine. Wenn man ihn fragt, wie oft er drüben war, so muss er erst mal nachrechnen.
Philippe Jacob, Jahrgang 1993, Student an der ULB in Brüssel, ist einer der wenigen Luxemburger, die sich freiwillig in der Ukraine als humanitäre Helfer engagieren. Sein Pass ist mittlerweile voll mit Stempeln aus der Ukraine. Wenn man ihn fragt, wie oft er drüben war, so muss er erst mal nachrechnen. „Ich war seit 2022 über ein Dutzend Mal in der Ukraine zum Helfen“, schätzt der junge Luxemburger.

Sein erster Stempel im Pass datiert Ende Februar 2022. Als die Invasion anfing, sind wir beide zur gleichen Zeit in die Ukraine aufgebrochen. Genau wie ich machte sich Philippe Jacob damals erst einmal ein Bild der Situation an der polnisch-ukrainischen Grenze und war betroffen von den kilometerlangen Flüchtlingsströmen. Es sind Bilder, die man schwer vergisst. Während ich dokumentiere, hilft Philippe Jacob tatkräftig mit, zuerst bei den Kolleg*innen von Caritas Polen in dem Grenzstädtchen Przemyśl. Schnell knüpft er Kontakte mit Caritas-Spes, dem ukrainischen Ableger und bekommt eine Stelle als Volontär in Lwiw, in einem der größten humanitären Lager der Ukraine: „Hier habe ich mich vor allem um Logistik gekümmert, Fahrten organisiert und auch ausgeholfen, damit die aus dem Ausland verschickte Hilfe schnell und effizient an ihre Zielorte ‚dispatched‘ werden kann“, erinnert sich Jacob. In der Nacht des 19. September 2023 wurde dieses Lager, welches sich knapp 80 km östlich der Grenze der EU befindet, mitsamt knapp 300 Tonnen humanitärem und medizinischem Hilfsgut von russischen Raketen vollkommen zerstört. Es ist wie so oft eine jener Horrorgeschichten, die sich ins Gedächtnis der Ukrainer*innen und der internationalen Helfer*innen eingebrannt hat, aber bei uns im Westen Europas schnell in Vergessenheit gerät. Philippe Jacob zieht es danach weiter nach Kyjiw, wo er neue Projekte mit organisiert. Im Sommer 2022 arbeitet er mit Caritas-Spes und anderen Hilfsorganisationen, um die Vorstädte um Kyjiw medizinisch zu versorgen. Zu jener Zeit steigt noch immer Rauch aus den Ruinen nördlich der Hauptstadt und viele Menschen sind ohne ein Zuhause. Tausenden fehlt der Zugang zu Trinkwasser und Strom. Philippe Jacob fährt alle zwei Tage mit der amerikanischen Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) in diese Städte und verteilt dort Essen. Des Weiteren liefert er mit der Caritas medizinisches Material an die mobilen Kliniken, welche schnell in den Regionen um Kyjiw aufgebaut werden, weil sehr viele Gesundheitszentren und Spitäler zerstört wurden. Diese Kliniken werden zu wichtigen Strukturen für die Millionen von intern vertriebenen Menschen (IDPs) innerhalb der Ukraine.
Er belädt eine gespendete Ambulanz nach der anderen mit Bandagen, Medikamenten und medizinischem Gerät und fährt dann direkt ins Krisengebiet bei Nikopol oder Pokrowsk.

Im Herbst 2022 verschlechtert sich die Lage in der Ukraine und Russland beginnt mit seiner perfiden militärischen Kampagne, um die zivile Energieinfrastruktur zu zerstören. Philippe Jacob startet ein Projekt zusammen mit der Caritas Luxembourg, „Power for Medics“, um Kliniken mit Notstromgeneratoren auszustatten. Im Rahmen dieses Projektes knüpft er neue Kontakte zu Militärmediziner*innen: „In den militärischen Krankenhäusern in der Ukraine gibt es enormen Bedarf an humanitärer und medizinischer Hilfe. Deshalb haben wir uns damals entschlossen, auch den Militärkrankenhäusern in Saporischschja und Pokrowsk zu helfen.“ Als er mit seinem Lieferwagen Luxemburg in Richtung Ukraine verlässt, bricht zufälligerweise gleichzeitig ein 16 Wagen starker Konvoi der Organisation LUkraine auf. Jacob schließt sich dem Konvoi ausrangierter Ambulanzen und Feuerwehrwagen des Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) an. Weihnachten 2022 verbringt er im Donbass. Er erinnert sich noch gut daran, wie vorsichtig er damals mit seiner fragilen Fracht im Donbass fuhr, aus Angst, diese zu beschädigen. Heute muss er darüber schmunzeln: „Die gleichen Straßen benutze ich heute bei Evakuierungen und wir brettern mit 100 oder 110 Sachen über diese schlechten Straßen, weil wir immer wieder von russischen Drohnen geortet und verfolgt werden“, lacht er. 2023 verstärkt er seine Zusammenarbeit mit der LUkraine ASBL und nutzt ihre guten Kontakte zu luxemburgischen Kliniken, um noch mehr medizinische Hilfsgüter in die Ukraine zu liefern. Wegen der andauernden russischen Angriffe auf Kliniken und Gesundheitszentren fehlt es an dem Notwendigsten in den ukrainischen Krankenhäusern an der Front: Sterilisationsstationen werden gebraucht und Jacob hilft dabei, diese Lücken zu schließen. Das Jahr 2023 verbringt er jede freie Minute in der Ukraine: Er belädt eine gespendete Ambulanz nach der anderen mit Bandagen, Medikamenten und medizinischem Gerät und fährt dann direkt ins Krisengebiet bei Nikopol oder Pokrowsk. Mittlerweile hat er sich durch sein Engagement einen Namen in der Ukraine gemacht. Jacob kennt das Klinikpersonal und chirurgische Leiter*innen aus den meisten Kliniken an der Front. Er lernt auch die humanitäre Organisation Road to Relief kennen, die sich um die Evakuierung von Zivilisten aus gefährlichen Gebieten und die Bereitstellung von Nothilfe kümmert. Dort macht er Bekanntschaft mit „Tonko“ und der spanischen Freiwilligen „Emma Igual“. Ihre Freunde beschreiben sie als eine Naturgewalt, die Berge bewegt. Zusammen bringen sie und Jacob medizinisches Material von Kyjiw nach Slawjansk an die Front. Sie werden Freunde. „Ja, und dann geschah es“, erzählt Jacob traurig. Am 11. September 2023 kam ein Fahrzeug der Road to Relief Organisation vor Bachmut unter russischen Beschuss. Eine russische Panzerabwehrrakete (ATGM) traf gezielt den Wagen, welcher sich überschlug und in Flammen aufging. „Tonko“ und „Emma“ starben auf der Stelle. Philippe Jacob ist ein zäher Brocken, aber definitiv kein Draufgänger und der Tod der beiden beschäftigt ihn immer noch. Die Helfer*innen in der Ostukraine kennen sich alle untereinander, man begegnet sich regelmäßig, steht in engem Kontakt. Der Verlust einer Kameradin wie „Emma“ trifft diese kleine Community tief.
Die schwierigsten Evakuierungen werden von lokalen NGOs unter Leitung und Koordinierung der ukrainischen Polizei und Streitkräfte durchgeführt.

© Grégory Fonseca
Philippe Jacob gibt aber nicht auf. Der Tod der Kameradin spornt ihn an, weiterzumachen, auch im Namen all jener, die nicht mehr nach Hause kommen. Er versucht durchgehend, die Situation zu evaluieren und schaut, wo er am meisten gebraucht wird. Mittlerweile hat er sich auf Evakuierungen in der Ostukraine spezialisiert. Hier gibt es verschiedene Gefahrenlevel: „Die ganz einfachen Evakuierungen macht man mit einem Shuttlebus, da fährt man in eine Siedlung rein, holt Kinder oder ältere Menschen ab und bringt sie dann in Sicherheit.“ Natürlich besteht auch hier die Gefahr durch Artillerie oder durch Raketen, aber man ist weiter von der Front weg. Dann gibt es aber auch spezialisierte Gruppierungen wie die White Angels, eine Spezialeinheit der ukrainischen Polizei, die mit gepanzerten Lieferwagen oder umfunktionierten Geldtransportern Menschen aus sogenannten „hot zones“ evakuieren. Laut ihm sind viele der freiwilligen ukrainischen Helfer verwundete Ex-Soldat*innen, welche jetzt hier helfen. Die schwierigsten Evakuierungen werden von lokalen NGOs unter Leitung und Koordinierung der ukrainischen Polizei und Streitkräfte durchgeführt. „Hinter der sogenannten 2. Linie operieren keine ausländischen NGOs mehr, man sieht fast keine großen Hilfsorganisationen, hier wenige Kilometer vor der Front“, erklärt Philippe Jacob. In der Tat hat auch das Rote Kreuz sich temporär zurückgezogen, weil ihr Lager in Konstantinowka bombardiert wurde. Wenn man den letzten Checkpoint des SBU, des ukrainischen Inlands Sicherheitsdienstes erreicht, muss man auf einer Liste von akkreditierten Hilfsorganisationen stehen. „Die Soldaten salutieren und wünschen einem dann immer ‚udachi!‘ (ukrainisch ‚Viel Glück‘), und dann weiß man, dass es in eine schwierige Mission geht“, so der freiwillige Helfer aus Luxemburg. In diesen Zonen herrscht eigentlich die ganze Zeit akute Gefahr, über den Köpfen der Helfer patrouillieren Drohnen, ukrainische und russische. „Wenn wir eine Orlan [russische Aufklärungsdrohne] sehen, dann müssen wir aufs Gas drücken!“, erklärt Jacob. Hilfe gibt es in diesen heißen Zonen nur noch von der Polizei und von den Streitkräften. „Wir sind keine Cowboys, wir werden vom Militär gebrieft, haben aktualisierte Karten, wissen, wo die Russen stehen und halten uns an die Sicherheitsvorgaben, alles andere wäre zu gefährlich und würde uns und alle anderen Beteiligten in Gefahr bringen!“, erläutert er. Bei einer rezenten Evakuierung in Myrnohrad kommen sie unter Artilleriebeschuss und er und sein Team müssen Schutz suchen. In solchen Situationen warnen sie dann auch andere Helfer, die auf dem Weg in das gleiche Gebiet sind, damit die nicht in ein Feuergefecht fahren. Empathie ist die wichtigste Voraussetzung, die man mitbringen muss: „Wenn wir in die Dörfer kommen, treffen wir vor allem auf traumatisierte Kriegsopfer. Wir ziehen dann die Westen und Helme aus, um den Menschen zu begegnen und uns mit ihnen zu unterhalten. Mitgefühl zeigen, Ruhe bewahren und den Menschen Hoffnung geben sind Voraussetzungen, um mit den Menschen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen“, erklärt er.
Ein Wettlauf gegen die Zeit: mit der Ambulanz an die Front und zurück
Grégory Fonseca, 29, ist Jurastudent an der Uni Luxemburg und hat sich schon immer für andere Menschen engagiert. Mit der ASBL Eran, eraus … an elo? setzt er sich in Luxemburg vor allem für Menschen ein, die nach dem Strafvollzug den Schritt in ein neues Leben wagen. Nun hilft er in der Ukraine.
Grégory Fonseca reiste im Februar 2024 zum ersten Mal in die Ukraine, zusammen mit Philippe Jacob. Die beiden brachten eine ausgediente Ambulanz nach Kyjiw und danach lebenswichtige Medikamente und Geräte nach Nikopol an den Dnepr Fluss. Dort steht ein Klinikum, welches schon oft von der anderen Seite bombardiert wurde. Die andere Seite, das ist vor allem das Kernkraftwerk Saporischschja, das temporär von der russischen Armee besetzt ist. Das Kraftwerk, welches zu den größten der Welt gehört, wird von Russland als „staging area“ für Artillerie und Raketenangriffe genutzt. „Ganz schön gruselig, hier am Ufer“, sagt Grégory Fonseca und versucht in der Ferne auf der anderen Seite des Flussbettes die Kühltürme zu sehen. Das Flussbett ist fast ausgetrocknet, es gibt nur noch einen kleinen Fluss, der sich durch das sandige Bett quält. Beim Besuch im Nikopoler Klinikum findet Grégory seine neue Berufung: Helfern zu helfen. Der Chefarzt zeigt ihm und Philippe Jacob die Operationssäle und es ist schnell klar, dass hier Handlungsbedarf herrscht, um diese Kliniken zu unterstützen. Es wird ein Fundraising gestartet sowie dokumentiert und Grégory Fonseca will unbedingt in die Ukraine zurückkommen. Bei seiner zweiten Ukrainereise hat Fonseca beim renommierten Center of Civil Liberties, dem ukrainischen Friedensnobelpreisträger von 2022, ein Praktikum in Kyjiw begonnen. Unter anderem bekam er dort Zugang zu Ermittlern der ukrainischen Polizei und Staatsanwaltschaft, die russische Kriegsgefangene vernehmen. Doch nach ein paar Wochen begleitet Grégory Fonseca an der Kontaktlinie eine Mission. „An der Front sah man, mit wie viel Herzblut, Entschlossenheit, aber auch mit wie viel Menschlichkeit die medizinischen Helfer sich um Verletzte kümmern, und für mich war es dann schlagartig klar: Ich kann hier nicht mehr weg, hier will und muss ich helfen.“

Die Stadt, von der Grégory redet, ist die umkämpfte Frontstadt Pokrowsk. Russland versucht mit allen Mitteln, Wellen von Kamikaze-Drohnen und intensivem Artilleriefeuer, durchzubrechen. Russland ist dabei, auch diese Stadt in Schutt und Asche zu legen, genauso wie vorher Mariupol, Bachmut, Sjewjerodonezk, Soledar und Marjinka. „Es gibt mehrere Stabilisierungs- und Sammelpunkte, wo wir die Verwundeten abholen. Das heißt, die Armee übergibt sie an uns und dann haben wir rund zwei Stunden Fahrt bis nach Dnipro in die verschiedenen Kliniken“, erklärt Fonseca. Wenn die verwundeten Soldat*innen und Zivilist*innen in die Krankenwägen gelegt werden, bekommt Grégory Fonseca deren Papiere zu sehen. Geburtsjahr 2004, 2003. „Das ist sehr, sehr belastend. Wir bringen Menschen in die Klinik nach Dnipro, die fast 10 Jahre jünger sind als man selbst. Dann kickt das Adrenalin ein und man will dieses Menschenleben retten, die eigene Sicherheit ist da erst mal zweitrangig“, erklärt Fonseca erschöpft. Nachts ist es besonders schwierig. Jetzt, wo Russland wieder seine Angriffe auf das Energienetz fortsetzt, gibt es sowieso kein Licht und keinen Strom mehr in den Städten, und er und sein Team müssen die Straßen wie aus dem Effeff kennen. Da die transportierten Verletzten oft innere Blutungen haben, dürfen die Ambulanzfahrer*innen wie Grégory kein einziges Schlagloch erwischen, dies könnte für die Patienten tödlich ausgehen. „Besonders gefährlich sind Brücken auf Autobahnen, weil sie oft von Russen beschossen wurden, und wir fahren dann mit 5 oder 10 Stundenkilometern über die Einschlaglöcher.“ Mittlerweile kennt er die Anfahrtswege zu den Kliniken auswendig. Die Organisation, für die er fährt, heißt Tac Med Ukraine. Es ist ein Verbund ukrainischer und internationaler Notfallsanitäter*innen und Notfallärzt*innen sowie Freiwilligen, die medizinische Evakuierungen aus Frontgebieten durchführen. Es handelt sich um eine kleine Organisation von rund 50 Helfer*innen, die hoch angesehen ist. Sie arbeitet direkt im Rettungscluster des Militärs und bekommt ihre Patient*innen vom Militär vermittelt. „Oft haben wir eine richtig lange Liste abzuarbeiten und es kommen immer wieder neue schwierige Fälle hinzu. Wir verrichten Arbeit mit alten Ambulanzen, wo in Luxemburg der Rettungsdienst den Helikopter schicken würde“, bemerkt Fonseca. Die Schichten sind lang, zwischen 16 und 22 Stunden am Tag. Eine Alternative gibt es nicht. Die freiwilligen Helfer*innen haben vieles geopfert und zurückgelassen, um hier zu sein. Grégory zeigt mit dem Finger auf verschiedene Helfer und sagt: „Der da hat zum Beispiel sein Haus und Auto verkauft, um alles zu spenden.“
Tac Med Ukraine kümmert sich jedoch nicht nur um Evakuierungen und Krankentransporte, sondern bildet auch Soldat*innen im Bereich „Taktische Erste Hilfe“ aus. Es sind Minuten, die über Leben und Tod entscheiden können, sagt der Helfer aus Luxemburg und erklärt, wie heimtückisch Kriegsverletzungen sein können. Manchmal ist es gar nicht klar, wie schlimm der Patient verletzt wurde, denn sogenannte Schrapnelle, kleine Metallstücke, die von explodierenden Bomben, Geschossen und Granaten verstreut werden, hinterlassen oft nur eine winzige Wunde. Die Verletzung mag äußerlich klein erscheinen, kann aber tödlich enden. „Ich will helfen, und hier wird jede Hilfe gebraucht, an der Kontaktlinie des größten Krieges seit dem 2. Weltkrieg.“ Grégory hofft auch, dass sein Einsatz andere Menschen dazu bewegt, aktiv zu werden oder zu spenden. Er versteht, dass sich nicht jeder aus Europa hier direkt an der Front einbringen kann, doch er hofft, dass die Menschen weiterhin die Ukraine finanziell unterstützen: „Es gibt so viele tolle Initiativen in der Ukraine, die humanitäre und militärische Hilfe leisten. Würden wir wenigstens die mit Spenden fördern, dann wäre schon viel vollbracht“, so Fonseca.
Kein schlimmerer Feind und falsche Freunde
Für Fonseca ist der Frieden in Europa instabil. Das Recht, in Frieden zu leben, wird von Russland bedroht und es kann sich alles sehr schnell ändern. „Heute ist es die Ukraine, und morgen die Polen, die Balten … auch wir könnten uns bald im Krieg befinden.“ Für ihn ist es unverständlich, wie eingeschränkt die Militärhilfe für die Ukraine ist: „Man verbietet der Ukraine, mit modernen westlichen Waffen auf militärische Ziele in Russland zu schießen, aber parallel lässt man es zu, dass Russland mit nordkoreanischen ballistischen Raketen und iranischen Drohnen ukrainische Zivilisten tötet. Das ist die moralische Bankrotterklärung des Westens.“ Während seines Praktikums beim Center of Civil Liberties hatte er Zugriff auf Aussagen russischer Kriegsgefangener: „In Europa mutmaßen wir gerne über den Antrieb der russischen Soldaten in diesem Krieg. Die russischen Gefangenen zögern nicht lange und erzählen offen über ihre Motivationen, am Krieg teilzunehmen. Und dabei kristallisieren sich zwei Themen heraus: das Geld und das Verlangen zu töten.“ Er findet es schwer, diese Beweggründe zu verstehen und fragt sich, wie aus normalen Menschen auf einmal kalte Killer werden, die nicht wie die Ukraine ihr Land oder ihre Familien verteidigen, sondern im Auftrag des Kremls töten.

Die russische Propaganda spielt dabei eine große Rolle, sagt Fonseca, und warnt auch vor zu viel russischem Einfluss in Europa. „Viele Menschen glauben den Schwachsinn, der von Russland verbreitet wird, aber eine halbe Stunde hier in der Ukraine würde helfen, alles zu verstehen.“ Grégory Fonseca ist noch keine 30 Jahre alt, aber er kehrt immer wieder in die Ukraine zurück. Solange es nicht zu einem fundamentalen Umdenken in Europa und den USA kommt, wird dieser Krieg noch lange andauern: „Wir müssen die Ukraine so unterstützen, dass sie diesen Krieg gewinnen kann. Das ist der schnellste Weg zum Frieden“, schlussfolgert Fonseca. Wenn Europa und die USA das nicht tun, wird es noch lange weitergehen und sich ausweiten: „Ich liebe das Leben in Europa im Frieden, aber dieser Frieden kann jederzeit vorbei sein, wenn wir nicht die Ukraine dabei unterstützen, Russland zu stoppen.“
Interview mit Yuriko Backes
Yuriko Backes wurde im November 2023 zur Verteidigungsministerin ernannt. Laut dem Koalitionsvertrag liegt ein Schwerpunkt des Ressorts auf der Modernisierung der luxemburgischen Streitkräfte, einschließlich der Schaffung eines binationalen Bataillons mit Belgien bis 2030, das auf Aufklärung spezialisiert ist. Ein weiterer Fokus liegt natürlich auf der Ukraine.

Frau Ministerin, Luxemburg hat der Ukraine beträchtliche Hilfe zukommen lassen, darunter fast 70 Millionen Euro an Militärhilfe für 2024. Wie bewerten Sie Luxemburgs Beitrag im Vergleich zu anderen EU- und NATO-Verbündeten?
Dieses Jahr hat die luxemburgische Verteidigung bereits mehr als 70 Millionen Euro in die militärische Unterstützung der Ukraine investiert. Das bilaterale Sicherheitsabkommen, das am Rande des NATO-Gipfels in Washington von Präsident Selenskyj und Premierminister Frieden unterschrieben wurde, sieht eine Unterstützungsleistung von mindestens 80 Millionen Euro für 2024 vor. Das Wichtigste ist, dass alle Partner der Ukraine, deren Verteidigungsminister sich regelmäßig im Rahmen der sogenannten Ramstein-Kontaktgruppe unter US-Führung treffen, die ukrainischen Streitkräfte entsprechend ihren Mitteln bestmöglich unterstützen. Es geht nicht darum, einen Vergleich zu anderen EU- und NATO-Verbündeten zu ziehen. Es geht darum, die Ukraine dazu zu befähigen, dass sie sich weiter gegen Russlands illegitimen und grausamen Angriffskrieg verteidigen kann. Wir dürfen die Ukraine nicht sich selbst überlassen. Das wäre ein folgenschwerer Fehler.
Welche spezifischen Arten von militärischer Ausrüstung, abgesehen von Munition und Drohnen, plant Luxemburg in naher Zukunft an die Ukraine zu liefern?
Seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar 2022 haben wir kontinuierlich Waffen, Munition, militärische Fahrzeuge, Nachtsichtgeräte, Aufklärungsdrohnen und vieles mehr an die Ukraine geliefert. Wir sind an verschiedenen internationalen Koalitionen, wie der IT-Koalition, Air-Force-Koalition oder der Artillerie-Koalition beteiligt und wir nehmen an der tschechischen Initiative für Artilleriemunition teil. Diese Bemühungen werden wir fortführen, solange es nötig ist. Dabei bleiben wir aber unserer Linie treu: Wir kommunizieren erst über Lieferungen, wenn diese auch tatsächlich in der Ukraine angekommen sind. Transparenz bezüglich unserer militärischen Unterstützung ist mir wichtig, aber wir werden nichts ankündigen, bevor wir nicht hundertprozentig sicher sind, dass die Lieferung erfolgreich war.
Da Luxemburg eine Schlüsselrolle in der IT-Koalition zur Unterstützung der Ukraine spielt, könnten Sie erläutern, wie diese Initiative die militärische Effektivität der Ukraine, insbesondere in Bezug auf Cybersicherheit und Kommunikation, stärkt? Wie könnte diese IT-Koalition unter Berücksichtigung von Luxemburgs Satellitenkapazitäten noch effektiver gestaltet werden?
Ein Krieg im 21. Jahrhundert wird nicht allein durch Feuerkraft und Personalstärke entschieden. Moderne Waffensysteme sind vernetzt, ohne sichere und stabile Kommunikation funktionieren diese nicht effizient. Eine ungesicherte Kommunikation an der Front und von der Front zur Kommandozentrale kann verheerende Folgen für die eingesetzten Truppen haben. Gesicherte, schnelle und stabile Kommunikation ist ein GameChanger mit direkten Auswirkungen auf die Einsätze. Die IT-Koalition, die mittlerweile 15 Mitglieder zählt, liefert dringend benötigtes IT-Material, Hardware und Software an das ukrainische Verteidigungsministerium und die ukrainischen Streitkräfte. Bis heute wurde schon Material im Wert von über 9,6 Millionen Euro geliefert, es laufen Bestellungen für über 50 Millionen Euro. Luxemburg hat als Lead Nation insgesamt 17,5 Millionen Euro zur IT-Koalition beigetragen. Auch Satellitenkapazitäten machen einen bedeutenden Unterschied, sei dies, um die Kommunikation zu verbessern oder um Bilder zur Lageanalyse auszuwerten.
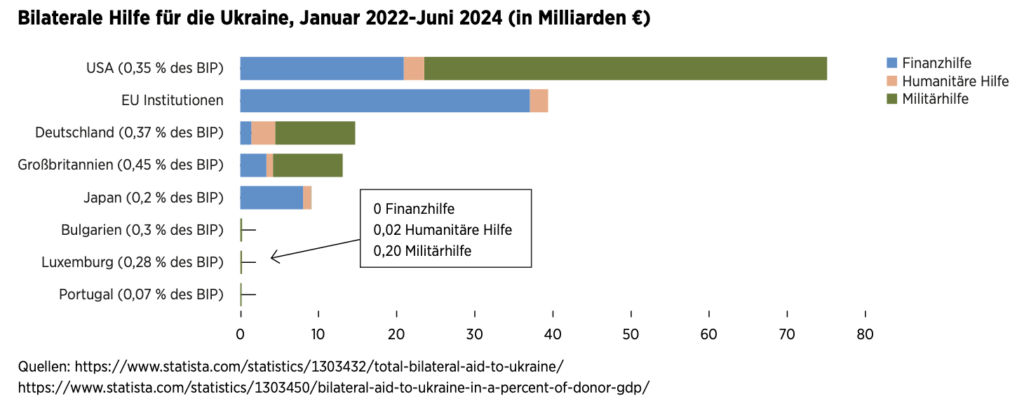
www.statista.com/statistics/1303450/bilateral-aid-to-ukraine-in-a-percent-of-donor-gdp/
Einige Länder, hauptsächlich Politiker der extremen Rechten, haben begonnen, langfristig über eine Reduzierung der Militärhilfe für die Ukraine zu diskutieren. Wie stark ist Luxemburg in seinem Engagement für eine anhaltende militärische Unterstützung der Ukraine im Jahr 2025 und darüber hinaus?
2022 und 2023 hat die Verteidigungsdirektion eigene Projekte verschoben, um so Haushaltsmittel freizumachen, welche für die militärische Unterstützung der Ukraine genutzt werden konnten. Wir können diese jedoch nicht ewig aufschieben, sodass die Regierung für 2024 entschieden hat, eine spezielle Haushaltslinie für die militärische Unterstützung der Ukraine im Budget der Verteidigungsdirektion festzulegen. Auch 2025 wird die militärische Unterstützung der Ukraine über eine separate Haushaltslinie laufen. So können wir die Höhe der militärischen Unterstützung entsprechend der Entwicklung des Krieges und der Bedürfnisse der Ukraine anpassen. Luxemburg steht weiter felsenfest hinter der Ukraine. Eine Investition in ihre Wehrtüchtigkeit ist eine Investition in unsere eigene Sicherheit. Die künftige Schaffung einer speziellen Haushaltslinie spiegelt diese Überzeugung wider.
Es gibt eine kleine Debatte in Luxemburg über die Wiedereinführung des obligatorischen Wehrdienstes. Könnten Sie Ihre Position dazu darlegen und wie wahrscheinlich ist es, dass die Wehrpflichtgesetze wieder eingeführt werden? Ist dies eine Antwort auf die Bedrohung Europas durch Russland?
Zum Thema der Wehrpflicht gibt das Koalitionsabkommen mir kein Mandat und es besteht auch derzeit keinerlei Plan, diese wieder einzuführen. Das Thema wird aber in vielen NATO-Ländern diskutiert, und ich denke, dass diese Debatte auch irgendwann in Luxemburg ankommt. Die Umsetzung eines solchen Vorhabens wäre auch nicht ohne größere Anstrengungen, ohne Anpassung des Rechtsrahmens und dem Bau geeigneter Infrastrukturen möglich. Meine Ambition ist es, die Armee und unsere Verteidigung in ihrer aktuellen Form zu stärken. Daran arbeite ich mit der Verteidigungsdirektion und der Armee zusammen. Luxemburg ist heute schon ein verlässlicher, solidarischer NATO-Alliierter, der seinen Teil zur kollektiven Abschreckung und Verteidigung beiträgt. Wir investieren in unser Personal, wir investieren in unsere Fähigkeiten, wir stellen weiter Truppen für gemeinsame Missionen. Darauf kommt es an, denn die Bedrohung durch Russland ist durchaus real.
Derzeit ist bekannt, dass mindestens ein luxemburgischer Staatsbürger in der Internationalen Legion der ukrainischen Streitkräfte eingeschrieben ist: Würde ein solcher Einsatz als Luxemburger in den ukrainischen Streitkräften den Weg versperren, sich später als Soldat in Luxemburg zu bewerben?
Rechtlich gesehen ist ein solcher Einsatz kein Ausschlusskriterium, um den luxemburgischen Streitkräften beizutreten. Alle Soldat*innen der luxemburgischen Armee müssen eine Musterung und eine viermonatige Grundeinführung in den Militärdienst bestehen. Hier werden nicht nur physische, sondern auch psychische und moralische Qualitäten bewertet.
Luxemburg hat keine eigene bzw. nur eine sehr unbedeutende Verteidigungsindustrie. Gibt es Pläne oder Ideen, weiter in diesen Sektor zu investieren? Könnte dies eine neue Nische für die luxemburgische Wirtschaft sein?
Luxemburg will bis 2030 die NATO-Richtlinie der 2 % Verteidigungsinvestitionen erreichen. Konkret bedeutet dies, die Verteidigungsausgaben von heute ‒ 696 Millionen Euro jährlich ‒ auf rund 1,4 Milliarden Euro zu verdoppeln. Wenn wir so viel investieren, dann ist es für mich selbstverständlich, dass wir dabei darauf achten, dass auch luxemburgische Unternehmen daran teilhaben können. Entsprechend habe ich eine interministerielle Arbeitsgruppe zusammengesetzt, welche sich diesem Thema annimmt. Auch auf EU- und NATO-Ebene wird mehr investiert. Die europäische und transatlantische Rüstungsindustrie soll gestärkt werden. Wir müssen Luxemburgs Unternehmen dabei helfen, sich in die Lieferketten dieser Industrie zu integrieren und somit einen ökonomischen Teilrückfluss unserer Ausgaben zu erreichen.
(Die Interviews und Recherchen für diesen Artikel fanden in Luxemburg und Kyjiw zwischen Mai und Oktober 2024 statt.)
Geschichtlicher Überblick
438 n. Chr.: Gründung von Kyjiw
9. Jahrhundert: Gründung der Kyjiwer Rus, des ersten großen ostslawischen Staates. Historiker debattieren darüber, ob der legendäre Wikingerführer Oleg, der Herrscher von Nowgorod, Kyjiw eroberte und zur Hauptstadt der Kyjiwer Rus machte, was seiner strategischen Lage am Dnipro-Fluss zu verdanken war.
10. Jahrhundert: Die Dynastie der
Rurikiden wird etabliert. Unter der Herrschaft von Wladimir dem Großen beginnt ein goldenes Zeitalter. Im Jahr 988 nimmt er das orthodoxe Christentum an und leitet die Christianisierung der Kyjiwer Rus ein.
11. Jahrhundert: Unter der Herrschaft von Jaroslaw dem Weisen erreicht die Kyjiwer Rus ihren Höhepunkt und wird zum wichtigsten politischen und kulturellen Zentrum in Osteuropa.
Fremde Herrschaft und Eroberungen
1237-1240: Die Mongolen überfallen die Fürstentümer der Rus und zerstören viele Städte, wodurch die Macht der Kyjiwer Rus endet. Die Eroberer, bekannt als Tataren, gründen das Reich der Goldenen Horde.
1349-1430: Polen und später die polnisch-litauische Adelsrepublik annektieren allmählich weite Teile des heutigen westlichen und nördlichen Gebiets der Ukraine.
1441: Das Krim-Khanat trennt sich von der Goldenen Horde und erobert den größten Teil des heutigen südlichen Teils der Ukraine.
1596: Polen etabliert die griechisch-katholische Kirche (Uniate), die mit Rom verbunden ist und in der Westukraine vorherrschend wird. Der Rest der Ukraine bleibt überwiegend orthodox.
1648-1657: Kosakenaufstand gegen die polnische Herrschaft führt zur Gründung des Hetmanats, das in der Ukraine als einer der Vorläufer des modernen unabhängigen Staates angesehen wird.
1654: Der Vertrag von Perejaslawl leitet den Prozess ein, das Hetmanat zu einem Vasallenstaat Russlands zu machen.
1686: Mit dem Vertrag des Ewigen Friedens zwischen Russland und Polen endet der 37-jährige Krieg mit dem Osmanischen Reich, was zur Aufteilung des Hetmanats führt.
Russische Herrschaft und die Neuzeit
1708-1709: Der Mazepa-Aufstand versucht während des Großen Nordischen Krieges, das Hetmanat von der russischen Herrschaft zu befreien.
1764: Russland hebt das östliche Hetmanat auf und etabliert das Gouvernement Kleinrussland, das bis zur vollständigen Annexion 1781 bestehen bleibt.
1772-1795: Der größte Teil der Westukraine wird durch die Teilungen Polens in das Russische Reich integriert.
1783: Russland annektiert die Krim und übernimmt damit die Kontrolle über den Süden der Ukraine.
19. Jahrhundert: Die ukrainische nationale Wiedergeburt beginnt, gefördert durch literarische, bildungspolitische und historische Entwicklungen. Das von den Habsburgern regierte Galizien wird zu einem Zentrum für ukrainische politische und kulturelle Aktivitäten, während Russland die Nutzung der ukrainischen Sprache auf eigenem Territorium verbietet.
Unabhängigkeit, Krieg und Unterdrückung im 20. und 21. Jahrhundert
1917: Die Zentralna Rada wird nach dem Zusammenbruch des Russischen Reiches in Kyjiw gegründet.
1918: Die Ukraine erklärt ihre Unabhängigkeit, jedoch kämpfen rivalisierende Regierungen in einem Bürgerkrieg um die Kontrolle des Landes.
1932: Millionen Menschen sterben während der von Stalin verursachten Hungersnot, Verfolgung und Exterminierung bekannt als der Genozid „Holodomor“. Repression ukrainischer Kultur und Sprache.
Zweiter Weltkrieg: Acht Millionen Ukrainer*innen werden getötet. Die jüdische Bevölkerung der Ukraine wurde fast ganz exterminiert (1,6 Millionen). Das Land ist zerrieben zwischen brutaler Nazibesatzung und späterer Sowjetherrschaft. Deportation und brutale Umsiedlung der Krim-Tataren in Lager und fernöstliche Regionen durch die Sowjetunion. Über ein Drittel stirbt. Die ukrainische Kultur und Sprache werden während der gesamten Sowjetherrschaft immer wieder unterdrückt.
1954: Die Krim wird an die Ukrainische SSR übergeben, nach kollektiver Regierungsentscheidung und langer Verhandlung in Moskau.
1986: Tschernobyl Super-GAU.
1991: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erklärt die Ukraine ihre Unabhängigkeit.
1994: Die Ukraine verzichtet auf Atomwaffen, gibt Arsenal ab und verschrottet Trägersysteme gegen Sicherheitsgarantien von Moskau, Washington, Paris und London.
2003: Tuzla-Insel-Konflikt mit Russland. Danach fast jährlich Gasstreit und Rohstoff-Erpressung aus Moskau.
2008: Die Ukraine und Georgien bekommen keine konkrete Aussicht auf NATO-Mitgliedschaft. Russland marschiert kurz danach in Georgien ein.
2014: Maidan Revolution. Absetzung des prorussischen Präsidenten Janukowitsch. Russland annektiert völkerrechtswidrig die Krim und schickt Truppen in die Ostukraine.
2014-2022: Der Krieg im Donbass fordert über 15.000 Todesopfer. Russische Buk-Rakete schießt Flug MH17 ab.
2019: Wolodymyr Selenskyj gewinnt die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine, löst Petro Poroschenko ab und tritt sein Amt an.
2021: Russland startet mehrere Großmanöver in Belarus und im Westen Russlands.
2022: Invasion der Ukraine durch Russland.

Autor
Philippe Schockweiler, 38, arbeitet als freischaffender Journalist und Kommunikationsberater in Luxemburg. Seit 2005 berichtet er regelmäßig über die Ukraine. Dabei interessieren ihn insbesondere Themen wie die Resilienz der Zivilbevölkerung, Mechanismen und Hintergründe russischer Propaganda sowie geopolitische und militärische Entwicklungen. Er ist Koproduzent der Podcast-Serie „War at Home“ auf Spotify sowie des ukrainischen Dokumentarfilms Zinema, der im Oktober 2024 beim CinEast Festival Europapremiere hatte.
Weiterführende Literatur
Zur Geschichte der Ukraine:
Anne Applebaum, Red Famine: Stalin‘s War on Ukraine, New York, Doubleday, 2017
Anne Applebaum, Gulag: A History, New York, Anchor Books, 2003
Jaroslav Hrytsak, Ukraine: Biographie einer bedrängten Nation, München, C. H. Beck, 2024
Serhii Plokhy, The Gates of Europe: A History of Ukraine, New York, Basic Books, 2015
Serhii Plokhy, Chernobyl: The History of a Nuclear Catastrophe, New York, Basic Books, 2018
Serhii Plokhy, The Last Empire: The Final Days of the Soviet Union, New York, Basic Books, 2014
Serhii Plokhy, Lost Kingdom: The Quest for Empire and the Making of the Russian Nation, New York, Basic Books, 2017
Serhii Plokhy, The Russo-Ukrainian War: The Return of History, New York, W. W. Norton & Company, 2023
Timothy Snyder, Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin, New York, Basic Books, 2010
Timothy Snyder, The Making of Modern Ukraine (classes 1-23), Yale Courses: https://online.yale.edu/courses/making-modern-ukraine
Über den Krieg:
Andrey Kurkov, Grey Bees: A captivating, heartwarming story about a gentle beekeeper caught up in the war in Ukraine, London, MacLehose Press, 2021
Olesya Khromeychuk, The Death of a Soldier Told by His Sister, London, Hachette, 2022
1 Die Orange Revolution fand Ende 2004 statt und war eine Serie von Protesten und politischen Ereignissen, die durch die manipulierten Präsidentschaftswahlen ausgelöst wurden. Millionen
von Ukrainer*innen gingen auf die Straßen, um gegen Wahlfälschungen zu demonstrieren
und forderten Neuwahlen. Die Bewegung führte zur Annullierung der Wahlergebnisse und
zur Wiederholung der Stichwahl, die schließlich Wiktor Juschtschenko als Sieger hervorbrachte.
Die Revolution markierte einen entscheidenden Moment in der ukrainischen Geschichte und stärkte die Demokratie sowie den Einfluss der Zivilgesellschaft im Land.
2 Der Holodomor war eine von 1932 bis 1933 durch die sowjetische Regierung bewusst herbeigeführte Hungersnot in der Ukraine. Er wird als Völkermord anerkannt, da die Sowjetunion gezielt landwirtschaftliche Erzeugnisse beschlagnahmte, was zum Tod von Millionen Ukrainer*innen führte. Es war nicht nur eine Hungersnot, sondern eine systematische Unterdrückung und Verfolgung durch Russland, die auch die kulturelle Identität der Ukraine auslöschen sollte. Zahlreiche Menschen wurden verfolgt, deportiert oder getötet, wenn sie sich gegen die Maßnahmen stellten. Je nach Quelle starben auf dem Gebiet der heutigen Ukraine und in anderen Gebieten der damaligen Sowjetunion zwischen 3,5 und 14 Millionen Menschen.
3 Die Revolution auf Granit bezieht sich auf eine Serie von friedlichen Protesten in der Ukraine im Jahr 1990, die von Student*innen initiiert wurden. Diese Bewegung forderte demokratische Reformen sowie die Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion.
4 Wiktor Juschtschenko ist eine zentrale Figur in der modernen ukrainischen Geschichte und wurde vor allem durch seine Rolle in der Orangen Revolution von 2004 international bekannt. Geboren 1954 in einer ländlichen Region der Ukraine, stieg er nach einer erfolgreichen Karriere im Bankwesen in den 1990er Jahren in die Politik ein. Als Vorsitzender der Nationalbank und später als Ministerpräsident (1999-2001) erwarb er sich den Ruf eines Reformers, der sich für wirtschaftliche Stabilität und den Abbau der weit verbreiteten Korruption einsetzte. Seine Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2004 war von Anfang an ein Kampf gegen das von Russland unterstützte Establishment. Im Vorfeld der Wahlen wurde Juschtschenko Opfer einer mysteriösen Vergiftung, die sein Gesicht schwer entstellte – ein Ereignis, das weltweit für Aufsehen sorgte und das Symbol für den Kampf gegen das korrupte System wurde. Trotz der Manipulationen bei der ersten Wahlrunde führte der massive öffentliche Druck während der Orangen Revolution zur Annullierung des Wahlergebnisses und zu einem demokratischen Wiederaufleben in der Ukraine. Juschtschenko wurde schließlich als Präsident gewählt und trat sein Amt Anfang 2005 an. Als Präsident (2005-2010) setzte er sich energisch für die europäische Integration der Ukraine, den Abbau von Korruption und die Stärkung der nationalen Identität ein.
5 Kriwyj Rih, eine bedeutende Industriestadt im Süden der Ukraine mit 600.000 Einwohner*innen. Die Stadt ist bekannt für ihre umfangreiche Metallurgie- und Bergbauindustrie. Die Stadt erstreckt sich über eine Länge von fast 100 Kilometern und ist eines der längsten urbanen Gebiete Europas. Sie ist Geburtsort von Wolodymyr Selenskyj.
6 In Anlehnung an den Roman The Manchurian Candidate (1959) von Richard Condon, der einen Politiker beschreibt, der nicht im Interesse seines eigenen Landes handelt, weil er von einer Außenmacht kontrolliert wird.
7 Wiktor Janukowytsch, geboren am 9. Juli 1950 in Jenakijewe, einer Industriestadt im Donbass, stieg in der Politik als Mitglied der Partei der Regionen auf, einer prorussischen Partei, die vor allem im Osten der Ukraine stark war. Janukowytsch war von 2002 bis 2004 und erneut von 2006 bis 2007 Ministerpräsident der Ukraine. 2004 gewann er bei den Präsidentschaftswahlen, wurde jedoch aufgrund massiver Wahlfälschungsvorwürfe, die zur Orangen Revolution führten, abgesetzt. Erst 2010 konnte er schließlich das Präsidentenamt übernehmen. Janukowytschs enge Verbindung zu Wladimir Putin und Russland zeigte sich nicht nur in seiner Politik, sondern auch in seiner persönlichen Flucht nach Russland, wo er bis heute lebt. Putin und die russische Regierung unterstützten Janukowytsch während und nach seiner Amtszeit, um ihren Einfluss in der Ukraine zu sichern und eine weitere Annäherung des Landes an den Westen zu verhindern.
8 Die Russifizierung des Donbass über die letzten 200 Jahre hinweg war ein Prozess, bei dem das Russische Reich, die Sowjetunion und jüngst die Russische Föderation darauf abzielten, die Region kulturell, sprachlich und politisch enger an Russland zu binden. Dieser Prozess lässt sich in mehrere Phasen unterteilen. Sowohl das russische Zarenreich als auch später die Sowjetunion und die Russische Föderation unterstellten, dass die ukrainische Sprache, oder auch Surschyk und andere Sprachen, „Bauernsprachen“ seien. Die Russifizierung des Donbass war ein vielschichtiger und langwieriger Prozess, der Migration, Kulturpolitik, Sprachförderung und politischen Einfluss umfasste. Über zwei Jahrhunderte hinweg haben diese Bemühungen die demografische und kulturelle Landschaft der Region nachhaltig geprägt und zu den aktuellen Spannungen und Konflikten über Identität und politische Zugehörigkeit beigetragen.
9 In den letzten 30 Jahren hat die ukrainische Armee an mehreren internationalen Friedens- und humanitären Missionen teilgenommen. Dazu gehören Einsätze in Bosnien und Herzegowina (UNPROFOR), im Kosovo (KFOR), in Sierra Leone (UNAMSIL), in Liberia (UNMIL) und in der Demokratischen Republik Kongo (MONUC), in Afghanistan (ISAF) und im Irak (MNFI).
10 Das Minsker Abkommen ist ein 2015 und 2017 zwischen Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich ausgehandeltes Abkommen zur Deeskalation des Konflikts in der Ostukraine, das unter anderem einen Waffenstillstand und politische Reformen vorsah, aber nie vollständig umgesetzt wurde.
11 https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/interviews/2007/05mai/26pm_wort.html
12 Witali Tschurkin (1952-2017) war von 2006 bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 2017 der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen. Wegen seiner häufigen Vetos und seiner strikten Haltung wurde Tschurkin oft als „Mr. No“ bezeichnet.
13 Als „Banderisten“ (ru./ ukr. „Banderit“) bezeichnet man Anhänger von Stepan Bandera (1909-1959). Er war ein prominenter ukrainischer Nationalist und Führer der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), die für die Unabhängigkeit der Ukraine kämpfte. Während des Zweiten Weltkriegs kollaborierte Bandera zunächst mit Nazi-Deutschland, geriet aber schnell in Konflikt mit den Nazis und wurde im KZ Sachsenhausen inhaftiert. Nach dem Krieg setzte er seinen Kampf gegen die Sowjetdiktatur aus dem Exil in Westdeutschland fort. Bandera war zwar nicht direkt an den „Lemberger Pogromen“ und anderen Gewalttaten gegen jüdische und polnische Zivilisten beteiligt, doch er war über diese Ereignisse gut informiert. Dennoch war er entweder nicht bereit oder nicht in der Lage, seine Truppen anzuweisen, Minderheiten in ihren Gebieten zu schützen.
Am 15. Oktober 1959 wurde Bandera in München von einem KGB-Agenten mit einem Giftgasanschlag ermordet. In der russischen Propaganda wird Bandera häufig als Symbol für ukrainischen Faschismus dargestellt, um die aktuelle ukrainische Regierung zu diskreditieren und den russischen Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen.
14 Richtlinie 2001/55/EG des EU-Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen auf die Mitgliedstaaten, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind.
15 Prawo i Sprawiedliwość (kurz PiS), deutsch: Recht und Gerechtigkeit.
16 https://www.nato.int/cps/en/natohq/events_195029.htm?selectedLocale=en
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
