- Bildung
Hinterherlaufen oder vorangehen?
Die Bildungspolitik Luxemburgs am Scheideweg – mal wieder
Jedes Schulwesen ist eine ewige und riesige Baustelle, die sich den Gegebenheiten der Zeit und den Entwicklungen der Gesellschaft anpassen muss. Diese Baustelle zum Besten aller Schüler und Schülerinnen zu leiten, ist eine enorme Aufgabe. Noch dazu stehen die Architekten und Bauleiterinnen einer Masse an vermeintlichen Experten gegenüber, die bei ihrem Bauprojekt mitdiskutieren wollen. Da schließlich jeder die Schule durchlaufen hat, gibt es genug Meinungen darüber, welche pädagogischen Maßnahmen sinnvoll erscheinen und welche nicht. Nur: Gerade die eigene Erfahrung disqualifiziert die selbsternannten Experten und Expertinnen.
Denn Schüler und Schülerinnen kommen aus den unterschiedlichsten Umfeldern, haben vielfältige Voraussetzungen, Bedürfnisse und Entwicklungsstadien. Was bei den einen gut funktioniert, klappt bei den anderen nicht. Und vielleicht ist genau das einer der Gründe, warum Bildungspolitiker und -politikerinnen den richtigen Weg einfach nicht zu finden scheinen.
Bildungspolitik reagiert auf gesellschaftliche Veränderungen
Die luxemburgische Bildungspolitik hat dabei nicht nur viele Wege beschritten, sondern vor allem mit Reaktionen statt Präventionen gearbeitet: 1999 führte die luxemburgische Politikerin Erna Hennicot Schoepges (CSV) die Education précoce ein. Ihr Ziel: Alle Kinder sollten mit sechs Jahren die luxemburgische Sprache so weit beherrschen, dass eine Alphabetisierung auf Deutsch einfacher möglich ist. Fast 25 Jahre später ist die Idee nahezu obsolet geworden. Kleine Kinder erlernen die Sprache ihres Umfeldes, in vielen Schulen der Education précoce sprechen die Erzieher und Erzieherinnen kaum noch Luxemburgisch. Das Bildungsministerium erkennt, dass es erneut reagierenund parallel zumindest zwei Sprachen anbieten muss, so dass jedes Kind alphabetisiert wird.
Schüler und Schülerinnen kommen aus den unterschiedlichsten Umfeldern, haben vielfältige Voraussetzungen, Bedürfnisse und Entwicklungsstadien.
Ein anderer Weg: 2009 führte Luxemburg unter Erziehungsministerin Mady Delvaux-Stehres (LSAP) den kompetenzorientierten Unterricht ein – als eines der letzten Länder in Europa. Eine verspätete Reaktion auf die Tatsache, dass Fachwissen mit technischen Hilfsmitteln immer leichter abrufbar wird und nicht mehr genügt, um im Leben Erfolg zu haben. Noch heute ist diese Reform in vielen Köpfen nicht angekommen: vor allem die Abschaffung des pseudoobjektiven Punktebewertungssystems in der Grundschule ist nach wie vor umstritten. In einigen Sekundarschulfächern ist der kompetenzorientierte Unterricht entsprechend noch gar nicht angekommen.
In den letzten zehn Jahren hat das von Claude Meisch (DP) geführte Bildungsministerium munter weiter reagiert, anstatt aktiv nach vorbeugenden Lösungen zu suchen. Doch mittlerweile ist der administrative Flaschenhals im Schulwesen explodiert. Viele Lehrer und Lehrerinnen sind in einer Verwaltung verschwunden, die viel Zeit in Entscheidungsprozesse, Kontrollvorgänge und andere Erhebungen steckt. Den dadurch entstandenen Mangel an Lehrenden will die Politik mit Quereinsteigern und -einsteigerinnen lösen. Zweifelhaft ist aber, ob das die Qualität des Unterrichts oder der Betreuung steigert oder das Gegenteil bewirkt.
Man kann sich in diesem Zusammenhang fragen, welchen Stellenwert die Verantwortlichen der mehrjährigen pädagogischen Ausbildung eines regulären Grundschullehrers oder einer -lehrerin beimessen. Auf die im Laufe der Zeit entstandene Meinungsvielfalt innerhalb des Lehrpersonals in Bezug auf Methoden, Ansätze und Strategien reagierte das Ministerium ironischerweise, indem es intensiv auf die obligation de réserve aller Beamten und Beamtinnen pochte. Diese sollten die Politik ihres Ministeriums offensiv verteidigen und rechtfertigen – ein Ansatz, der wenig überraschend für brodelnde Unzufriedenheit sorgte.
Gleichzeitig setzt das Ministerium an anderer Stelle selbst auf Vielfalt und versucht, möglichst vielen Schülern und Schülerinnen über eine Ausweitung des Schulangebots ein auf sie zugeschnittenes Programm zu schaffen. Außenstehenden mag die inzwischen erstaunliche Palette an unterschiedlichen Orientierungsmöglichkeiten nach einer Cinquième G oder einer Quatrième C fantastisch erscheinen. Viele Jugendliche erleben sie aber als heilloses Durcheinander. Auch darauf reagiert das Ministerium mit einer Lösung: Nachdem immer mehr Schüler und Schülerinnen die Schule ohne Abschluss abgebrochen haben, verlängerte es die Schulpflicht kürzlich auf 18 Jahre – und ließ so einige Schulabbrechende aus den Statistiken verschwinden.
Die Reaktionen kommen zu spät und ohne Vorbereitung
Reaktionen haben einen großen Nachteil: Sie blicken nicht in die Zukunft und verfolgen langfristige Pläne, sondern versuchen vor allem, kurzfristig weiteren Schaden zu verhindern.
Die ministeriellen Reaktionen treffen zudem häufig auf eine unvorbereitete Basis: nicht vorhandene Infrastrukturen, Programme und Methoden, ein fehlendes motiviertes und qualifiziertes Personal. Das führt dazu, dass die Maßnahmen in der praktischen Umsetzung verwässern und im schlimmsten Fall sogar ihr Ziel verfehlen.
Ein Beispiel ist das digitale Zeitalter, das vermehrt informatische Mittel in den Klassenalltag brachte. Hier hat eine Reaktion mit nachhaltigem Konzept zum Meistern der damit verbundenen Herausforderungen zu lange gefehlt. Die Bildungspolitik verliert damit die Schüler und Schülerinnen, die ihre Hilfe am Nötigsten bräuchten. Obwohl diese physisch noch im Klassensaal sitzen, ist ihr Blick auf das iPad gerichtet und ihre Aufmerksamkeit ist in den Tiefen des Internets versunken.
Ein anderes Beispiel ist die Betreuungspolitik: Sie hat manchen Eltern den Eindruck vermittelt, dass der Staat die Erziehung ihrer Kinder übernimmt. Betreuungsstrukturen entwickelten sich mit der Zeit zu Institutionen, die dafür sorgen sollen, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben. Doch weder die Schule noch eine sonstige Betreuungsstruktur kann Bezugspersonen herbeizaubern, die die Rolle von verantwortungsbewussten Eltern ersetzen.
Natürlich gibt es weiterhin Elternpaare oder Alleinerziehende, die ihre Kinder nur fremdbetreuen lassen, wenn es nicht anders geht. Eltern, die zu Hause miteinander reden und sich für das Leben ihres Kindes interessieren. Die wissen möchten, was in der Schule passiert. Die lesen und ein Auge darauf haben, was auf den digitalen Apparaten geschieht. Die fair miteinander streiten und ihre Kinder nicht rund um die Uhr beschäftigen oder bespaßen. Jene Kinder durchlaufen in der Regel jede Art von Schulsystem ohne große Probleme. Sie existieren unabhängig vom sozialen Status der Familie in allen Schichten.
Solch idealen Verhältnisse sind in vielen Familien allerdings nicht gegeben. Oft tritt dann das Smartphone als neue, virtuelle Bezugsperson in das Leben ein. Es vereinnahmt manche Jugendlichen so sehr, dass ihnen die Konzentration im Unterricht schwer zu fallen scheint. Diese Jugendlichen sind während dieser Zeit faktisch nicht beschulbar. Die verfehlte Betreuungs- und Digitalpolitik treffen somit in der Bildung aufeinander.
Eine bessere Bildungspolitik braucht Konsens
Was tun? Für eine effizientere, gerechtere und nachhaltigere Bildungspolitik braucht es einen Schulfrieden. Die großen Parteien müssten sich auf eine Schulpolitik für die nächsten Jahrzehnte einigen und sie im Grundsatz verfolgen – egal, welche Partei das Ministerium am Ende führt. Auch die Gewerkschaften und Elternverbände müssten diesen Frieden mittragen.
Wenn Konsens zwischen allen großen Parteien bestehen würde, wäre die Politik
gesellschaftspolitisch mehrheitsfähig. Dafür müssten sich die Parteien im Vorfeld auf eine Grundprämisse einigen: Das Vertrauen in das Lehrpersonal muss wiederhergestellt werden, die Politik deren wahre Verantwortung stärken.
Eine richtungsweisende pädagogische Studie für dieses Projekt wäre die von John Hattie. Hattie ist ein neuseeländischer Pädagoge, der zum Schluss kommt, dass es im Bildungsbereich nicht nur, aber zuerst auf den Lehrer ankommt. Ein Lehrer oder eine Lehrerin ist zwar nicht dafür verantwortlich, wenn ein Kind sich im Pausenhof das Knie aufschürft, aber dafür, dass ein Kind in seinem eigenen Rhythmus hinzulernen kann.
Die großen Parteien müssten sich auf eine Schulpolitik für die nächsten Jahrzehnte einigen und sie im Grundsatz verfolgen.
Die lehrende Person beruft sich nach dieser Idee nicht auf Regeln, Vorgaben und Vorschriften, um ihr Handeln zu rechtfertigen. Sie wirkt aus pädagogischen Gründen und konzentriert sich auf ihr Kerngeschäft: die Lehre. Wenn sie bei einzelnen Schülern und Schülerinnen Hilfe benötigt, muss sie diese schnell, unbürokratisch und nachhaltig erhalten. Ein verantwortungsvoller Lehrer oder Lehrerin hatte eine gute Ausbildung, ist empathisch, weiß, wie die Schüler und Schülerinnen heißen und ob sie ihre Freizeit auf einem Pferdehof oder zuhause auf dem Sofa verbringen. Ihnen ist bekannt, ob die Schüler und Schülerinnen in diesem Fach weiterstudieren wollen oder nicht. Kurzum: Die Lehrenden begeistern sich für ihr Fach.
In dem Sinne muss die Bildungspolitik auch die Kriterien für eine Zulassung in die Lehrendenausbildung und deren Abschluss überdenken: Die Fähigkeit zur Empathie und die Haltung zum Lehrfach müssen darin eine viel wichtigere Rolle spielen. Wichtig ist auch die Tatsache, dass Statusrivalitäten innerhalb der Lehrerschaft – etwa zwischen Grundschul- und Sekundarlehrenden – manchen Reformen im Weg stehen.
Jene Unsummen, die in die Kinderfremdbetreuung gehen, sollte die Politik dagegen zurückfahren. Diese Gelder könnte sie stattdessen nutzen, um Eltern kleiner Kinder nur noch zu 75 % arbeiten zu lassen und den Ausgleich zu finanzieren. Alleinstehende Eltern sollten grundsätzlich die Möglichkeit haben, bei vollem Lohnausgleich in einem 75 %-Arbeitsverhältnis zu arbeiten. Eine weitere Idee wären freiwillige „Elternschulen“ – wenn nötig mit einem finanziellen Anstoß verbunden. Diese Schulen sollen vermitteln, dass Erziehung nicht durch Anweisungen oder Ratschläge geschieht, sondern indem Eltern ihren Kindern das vorleben, was sie sich von ihnen wünschen.
Für die Betreuungsstrukturen wie die Maison Relais braucht es schließlich andere Konzepte und weniger Bespaßungsangebote: Die Kinder müssen zur Ruhe kommen und alleine sein dürfen, wenn sie das möchten. Diverse Pflichten, etwa das Erledigen von Hausaufgaben, sollten in den Betreuungskonzepten selbstverständlich sein.
Ein neues Fundament muss her
Auch darüber hinaus gibt es viele Baustellen: Luxemburg braucht ein Schulsystem, das überschaubar und verständlich ist. Eines, in dem jeder Schüler und jede Schülerin alle Fächer in der Schulsprache lernen kann, in der er oder sie sich am wohlsten fühlt – ohne dass der Gebrauch der anderen Sprache vernachlässigt wird. Ein Konzept, das eine Alphabetisierung auf Deutsch oder auf Französisch ermöglicht und das genau beschreibt, wie das Schulsystem diese beiden Lerngruppen später wieder zusammenführen wird.
Weil Überforderung immer wieder zu Demotivation führt, muss die luxemburgische Bildungspolitik den Übergang von der Grundschule in die Sekundarschule überarbeiten. Zu viele Eltern entscheiden sich für eine Klasse, die ihre Kinder überfordert. Das Argument: Das Kind solle es „zumindest mal versuchen“. Dabei bedenken sie nicht, dass die Schulmüdigkeit dadurch oft schon früh gefördert wird.
Das Bewertungssystem müssen die Verantwortlichen im Luxemburger Bildungssystem generell überdenken. Die Lehrer und Lehrerinnen sollen in der Ausbildung lernen, die vielen Teilkompetenzen zu berücksichtigen, die zu einer Gesamtbewertung führen. Die Bewertung soll von der Grundschule bis zum Schulabschluss gültig und für Außenstehende verständliche sein. Die neue Regierung muss sich zusätzliche Gedanken darüber machen, wie man Kindern anhand dieser Bewertungen realistisch beibringt, welche Möglichkeiten sie für ihre Zukunft haben. Denn entgegen vieler falscher Eindrücke stehen ihnen eben nicht immer alle Türen offen.
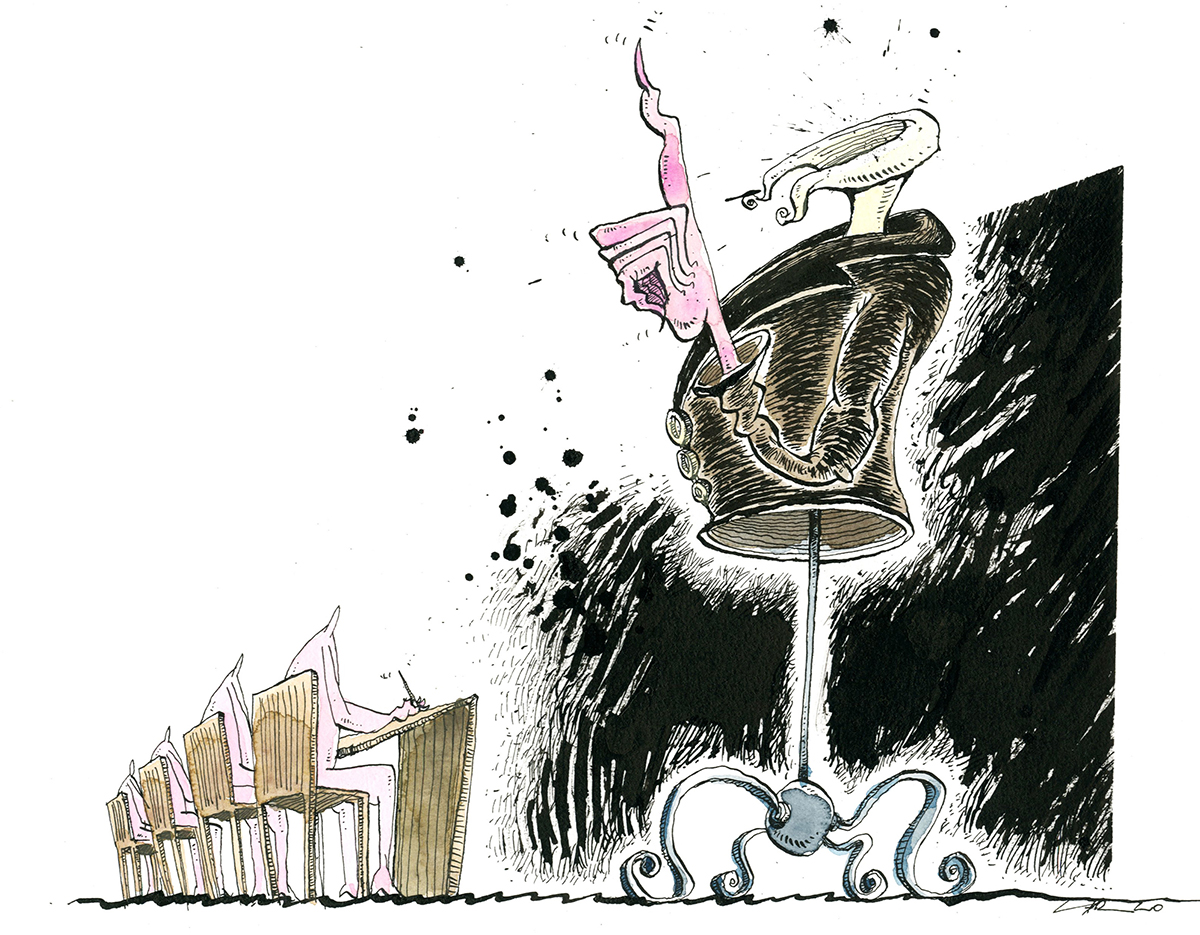
Passend dazu ist auch die Orientierung in eine Berufsausbildung für 15-Jährige hinterfragbar. Kaum eine jugendliche Person ist heutzutage noch bereit, so früh eine Entscheidung fürs Leben zu treffen. Stattdessen könnte jedes Lyzeum in seiner Oberstufe mit freiwilligen Optionen den Spezialisierungswünschen entgegenkommen und das Überangebot an spezifischen Sektionen zurückfahren. Das bietet sich auch insofern an, als dass diese häufig nur an einer Schule im Land angeboten werden.
Auch im bürokratischen Flügel stehen die Zeichen auf Entschlackung: Luxemburg braucht mehr qualifiziertes Personal in der schulischen Arbeit und Methoden, um digitale Mittel sinnvoll und verantwortungsbewusst im Schulalltag einzusetzen.
Die Ausarbeitung eines solchen konsensfähigen Plans würde entsprechend der vielseitigen Punkte wahrscheinlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen – und seine Umsetzung noch länger. Doch welche Handlungsalternativen haben wir? Eine Reaktionspolitik kann sich die luxemburgische Bildungspolitik nicht ewig leisten. Sie riskiert damit, einen Teil ihrer Jugend zu verlieren.
Das Fundament des Schul- und Bildungssystems hat viele Risse an allen Ecken und Enden. Es wäre an der Zeit, die Mauern neu hochzuziehen – auf einem stärkeren Fundament als je zuvor.
Passend dazu: Unsere Dossiers im forum-Heft oder online auf www.forum.lu
420 Bildungsziele (2021)
388 Die andere Schule (2018)
377 Vielfalt in der Schule (2017)
Alain Adams hat 20 Jahre lang an der Grundschule unterrichtet, bevor er in die heutige voie préparatoire wechselte. Für das SCRIPT betreute er unter anderem das Thema Inklusion. In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt seiner Arbeit auf der schulischen und beruflichen Orientation der Schüler und Schülerinnen des Atert-Lycée in Redingen.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
