- Gesellschaft
Jugendkultur fordert uns heraus, denn das ist ihr Job.
Einführung ins Dossier
forum als Zeitschrift für Politik, Gesellschaft und Kultur wird von Erwachsenen – oft älteren Erwachsenen – produziert, gelesen und genutzt. Kann diese Ausgabe Türen öffnen und scheinbar einzementierte Altersgrenzen überschreiten?
Gelegenheiten zum Staunen, Erstarren und Auftauen wird es auf jeden Fall geben. In Zeiten, die sich dadurch charakterisieren, dass „jiddwereen“ – unabhängig davon, wie jung oder alt man sich wähnt – in Boxen und Blasen lebt, die das Welterleben massiv vorstrukturieren, benötigen wir mehr denn je unvoreingenommene Neugier. Und diese ist schwerer denn je zu aktivieren. Den Blick auf die Außenwelten der jeweils anderen steuern Algorithmen und Künstliche Intelligenzen (KI). Digital vorgefiltert, gephotoshoppt und gedeepfaket, während man fröhlich-verbissen in seinen Blasen durch die Welt scrollt – Gefangener und Wärter in Personalunion, die gefühlte Freiheit verwaltend.
Kultur soll verbinden, sagt die Mutter zur Tochter. Cultural Clash, wirft die Tochter zurück. Was verstehst Du schon, sagen wir einander, und lachen darüber. Gemeinsam.
Denn noch verstehe ich, was sie zu mir sagt, wenn sie die Güte besitzt, Worte zu wählen, die auch in meinem Wortschatz vorkommen. Den hat sie von klein auf von mir gelernt, während ich ihre Jugendsprache, die sich seit Smartphone und Co. immer mehr auf Englisch, wilde Buchstabenkombinationen, Wort-Sinn-Verwandlungen und Emojis verlegt, nicht lernen kann. Selbst wenn ich mich daran versuchen würde: Es ist aussichtslos!
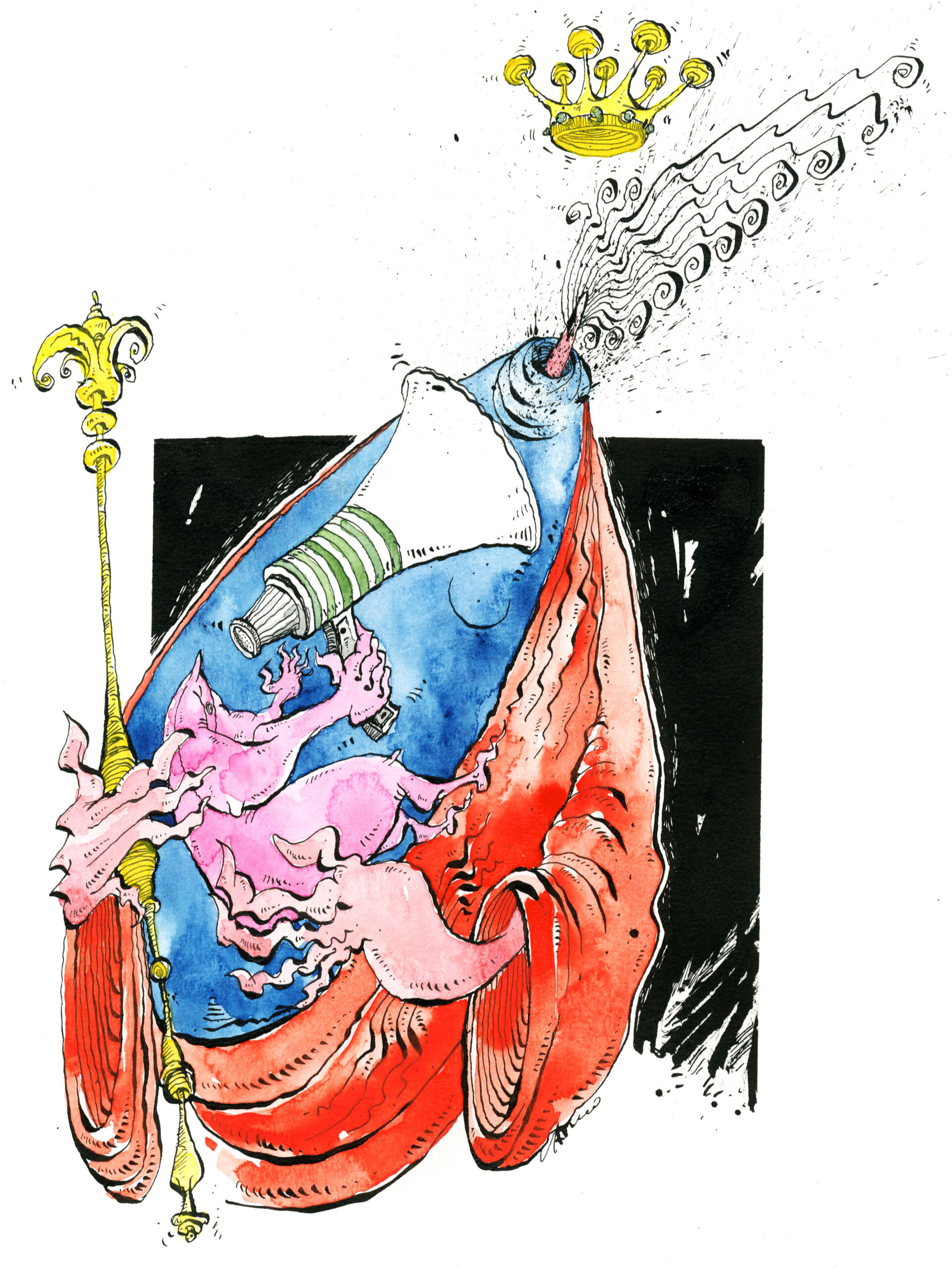
Übernehmen in die Jahre gekommene Menschen Begriffe wie „cool“, „geil“, „lol“ oder „mega“, wenden sich die Jungen mitleidig ab. Für die Jugend sind diese Ausdrücke cringe, aus den 80ern und sowas von out. Nur das „mega“, das hat ein slay! von der Tochter abbekommen.
Stets kreiert die Jugend neue Wortgebilde, deren wahren Kontext wir eh nie kapieren werden. „Früher“, in der Prä-Social-Network-Zeit, gab es das natürlich auch. Allerdings waren die Jugendzeit und die damit einhergehenden kulturellen Phänomene begrenzt. Man konnte sich notfalls entspannt zurücklehnen und auf den Wiedereintritt des jugendlichen Meteors in die Atmosphäre der allgemein anerkannten Kulturwerte warten. Die Erwachsenen haben sich nicht angebiedert.
Die Jugendlichkeit wird zum begehrten Gut
Das ist heute anders. Jugendkultur und gecopypastete Jugendlichkeit breiten sich aus. Sie erobern und besetzen Menschen und Räume. Sie werden mehr und mehr zu einer gefühlten kollektiven Lebenseinstellung: Der körperliche und geistige Reifungsprozess zwischen zwölf und 20 tritt in den Hintergrund. Körperliche und geistige Prozesse werden getrennt betrachtet. Man denkt in Märkten, der medizinische Fortschritt okkupiert die biologischen Körper, die KI übernimmt Denken und Entscheidungsprozesse. Das Erwachsenwerden wird verschoben, das Altwerden übertüncht. Das Flüstern der unsterblichen Seelen erstirbt.
Die Kassen klingeln auf allen Seiten, wenn junge Menschen sich Jugendmode, Smartphones und Influencern unterwerfen – Smombies!,wie die Tochter sie nennt. Ältere Menschen frönen dem Jugendwahn, jagen angesagten Trends und dem „Ich fühle mich jung“-Körpergefühl und -Styling hinterher – sus!.
Die Grenzen, einst wie mit dem Lineal gezogen, verwischen. In den sozialen Netzwerken und in allem, was nach optischer Selbstdarstellung verlangt, wird gemogelt, was das Zeug hält. Das Digitale ist zentrales Werkzeug von Jugendwahn und -kultur. Von einst Jungen erfunden, von den jetzt Jungen bespielt, von den Nächst-Jüngeren vorangetrieben. Das Egozentrische dieser Lebensphase hat Hochkonjunktur und die Phase wird gefühlt endlos ausgedehnt. Die Vielfalt blüht, der Anpassungsdruck ist hoch, es passieren erstaunliche Dinge. Hierzu sagt die Tochter nur: chillax, Mama 😉 CY.
Jugendkultur kennt viele Spielarten, von Subkultur bis Hochkultur. Es gibt nicht die eine Jugend, nicht die eine Form, sich kulturell auszudrücken.
Jugendkultur ist laut, leise, suchend, findend – und doch nie gleich
Im Herzen der Jugend-Subkultur rumort das Unverstandensein, gepaart mit dem Unzufriedensein und dem Wunsch nach Ausdruck und Veränderung. Es ist psychologisch mittlerweile ein erklärtes Phänomen. Das macht das Verständnis und den Umgang damit trotzdem nicht leichter, denn das sich Unverstandenfühlen erfüllt eine wichtige Funktion, die Zeit benötigt. Und die hat gerade niemand.
Das innere Wesen der daraus entstehenden Jugendkultur ist Abgrenzung, weil man auf der Suche ist. In erster Linie nach sich selbst und seiner Position in der Welt, unabhängig von den eigenen Eltern. Man inszeniert sich, sein Alter, seine Gefühle, probiert sich aus, allein und mit anderen, provoziert, lebt und lernt, gerade auch vom Widerspruch. Man will sich bewusst werden, wer, was und wie man ist. Das geht nicht geräuschlos. Aber das Gehirn reift, und irgendwann versteht es sich selbst besser. Ab da kann man wieder auf andere zugehen, ist wieder ansprechbar, kommuniziert. So sollte es sein.
Abgrenzung und Widerstand sind jedoch nicht alles. Es gibt auch Jugendkultur, die unaufgeregt in die Erwachsenenkultur hineinwächst. Junge Menschen, deren Kindheit reich ist an kulturellem Input – der im Bildungsbürgertum für wichtig erachtet wird –, wachsen in einem offenen, auf inneres Wachstum ausgerichteten Umfeld auf. Sie werden gefördert, herausgefordert. Und sie nehmen die Herausforderungen an.
Sie arbeiten an ihren geistig-intellektuellen, soziokulturellen, musikalischen, sportlichen, künstlerischen und politischen Kompetenzen, an ihren Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie wachsen in den traditionellen, klassischen Bildungskanon hinein. Sie besuchen geistes- und sozialwissenschaftliche, naturwissenschaftliche oder auf Spezialbegabungen ausgerichtete Lyzeen und Hochschulen, reden mit ihren Eltern und lassen sich auf die Erwachsenenwelt ein. Sie setzen sich ehrgeizige Ziele. Sie sammeln Erfahrungen in globalisierten Bildungswelten, lernen und arbeiten mit digitalisierten Medien und Techniken, und suchen dennoch Räume für analoges, real existierendes Leben, quer über Altersgrenzen hinweg.
Im Herzen der Jugend-Subkultur rumort das Unverstandensein, gepaart mit dem Unzufriedensein und dem Wunsch nach Ausdruck und Veränderung.
Nicht zuletzt gibt es auch eine Erwachsenenkultur, die ab- und ausgrenzt, und Alter, Geschlecht, Bildung und Kontostand zum Maßstab für Zugehörigkeit und Mitbestimmung erhebt. Diese Geschichte erzählt von Traditionen, Privilegien, Strukturen und Rechtsgrundlagen, gegen die junge Menschen auf unterschiedliche Weisen anrennen. Hierzu gehören die jungen politischen Bewegungen, von Fridays for Future bis Letzte Generation. Sie wenden sich gegen alle, die sich seit 1945 allzu gemütlich in ihren progressiv expandierenden Lifestyle-Kojen eingerichtet haben und auf ewiges Wachstum spekulieren. Diese Jungen wollen die Welt retten und haben ihre eigenen Widerstandskulturen entwickelt, im Netz und in der Wirklichkeit.
Wir leben in aufgewühlten Zeiten, in denen sich viele Gewissheiten in Ungewissheiten aufzulösen scheinen – bei gleichzeitigem Verschwinden von Ungewissheiten, die von wissenschaftlichen Gewissheiten abgelöst werden. Diese wollen sich dann in politische Gewissheiten umwandeln, was wiederum gesellschaftliche Ungewissheiten aufwirft. Jugendkultur ist das fragilste und aufregendste Genre, das Kultur derzeit aufzuweisen hat – wenn man in den richtigen Ecken sucht. forum hat sich dran gewagt! Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben. TY, thanx
Blick ins Dossier:
Wer liest noch – Grimms Märchen, Kellers Kleider machen Leute, Goethes Werther, oder Anne Franks Tagebuch – um sich auf die Tiefen und Untiefen der pubertierenden Jugendlichkeit vorzubereiten? Die Macht der sozialen Medien liegt in den Bildern und Videos, den darin berühmt gewordenen Akteurinnen und Akteuren, die aufgrund der unentrinnbaren Eindringlichkeit unsere kollektiven Vorstellungen massiv beeinflussen. So auch das Männlichkeitsbild junger Nutzer. Was das für junge Männer und Frauen bedeutet, hat Pierre Balthasar analysiert.
Irgendwann wurde das Alter für Volljährigkeit und Wahlrecht auf 18 Jahre gesenkt. Man diskutiert schon über 16, was ziemlich fett jugendlich ist und wiederum bedeutet, dass man sich – vom Standpunkt der Erwachsenen aus gesehen – auch mit jungen Menschen verständigen muss, will man gewählt werden. Es ist für beide Seiten ein durchaus quälender Prozess. Wenn man nicht mehr weiter weiß, liest man ein Wahlprogramm, wie kürzlich vor den Kommunalwahlen. Doch reicht das? Rebecca Baden hat die Jugendparteien gefragt: Was macht ihr für junge Wähler und Wählerinnen?
Direkt danach widmet sie sich den jungen Menschen selbst. In drei Kurzinterviews erklären Erstwählende anonym, wie sie ihre ersten aktiven Wahlen erleben – und wie sie sich im Wahlkampf-Spektakel zurechtfinden.
Im Herzen der Jugend-Subkultur rumort das Unverstandensein, gepaart mit dem Unzufriedensein und dem Wunsch nach Ausdruck und Veränderung.
Zipora und Zaza Stober erlauben uns Einblicke in ihre Leben. Sie erzählen anhand eindringlicher Beispiele davon, wie Corona, Quarantäne und der damit verbundene Verlust sämtlicher außerfamiliärer, sozialer und kultureller Lebensräume dieser Altersgruppe sich bis heute auf ihre sozio-kulturelle Entwicklung und die anderer junger Menschen auswirkt. Lustiges Studentenleben gesucht!
Immigrierte Jugendliche haben es häufig besonders schwer, sich in der neuen Kultur zurechtzufinden, denn frühkindliche Sozialisierung umfasst mehr als nur Wortschatz, Grammatik und Satzbau. Wie Sport dabei helfen kann, sich altersgerecht in einer als anders erlebten Gesellschaft zurecht zu finden und welche Werte Mannschaften und Vereine auch der allgemeinen Jugend vermitteln, zeigt der Beitrag von Domenico Laporta von der ALSS (Association Luxembourgeoise Street Soccer).
Dem derzeitigen Katastrophenjahrzehnt nicht nur mit Zukunftsangst und wütendem Protest zu begegnen scheint existentiell. Demokratie gibt es nicht umsonst. Philippe Bost vom luxemburgischen Jugendparlament stellt sich den Herausforderungen, die sich um die Themen Arbeit, Wohnen und Klima ranken und ringt um Antworten und Lösungswege für Menschen, die noch 60 Jahre und mehr vor sich haben. Hören wir ihnen zu.
Dass junge Menschen viel zu sagen – und noch mehr zu schreiben haben –, weiß Cosimo Suglia. Der Schriftsteller appelliert in einem feurigen Plädoyer an seine jungen Gleichgesinnten, ihre literarische Kunst in die Welt hinauszuschreien. Und hält gleichzeitig die Organisierenden der Literaturpreise dazu an, nationale Jugendpreise auch wirklich an die Jugend zu vergeben.
Viel zu oft setzen wir Jugendlichkeit mit Leichtigkeit gleich, doch die kleinen und großen emotionalen Krisen, die Suche nach dem Ich und die Fragen nach der Zukunft bilden nicht zu unterschätzende Gewichte. Anette Schumacher und Robin Samuel, Forschende an der Uni Luxemburg, haben das Wohlbefinden junger Menschen in Luxemburg erforscht und teilen ihre Erkenntnisse.
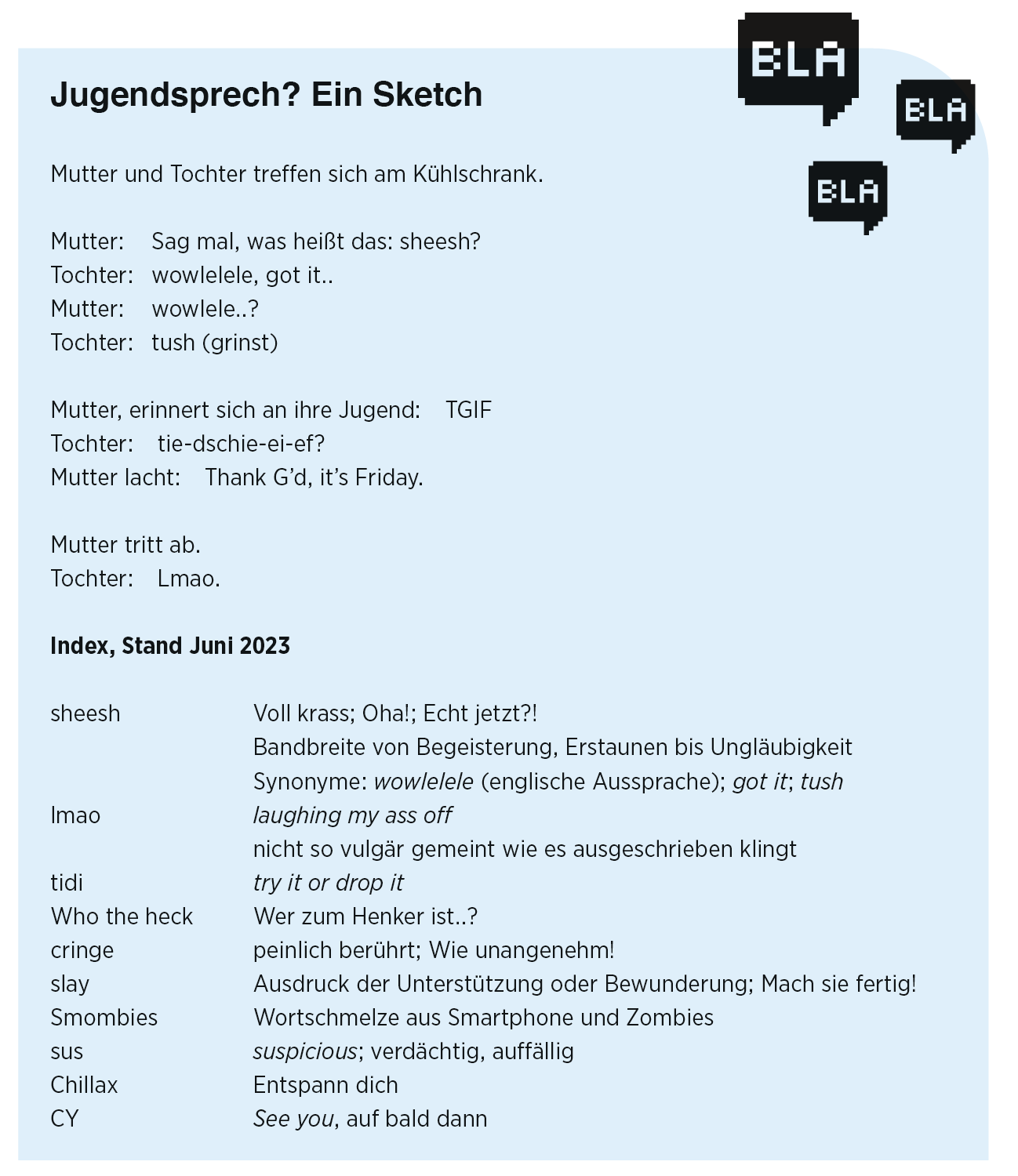
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
