Jugendschutz im Wandel der Zeit
Das Jugendschutzgesetz von 1992 im Kontext der Kinderrechte
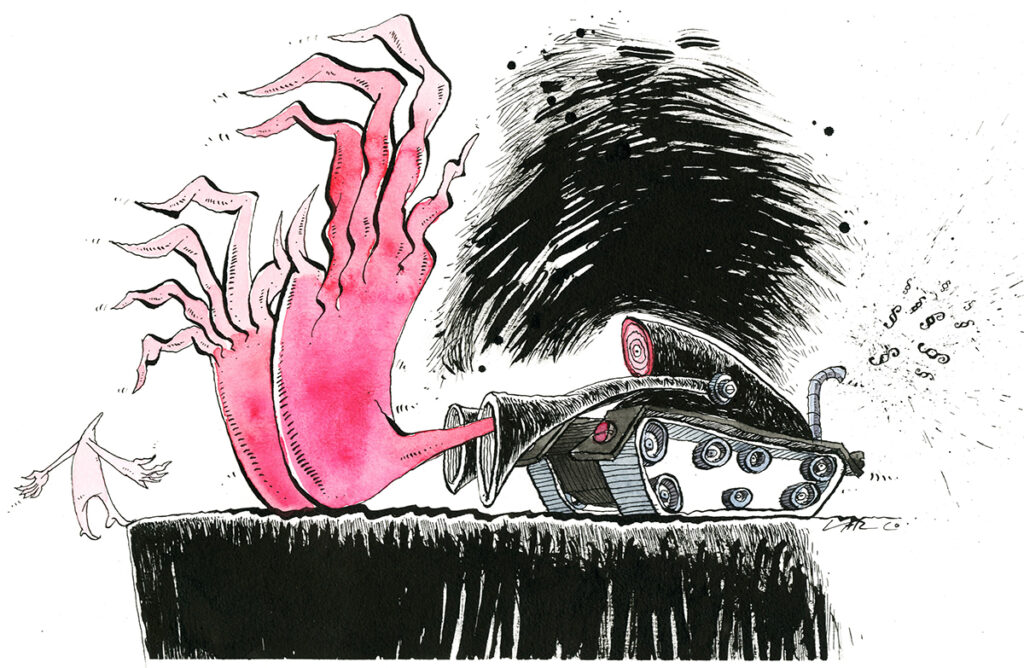
Der Umgang mit gefährdeten Kindern und Jugendlichen ist in Luxemburg durch das Jugendschutzgesetz von 1992 (loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse) geregelt. In nur 47 Artikeln nimmt sich dieses Gesetz einer erstaunlichen Vielzahl an unterschiedlichen Fällen an. So erstreckt sich der Anwendungsbereich des luxemburgischen Jugendschutzgesetzes nicht nur auf vernachlässigte und misshandelte Minderjährige, sondern regelt auch den Umgang mit straffällig gewordenen Kindern und Jugendlichen sowie solchen, die ein Statusdelikt begangen haben, also eine Handlung, die nur gesetzeswidrig ist, weil sie von einem Minderjährigen ausgeführt worden ist, wie zum Beispiel die Schule zu schwänzen oder von zuhause wegzulaufen. Damit stellt die Luxemburger Gesetzgebung ein klassisches Beispiel eines Welfare-Modells dar, welches Kinder und Jugendliche als inhärent schutzbedürftig und unfähig dazu, ihr eigenes Handeln zu verantworten, erachtet. Ungeachtet dessen, ob ein Minderjähriger selbst für seine Schwierigkeiten verantwortlich oder Opfer des Handelns anderer geworden ist, beansprucht eine Jugendgerichtsbarkeit, welche nach dem Welfare-Modell funktioniert, den Minderjährigen zu schützen. Da der Staat die Rolle eines Ersatz-Elternteils übernimmt, wird dieser Anspruch des Staates, das Kind zu schützen, hier als wichtiger eingeschätzt als die Selbstbestimmung des Kindes oder der Familie. Das Gericht entscheidet, was das Beste für den betroffenen Minderjährigen ist. Wie es für eine Gerichtsbarkeit, die sich nach dem Welfare-Modell richtet, typisch ist, bietet auch das luxemburgische Jugendschutzgesetz Richtern Spielraum bei der Entscheidung, wann und wie sie im Leben eines Minderjährigen und einer Familie intervenieren.1 So schreibt der Gesetzestext kaum vor, welche Faktoren erfüllt sein müssen, um eine der sogenannten mesures de garde, d’éducation et de préservation auszusprechen. Vielmehr liegt es im Ermessen des Gerichts, nicht nur die Handlungen von Kindern, Jugendlichen oder von ihren Eltern in seine Entscheidungen einfließen zu lassen, sondern auch strukturelle Faktoren wie die Finanz- und Wohnsituation der Eltern.
Gegen die Kinderrechte
Die Flexibilität und situationsbezogene Orientierung des nach dem Welfare-Modell aufgebauten luxemburgischen Jugendschutzgesetzes haben auf den ersten Blick ihre Vorteile. Die philosophische Ausrichtung eines Systems, das rehabilitativ und flexibel mit den Bedürfnissen von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern umgehen will, hat theoretisch das Potenzial, individuelle Lösungen für komplexe Problematiken zu finden und lösungsorientiert vor allem mit jugendlichen Straftätern zu arbeiten, anstatt diese zu verurteilen.2
Was einst ein grundlegender Schritt weg von der repressiven Ausrichtung der Jugendjustiz und des Jugendschutzes war, entspricht nicht mehr den Standards internationalen Rechts.
Trotz dieses theoretisch vielversprechenden philosophischen Ansatzes ist das Welfare-Modell in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter in die Kritik geraten. Was einst ein grundlegender Schritt weg von der repressiven und punitiven Ausrichtung der Jugendjustiz und des Jugendschutzes war, entspricht nicht mehr den Standards internationalen Rechts. In seinen regelmäßigen Überprüfungen befand das Kinderrechtskomitee der Vereinten Nationen zum wiederholten Male, dass die rechtlichen Vorkehrungen für schutzbedürftige und delinquente Minderjährige unzureichend beziehungsweise schädlich seien und nicht den Kinderrechten entsprächen.3
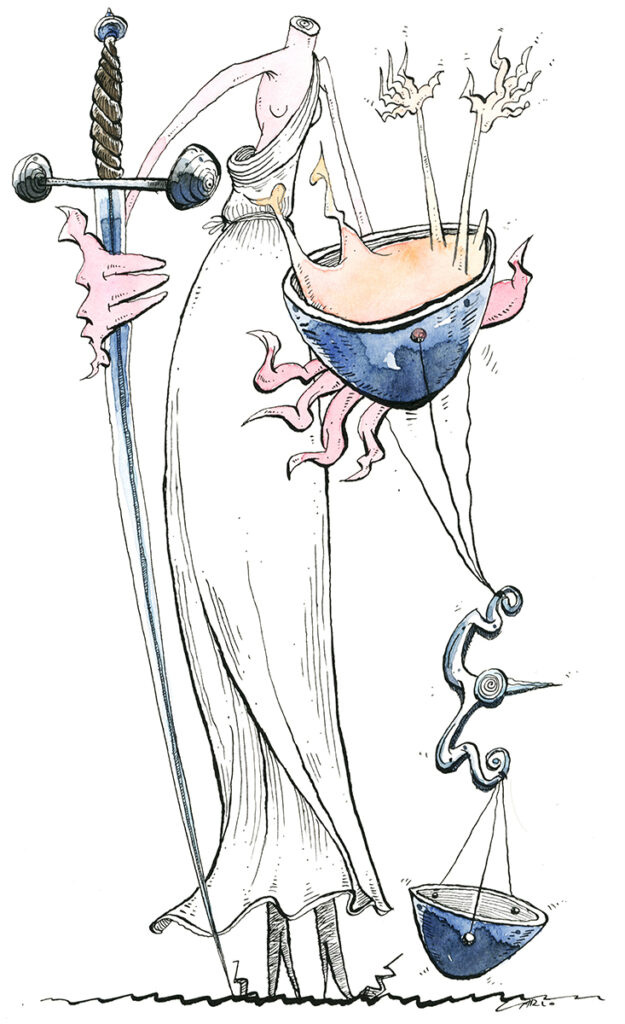
Trennung von Schutzrecht und Strafrecht
Der bei Weitem am meisten geäußerte Kritikpunkt, sowohl national als auch international, bezieht sich auf die Vermischung von Schutzrecht und Strafrecht innerhalb der aktuellen Gesetzgebung, welche weitreichende, potenziell negative Folgen für Kinder, Jugendliche und Familien hat. Da das Jugendschutzgesetz keinen Unterschied zwischen den Konsequenzen für delinquentes Verhalten und den Konsequenzen für Schutzbedürftigkeit wegen Vernachlässigung oder Misshandlung macht, außer, dass die Länge der stationären Unterbringung zum Schutz von Minderjährigen länger sein kann, falls der Minderjährige ein Vergehen oder ein Verbrechen begangen hat (Art. 3 & 4), besteht die Gefahr, dass nicht-delinquente Kinder und Jugendliche dieselben einschneidenden Maßnahmen erleben wie ein Minderjähriger, der das Gesetz gebrochen hat. Dies führt dazu, dass der Grundgedanke des Welfare-Modells, die Prävention und Rehabilitation, auf der Strecke bleibt. Rehabilitative Ansätze im Umgang mit Jugendlichen, die gegen Gesetze verstoßen haben, so wie die Diversion vom Justizapparat oder der Täter-Opfer-Ausgleich, fehlen in der aktuellen Gesetzgebung. Sogenannte restaurative Justizangebote, in denen Täter ihren Opfern Wiedergutmachung erbringen können und welche großes rehabilitatives Potenzial haben, werden unzureichend genutzt. Zwar können minderjährige Täter zu Sozialstunden verurteilt werden (Art. 1), welche im besten Fall einen Bezug zu ihrem Vergehen haben, doch eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Opfer und seinem Leiden oder gar eine Mediation zwischen Täter und Opfer kommen nicht vor. Auch Diversionsangebote, die Minderjährigen den erwiesen kriminogenen Einflüssen eines Erscheinens vor Gericht und einer Verurteilung entziehen, existieren aktuell nicht.4
Fataler Freiheitsentzug
Die repressive Natur des Jugendschutzgesetzes spiegelt sich wahrscheinlich am besten in der Praxis des Freiheitsentzugs wider. So gibt es aktuell kein Mindestalter für Strafmündigkeit in Luxemburg, was nicht im Sinne der Kinderrechtskonvention ist, und daher auch kein Mindestalter für die Einweisung in eine geschlossene Anstalt, zuzüglich des Erwachsenengefängnisses in Schrassig, in dem theoretisch auch Minderjährige als Opfer von Straftaten oder Vernachlässigung „zu ihrem Schutz“ untergebracht werden könnten. Obwohl aktuell nur jugendliche Straftäter nach Schrassig gesandt oder in der gesicherten Einheit (Unisec) im Centre socio-éducatif de l’Etat (CSEE), der staatlichen Erziehungsanstalt, untergebracht werden, wurden in früheren Jahren teilweise Minderjährige dort eingewiesen, weil sie aus einem Kinderheim oder dem CSEE weggelaufen waren.5 Da das Gesetz solche Verfahren weiterhin erlaubt, liegt es nur an der jeweils aktuellen Grundhaltung der Jugendrichter, dass sich dieses Phänomen geändert hat. Das Kinderrecht, laut dem freiheitsberaubende Maßnahmen nur als letzter Ausweg und für die kürzeste Dauer anzuwenden sind, kann und darf allerdings nicht nur durch die (vergängliche) Grundeinstellung von Richtern gewährleistet sein, sondern muss im Gesetz klar verankert werden.6
Die Vermischung von Schutz und Strafe auf gesetzlicher Ebene betrifft auch die Betreuung der Kinder und Jugendlichen. Da das Jugendschutzgesetz von 1992 sich zum Ziel gesetzt hat, Minderjährige, die das Gesetz brechen, zu schützen und nicht zu bestrafen, werden diese in denselben Institutionen betreut wie Minderjährige, welche Opfer von Vernachlässigung und Misshandlung geworden sind. Der Mix von delinquenten Jugendlichen und solchen, die keine Gesetze gebrochen haben, sondern sich selber in Gefahr bringen, indem sie zum Beispiel von Zuhause weglaufen, oder die in ihrem Elternhaus Opfer von Gewalt oder Vernachlässigung geworden sind, wirkt sich vor allem nachteilig auf besonders schutzbedürftige Minderjährige aus, die kein gesetzeswidriges Verhalten aufweisen.7
Fehlende Verfahrensgarantien
Ein weiterer wiederkehrender Kritikpunkt ist der Mangel an Verfahrensgarantien in Verfahren nach dem 1992er Jugendschutzgesetz. Minderjährige verfügen nicht automatisch über einen Anwalt, und stationäre Unterbringungen – sogar im CSEE – sind zeitlich nur auf das Erreichen des achtzehnten Lebensjahres begrenzt. Ein prägendes Beispiel der Unterschiede zwischen den Rechten von Erwachsenen in strafrechtlichen Verfahren und denen von Minderjährigen ist die Untersuchungshaft. Während die Kriterien von Untersuchungshaft für erwachsene Angeklagte klar geregelt sind, werden Minderjährige, denen eine Straftat vorgeworfen wird, zu ihrem Schutz bis zur Klärung der Umstände in geschlossenen Einrichtungen untergebracht, was einer U-Haft gleichkommt. Diese Vorgehensweise entspricht nicht der Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen für die kürzeste angemessene Zeit, wie es die Kinderrechtskonvention verlangt.
Nicht nur die Dauer der Inhaftierung ist ein Kritikpunkt, auch die Dauer aller anderen Maßnahmen, die vom Jugendgericht gesprochen werden, ist kaum zeitlich begrenzt. Nicht selten kommt es vor, dass Familien über Jahre oder gar Jahrzehnte in der Prozedur des Jugendgerichts verharren. Meist spricht das Gericht in Fällen, in denen ein Kind in Obhut genommen wird, eine sogenannte mesure de garde provisoire aus, welche bis zum achtzehnten Lebensjahr des Kindes gilt, oft über Jahre bestehen bleibt und meist alle drei Jahre bei der sogenannten révision triennale überprüft wird (Art. 37). Eine solch seltene Anpassung der Maßnahme entspricht nicht der schnellen Entwicklung Kinder und Jugendlicher in einem System, welches zu ihrem Schutz geschaffen worden ist.
Hilfe und Schutz
Das oft sehr weitreichende Vorgehen des Jugendgerichts, welches meist erst aktiv wird, wenn die Situation der Familie bereits sehr instabil ist, wird durch die gesetzliche Trennung zwischen Jugendschutz und Jugendhilfe in Luxemburg begünstigt. Die luxemburgische Kinder- und Familienhilfe wird durch die loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille geregelt und durch das Office national de l’enfance (ONE) verwaltet. Die Trennung beider Themenfelder führt dazu, dass Minderjährige und ihre Familien teils in zwei Systemen – mit unterschiedlichen Methoden und Sozialarbeitern – an denselben Problemen arbeiten, Hilfeempfänger nicht ganzheitlich betreut werden können und Informationen nur unvollständig weitergegeben werden. Vor allem die so wichtige Prävention leidet unter dieser Kompetenztrennung, da potenzielle Hilfeempfänger teilweise nicht richtig erkannt und unterstützt werden können, weil den Akteuren des Jugendschutzes nicht immer alle Fakten bekannt sind. Verschlimmert sich dann die Situation einer Familie so sehr, dass das Jugendgericht eingreifen muss, erlaubt der eingeschränkte Maßnahmenkatalog des 1992er Jugendschutzgesetzes wenig Freiraum für präventive Arbeit.
Paternalismus vs. Partizipation
Ein weiterer Bereich, der in der aktuellen Gesetzgebung zu kurz kommt, ist die Partizipation, welche neben Nicht-Diskriminierung und dem Recht auf Entwicklung als zentraler Faktor für das Kindeswohl gilt.8 Die paternalistische Grundlogik der Gesetzgebung ist inkompatibel mit moderner und kinderrechtsbasierter Sozialarbeit, welche die Zusammenarbeit mit dem Hilfeempfänger und dessen Einbindung ins Zentrum ihrer Interventionen setzt. So können Minderjährige und ihre Eltern unter dem Jugendschutzgesetz nicht ihre eigene Gerichtsakte einsehen. Sowohl vor Gericht als nach einem Urteil werden Kinder, Jugendliche und Eltern nicht im Sinne der Kinderrechtskonvention in Entscheidungen eingebunden, was vor allem im Bezug auf das Sorgerecht deutlich wird.
In Luxemburg ist in den letzten Jahren das Bewusstsein dafür gewachsen, dass die bestehende Gesetzgebung grundlegend reformiert werden muss, um den Ansprüchen eines modernen Jugendschutzgesetzes zu genügen.
Bei einer Fremdunterbringung basierend auf dem Jugendschutzgesetz von 1992 wird den leiblichen Eltern des Minderjährigen das gesamte Sorgerecht entzogen und an die Pflegefamilie beziehungsweise die Institution, in der das Kind untergebracht ist, übertragen. Auch wenn dieses Vorgehen Behördengänge und administrative Entscheidungen für den Träger oder die Pflegefamilie erleichtert, hat sich die Praxis des kompletten Entzugs des Sorgerechts überlebt. Eine Teilung des Sorgerechts zwischen Träger und Eltern erlaubt es leiblichen Eltern weiterhin, eine aktive Rolle im Leben ihrer Kinder zu spielen, Verantwortung für diese zu übernehmen und durchweg in Entscheidungen, die ihr Kind betreffen, eingebunden zu sein. So werden sie im Laufe der Zeit in ihrer elterlichen Rolle gestärkt, können zunehmend Verantwortung übernehmen, was im besten Fall eine Rückführung des Kindes in die Herkunftsfamilie erleichtert. Dieses Prinzip der geteilten elterlichen Sorge, so wie es im Scheidungsrecht bereits seit Jahren praktiziert wird, ist einer der Kernbestandteile des Gesetzesentwurfs 7994 zum Jugendschutz.
Kindeswohl und Kinderrechte im Zentrum
Auch in Luxemburg ist in den letzten Jahren das Bewusstsein dafür gewachsen, dass die bestehende Gesetzgebung grundlegend reformiert werden muss, um den Ansprüchen eines modernen Jugendschutzgesetzes zu genügen. Zum dreißigjährigen Geburtstag der Kinderrechtskonvention im Jahre 2019 versprach daher die luxemburgische Regierung dem Genfer Kinderrechtskomitee, das Jugendschutzrecht in Luxemburg noch in der aktuellen Legislaturperiode grundlegend zu reformieren und vor allem eine komplette Teilung zwischen Schutz- und Strafrecht sowie ein Mindestalter für Strafmündigkeit und Inhaftierung einzuführen.9 Den ersten Schritt zur Erfüllung dieses Versprechens tat die Regierung im April 2022 mit der Entsendung dreier Gesetzesvorhaben, die gemeinsam die veraltete Rechtsbasis ersetzen sollen, an das Parlament. So befinden sich zu diesem Zeitpunkt ein Gesetzesprojekt zum Jugendschutz (PL 7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles), ein Gesetzesvorhaben zum Jugendstrafrecht (PL 7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs) und eines bezüglich des Schutzes von minderjährigen Opfern und Zeugen in einem strafrechtlichen Verfahren (PL 7992 relatif aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale) in einem Gesetzgebungsverfahren und lassen auf eine Zukunft hoffen, in der das Kindeswohl und Kinderrechte im Zentrum aller administrativen und juristischen Eingriffe des Staates in das Leben von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien stehen.
Fanny Dedenbach arbeitet seit 2021 als Kriminologin beim Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend und koordiniert die Reform des Jugendschutzgesetzes.
1 https://www.oijj.org/sites/default/files/documentos/documental_1263_en.pdf (alle Internetseiten, auf die in diesem Beitrag verwiesen wird, wurden zuletzt am 29. August 2022 aufgerufen).
2 Fanny Dedenbach, „,Plutôt éducatif que répressif?‘ – The ramifications of the high minimum age of criminal responsibility in Luxembourg“, in: Charel Schmit et al. (Hg.), Jeunes en conflit avec la loi et les droits de l’enfant. Acquis et futurs défis pour le système de justice, Luxemburg, OKAJU Editions, 2022, S. 191-211.
3 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/158/16/PDF/G2115816.pdf?OpenElement
4 Lesley McAra / Susan McVie, „Youth crime and justice: Key messages from the Edinburgh Study of Youth Transitions and Crime“, in: Criminology and Criminal Justice 10 (2010), 2, S. 179-209.
5 http://ork.lu/files/Rapports_ORK/RAPPORT_ORK_2009.pdf
6 Für weitere Erläuterungen zur repressiven Natur des Jugendschutzgesetzes siehe Fanny Dedenbach, „Children in Prison“, in: forum 411 (November 2020), S. 42-44.
7 Alexandra Spain, „Bullying among young offenders: findings from a qualitative study“, in: Jane Ireland (Hg.), Bullying among prisoners. Innovation in theory and research, Oregon, Willan Publishing, 2005, S. 62-83.
8 https://tinyurl.com/bettercarenetwork
9 https://tinyurl.com/PledgeByLux
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
