- Gesellschaft, Politik
Konkordanz statt Konkurrenz
Ein Gespräch mit Erny Gillen über die Revitalisierung der Demokratie
Ist unser demokratisches System in der Krise? Ist es den großen Aufgaben der Gegenwart und Zukunft noch gewachsen? Welche Schritte wären notwendig, um die Akzeptanz der Institutionen zu steigern und die Effizienz der Politik zu verbessern? forum-Mitarbeiter Pierre Lorang traf sich zum Meinungsaustausch mit dem Ethikexperten Erny Gillen.
Pierre Lorang: Jahrzehntelang wurde die Demokratie, wie wir sie kennen, nicht oder kaum hinterfragt. Heute aber durchlebt sie eine Vertrauenskrise. Man denke an die USA, Brasilien, die Türkei, Polen, Ungarn oder sogar Italien, Frankreich, die Niederlande … Viele Menschen haben Sehnsucht nach der starken Hand, selbst wenn dies bedeutet, dass Grundrechte beschnitten werden, die Justiz ihre Unabhängigkeit verliert und die Presse an die kurze Leine gelegt wird. Ist die Demokratie westlicher Prägung etwa nicht naturgegeben?
Erny Gillen: Nein, das ist sie nicht. Die Demokratie erfordert eine kontinuierliche kulturelle Anstrengung. Der Mensch als Einzelperson, aber auch die Gemeinschaften, die eine Gesellschaft begründen, müssen sich investieren und einbringen, damit das Zusammenleben nicht dem Zufall überlassen bleibt. Wenn die Demokratie, also die Herrschaft des Demos, des Volkes, sich in Europa und anderswo etabliert hat, dann allein deswegen, weil die Menschen den Entschluss fassten: „Wir wollen nicht mehr beherrscht werden.“ Es ist dies eine negativ formulierte Freiheit von etwas, d. h. die Freiheit von einem Herrscher. Daraus entwickelten sich hybride Formen von repräsentativer Demokratie. Man wählt sich Vertreter, die für eine bestimmte Zeit Macht ausüben dürfen.
Ich befürchte allerdings, dass dieses System derzeit dabei ist, sich totzulaufen. Warum? Weil es einen neuen Berufszweig geschaffen hat: den Berufspolitiker. Eine komplett institutionalisierte Demokratie widerspricht aber dem tieferen Sinn und Zweck der Demokratie. Sicher war die Institutionalisierung bis zu einem gewissen Punkt nützlich und notwendig. Doch sie hätte sich weiterentwickeln müssen, nicht stehenbleiben dürfen.
„Rückwärtsgewandt in die Zukunft“
P.L.: In Luxemburg hat das System seit über hundert Jahren, also der Einführung des allgemeinen Wahlrechts 1919, in der Tat nur ganz wenig evoluiert. Es funktioniert und wird doch zusehends in Frage gestellt. Während der Coronapandemie wurde bei einem Teil der Bevölkerung eine Erosion des Grundvertrauens deutlich. Viele junge Leute machen sich Sorgen, ob unsere Institutionen – Chamber, Regierung, Staatsrat, Berufskammern usw. – überhaupt in der Lage sind, existenziellen Herausforderungen wie der Klimakrise zu begegnen.
E.G.: Generell glaube ich, dass die demokratische Entwicklung mit der wirtschaftlichen Entwicklung gekoppelt ist. Die Akzeptanz der Demokratie beruht darauf, dass sie Wohlstand und sozialen Fortschritt gefördert hat. Das Erreichte und zum Teil hart von den kleinen Leuten Erkämpfte wurde in den letzten Jahrzehnten jedoch zu einem als selbstverständlich betrachteten Besitz. Daraus entstand eine Attitüde von Besitzstandswahrung – ein gewaltiger Paradigmenwechsel, dessen Folgen noch nicht abzuschätzen sind. Walter Benjamin bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: „Rückwärtsgewandt in die Zukunft“. Das heißt: Wir blicken nicht nach vorne, in die Zukunft, sondern nach hinten, weil wir unseren Wohlstand retten wollen. Frühere Elterngenerationen wollten, dass es ihren Kindern einmal besser ginge. Heute hofft man, dass es ihnen nicht schlechter ergehen wird. Wenn die Zukunft im Grunde die Vergangenheit bewahren soll, leben wir in der permanenten Gegenwart. Wir glauben nicht mehr an eine offene Zukunft. Deshalb fühlen sich junge Menschen, die nach vorne schauen, von den Älteren unverstanden und alleingelassen.
P.L.: Neben dem saturierten und zugleich ängstlichen Besitzbürgertum gibt es aber auch die Abgehängten, die working poor, die erfahren müssen, dass das Wohlstandsversprechen des Kapitalismus für sie nicht mehr gilt.
E.G.: Ja, das stimmt. Obschon diese Realität in anderen Ländern schwerer wiegt als in Luxemburg, wo das soziale Netz enger gestrickt ist. Die Bevölkerung leitet daraus in gewisser Weise ein unveräußerliches Recht ab: „Ich habe als Bürger das Recht, versorgt zu werden.“ Allerdings hat dieses Selbstverständnis Risse bekommen durch die multiplen Flüchtlingskrisen. Plötzlich wurden da Menschen unterstützt, die noch nicht den Status des Bürgers hatten. Bei einigen führte das zu Unstimmigkeiten und Frust, weil sie den Eindruck hatten, als Bürger gegenüber Nichtbürgern benachteiligt zu werden.
Gouverneure des Gemeinwohls
P.L.: Wo können wir denn, auf Luxemburg bezogen, die Demokratie kurz- und mittelfristig verbessern, damit die Menschen sich wieder stärker als verantwortlich gestaltende Citoyens empfinden?
E.G.: Zuallererst müssten sich die gewählten Politiker nicht als Manager des Gemeinwohls, sondern als Gouverneure des Gemeinwohls begreifen. Der Manager ist ein Macher, er arbeitet im System; der Gouverneur gestaltet, er arbeitet am System. Wer also für die Bürger tätig ist, muss diese in die Entscheidungen miteinbeziehen. Governance bedeutet nicht, das Volk zu regieren, sondern den Bürgern Optionen zu bieten, die ihnen ein gutes Leben ermöglichen. Zu einer freien Gesellschaft gehört die Pluralität der Meinungen und Lebensformen. Es geht also um die Gestaltung des Raumes, in dem Zusammenleben stattfinden kann. Die gewählten Politiker sollten aufgrund ihrer Prärogative die adäquaten Rahmen für Gespräche und Debatten von interessierten Bürgern setzen, mit ihnen kooperieren, sie bestimmen lassen. Im Gemeindegesetz sind solche Formen von Bürgerentscheidung z. B. auf Quartiersebene vorgesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, ähnlich wie in der Schweiz, sowohl auf kommunaler als auch auf nationaler Ebene regelmäßig Volksabstimmungen durchführen.
P.L.: Herrje, das wäre ja dann direkte Demokratie! Nach der Erfahrung mit dem Referendum von 2015 glaube ich nicht, dass die politische Klasse in Luxemburg darauf noch Lust hat.
E.G.: Hier kommt die kulturelle Dimension der Demokratie ins Spiel. Es ginge darum, ein Verständnis und einen Habitus zu schaffen: Die Bürger müssten wissen, worüber sie abstimmen. Sie müssten auf die Sache fokussiert sein und sich nicht von Motiven leiten lassen, die damit nichts zu tun haben. Die Schweizer haben dies in vielen Jahrzehnten verinnerlicht. Ich schlage nicht vor, deren System einfach so zu übernehmen. Aber zumindest könnten wir uns überlegen, wie auch Luxemburg ein Stück weit mehr direkte Demokratie wagen könnte. Als kleines Land könnten wir es uns leisten, ein bisschen experimentierfreudiger zu sein und einfach mal neue Dinge auszuprobieren.
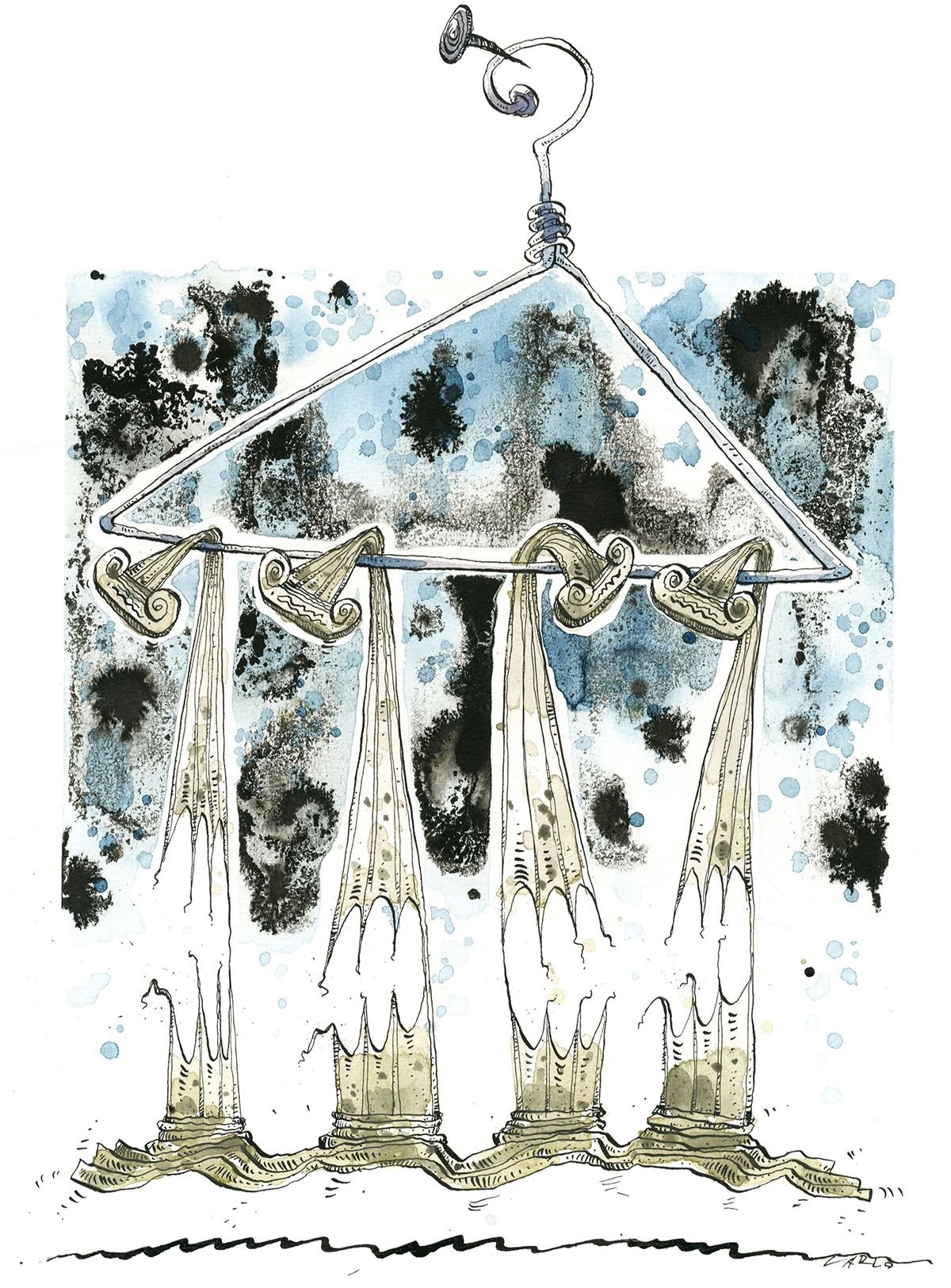
P.L.: Dazu könnte auch die Direktwahl der Bürgermeister gehören, wie in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Italien. Es wäre ein probates Mittel, dem Parteienklüngel nach Kommunalwahlen mit teils abenteuerlicher Koalitionsbildung und undurchsichtiger Postenvergabe ein Ende zu bereiten. Die demokratische Legitimität des Gemeindeoberhaupts würde gestärkt.
E.G.: Man könnte sogar noch weiter gehen und die Konkordanz spielen lassen. Die Parteien im Gemeinderat wären anteilig ihrer Sitzstärke im Schöffenkollegium vertreten. Dieses wiederum müsste sich bei jeder Abstimmung im Gemeinderat um Zustimmung bemühen. Für mich ist es ein Wahnsinn, wenn nach Wahlen in einer parlamentarischen Versammlung die Welt in eine Majorität und eine Opposition zerfällt, obschon jeder einzelne Gewählte exakt die gleiche Legitimität besitzt. Die berüchtigten 31:29-Abstimmungen in der Chamber belegen die Substanzlosigkeit dieses Systems. Vor allem bei wichtigen Gesetzen kann es zur Farce mutieren, weil die Abgeordneten nur noch Automatismen gehorchen. Das ist nicht gut
– weder für die Qualität der Gesetzestexte noch für das Ansehen des Parlaments.
P.L.: Die Volksvertreter entledigen sich ihrer persönlichen Verantwortung und agieren als Parteisoldaten. Sie unterwerfen sich dem Fraktionszwang, den es laut Verfassung gar nicht geben dürfte. Da kommt es schon mal vor, dass sie gegen ihre inneren Überzeugungen stimmen. Das Parlament entmündigt sich selbst, es betreibt seine eigene Verzwergung.
E.G.: So ist es.
Der Klimawandel pfeift auf die Demokratie
P.L.: Die Frage sei erlaubt: Ist die größte, die epochalste Herausforderung, mit der die Menschheit konfrontiert ist, nämlich der Klimawandel, mit dieser Form von inszenierter demokratischer Praxis auch nur ansatzweise zu bewältigen? Eins ist jedenfalls sicher: Dem Klimawandel ist die Demokratie vollkommen egal. Er nimmt keinerlei Rücksicht auf die langsam mahlenden Mühlen von schwerfälliger Kompromissfindung. Im Gegenteil, er wird für die Demokratie sogar lebensbedrohlich, nämlich dann, wenn viele als letzten Ausweg nur noch eine Art Ökodiktatur sehen. Von daher wäre es höchste Zeit, das demokratische System zu befähigen, schnell, konsequent und möglichst einvernehmlich zu agieren, damit hier und jetzt die richtigen, objektiv notwendigen, weil wissenschaftlich fundierten Maßnahmen getroffen werden.
E.G.: Die EU-Kommission hat diesen Weg mit dem European Green Deal beschritten.
P.L.: Ja, und das Europaparlament hat schon 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Ein Notstand aber verlangt andere Maßnahmen als Business as usual. Die globale Menschheitsaufgabe des Klimaschutzes ist nicht minder bedeutsam als der Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Geldsummen, die für die Reparation entstandener Schäden, die Prävention mit Blick auf drohende Schäden sowie die Transition vom fossilen ins nichtfossile Zeitalter benötigt werden, sind unfassbar gewaltig. Die herkömmlichen Instrumente und Regularien staatlicher Finanzpolitik müssen da kapitulieren. Noch ein paar Gluthitzesommer, und ganz Südeuropa ist verbrannt. Riesige Landstriche in Afrika werden für die Menschen unbewohnbar, Hunderte Millionen werden sich neue Lebensräume suchen müssen …
E.G.: Ich sage jetzt mal was Brutales: Es gab in der Geschichte schon viele sogenannte Zivilisationen, die untergegangen sind. Doch waren dies regionale Entitäten: das Römische Reich, die Azteken, die Babylonier, Osmanen und Mongolen, das altägyptische Pharaonenreich … Heute leben wir in einer Weltkultur, als Teil der Weltbevölkerung, die riskiert, schlafwandelnd ihrem Ende entgegenzuschreiten. Wir wollen es nur nicht wahrhaben.
P.L.: Gerade deswegen bin ich der Überzeugung, dass unsere Demokratien jetzt und bis auf Weiteres von Konkurrenz auf Konkordanz umsatteln müssten. Für Luxemburg würde das bedeuten, dass nach den kommenden Wahlen alle vier großen Parteien in einer kollegialen „Klimaregierung“ vertreten sind. Nicht um in der Chamber mit einer satten Mehrheit durchregieren zu können, sondern um gemeinsam – im Dialog mit der Wissenschaft, dem Parlament sowie allen relevanten Kräften und Interessengruppen – die Klimapolitik zu entwerfen, die sich unaufschiebbar aufdrängt. EU-Kommission und EU-Parlament machen es ja weitgehend vor. Und die Schweiz mit ihrem Konkordanzmodell ist ja nun wirklich das Gegenteil eines gescheiterten Staates.
E.G.: In der Tat, ja. Für die Demokratie könnte es ein Qualitätssprung sein. Nicht zuletzt weil damit auch die Chamber aufgewertet würde. Das artifizielle Blockdenken mit Mehrheits- und Oppositionsfraktionen wäre nicht mehr determinierend. Jede Fraktion, jeder einzelne Gewählte wäre in der Entscheidungsfindung nach bestem Wissen und Gewissen frei, müsste also bei jedem eingebrachten Gesetzentwurf Farbe bekennen und Eigenverantwortung übernehmen. Sollte es dann mal vorkommen, dass ein Text aus diesem oder jenem Ministerium die parlamentarische Hürde nicht schafft, wäre dies kein Unglück, das eine Regierungskrise oder sogar Neuwahlen provozieren würde. Die politischen Inhalte stünden im Mittelpunkt, nicht das Taktieren der Parteien.
Auf jeden Fall müsste bei solchen „nationalen Koalitionen“ oder Konkordanz-Systemen verfassungsrechtlich und strukturell dafür gesorgt werden, dass ein starkes Parlament und eine breit aufgestellte Regierung mittels wirksamer institutioneller und zivilgesellschaftlicher Checks and Balances kontrolliert werden, um das Risiko, dass am Volk vorbei regiert wird, zu minimieren. Demokratie muss sich inhaltlich immer wieder neuen Fragen stellen; sie muss sich aber auch in der Struktur weiterentwickeln.
(Das Gespräch fand am 29. August 2023 statt.)
Lesen Sie dazu auch unsere Dossiers 402 Zukunft der Demokratie (2020) und 323 Mehr Demokratie wagen (2012) im forum-Heft oder online auf www.forum.lu.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
