- Literatur
Luxemburger Standarddeutsch.
Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache in Luxemburg von Heinz Sieburg, Berlin, Duden, 2022, 208 S., 18 €
Ist Luxemburg ein deutschsprachiges Land? Das wird wohl die erste Frage sein, die sich viele Lesende des Wörterbuchs zum Luxemburger Standarddeutsch stellen werden. Nur wer sie mit Ja beantwortet, wird Heinz Sieburgs nicht uninteressante These einer eigenständigen Variante des Deutschen in Luxemburg nachvollziehen können. Er stützt sich hierbei auf das linguistische Konzept der Plurizentrizität: Deutsch gehört zu den sogenannten plurizentrischen Sprachen, die in mehreren Ländern den Status einer Verwaltungs- oder Staatssprache haben, was die Ausbildung eigenständiger nationaler und regionaler Varietäten innerhalb der jeweiligen Sprachgemeinschaft begünstigt. Die lange wirkmächtige These eines mononormativen Binnendeutschs aus Deutschland wird durch ein gleichberechtigtes und wertfreies Nebeneinander der nationale Varianten abgelöst. Sieburg zieht mehrfach Parallelen zum Status des österreichischen Deutschs sowie des Schweizerhochdeutschs, um seine Argumentation zu untermauern. Ob sich die spezifische Sprachensituation Luxemburgs, insbesondere in Bezug auf das ambivalente Verhältnis zum Deutschen, mit jener der letztgenannten Länder vergleichen lässt, ist jedoch fraglich.
Dass in Luxemburgs Zeitungen tatsächlich ein anderes Deutsch geschrieben wird als in Deutschland, illustriert der Band jedoch mit einer akribisch aufgearbeiteten Fülle an sprachlichen Belegen. 1.300 Einträge verzeichnet das Wörterbuch, wobei u. a. die Aussprache, grammatische Merkmale, Bedeutungsangaben, Häufigkeit sowie Kontextbeispiele der Stichwörter aufgeführt werden. Nicht überraschend ist ein Großteil der Lemmata auf die linguistische Kontaktsituation zum Französischen zurückzuführen, z. B. Proximität, konvivial, Serenität, Visibilität… Interessant – weil oberflächlich oft nicht als Lehnwort erkennbar – sind vor allem an das Französische angelehnte Übersetzungen, wie Krisenzelle (frz. cellule de crise), Fahrradpiste (frz. piste cyclable) und sanfte Mobilität (frz. mobilité douce). Auch das kreative Wortbildungspotenzial des Deutschen wird sich zunutze gemacht: Hybride Zusammensetzungen aus einem entlehnten und einem deutschstämmigen Wort zeugen von einem innovativen Umgang mit der Sprache: Ämterkumul, Schulrentrée, Tierasyl.
Daneben werden auch Entlehnungsprozesse aus dem Luxemburgischen beobachtet, wobei zwischen Zitat und integriertem Lehnwort nur schwer zu differenzieren ist: Bongert, Fouer, Hämmelsmarsch. Weniger augenfällig sind semantische Unterschiede, die insbesondere Verben betreffen und wohl auch auf den Einfluss des Luxemburgischen zurückzuführen sind, so rennen Autos bei Verkehrsunfällen in Hindernisse, eine Ausdrucksweise, die man in diesem Kontext im Ausland nicht findet. Bei anderen Belegen stellt sich jedoch die Frage der Relevanz: Wieso z. B. Vakanz Doheem – eine zeitlich begrenzte Kommunikationskampagne der Regierung in Coronazeiten – aufgeführt wird, ist schwer nachvollziehbar.
Erstaunlicherweise ist Sieburgs Werk nicht die erste Untersuchung der in Luxemburg gebräuchlichen deutschen Sprache. Bereits 1964 veröffentlichte Doris Magenau eine gleichartige Studie1, auch damals in einer Sonderreihe des Dudenverlags. Obwohl über ein halbes Jahrhundert zwischen beiden Arbeiten liegt, kommen sie zu ähnlichen Ergebnissen, die jedoch gänzlich anders interpretiert werden. Magenau wertet das Binnendeutsche als alleinigen Standard und deutet Abweichungen eher als Fehler denn als legitime Varianten. Auch das Luxemburgische wird z. B. noch durchgängig als Mundart und nicht als eigenständige Sprache verstanden. Trotz dieser teilweise veralteten Sichtweisen zeichnet ihre Arbeit bisweilen ein differenzierteres Bild als das neue Wörterbuch. So werden Anzeigen und Lokalteil der zu untersuchenden Periodika gesondert analysiert, um etwaige Unterschiede im Sprachgebrauch der jeweiligen Textproduzenten herausarbeiten zu können. Auch die Literatur, neben der Tagespresse der einzige größere Korpus deutscher Sprache in Luxemburg, wird in die Analyse miteinbezogen, mit durchaus stichhaltigen Ergebnissen. In dieser Hinsicht wird Sieburgs Wörterbuch seinen hohen Ansprüchen nur bedingt gerecht. Drei größere Tageszeitungen, die über 14 Jahre ausgewertet werden, stellen einen überraschend kleinen Datenpool dar. Literarische Werke, born digital-Quellen (z. B. Twitter), aber auch Staats- und Gemeindepublikationen hätten den Quellenkorpus erweitern und v. a. diversifizieren können. Anhand von Belegen aus drei Tageszeitungen auf eine eigenständige, standardisierte Varietät zu schließen, ist nicht vollkommen überzeugend.
Nichtsdestotrotz stellt das Wörterbuch einen wertvollen Beitrag zur Sprachdebatte Luxemburgs dar, der hoffentlich weitere Impulse liefert, um sich – sowohl auf einer wissenschaftlichen als auch auf einer gesellschaftlichen Ebene – mit der Stellung des Deutschen in Luxemburg auseinanderzusetzen.
1 Doris Magenau, Die Besonderheiten der deutschen Schriftsprache in Luxemburg und in den deutschsprachigen Teilen Belgiens, Mannheim, Dudenverlag, 1964.
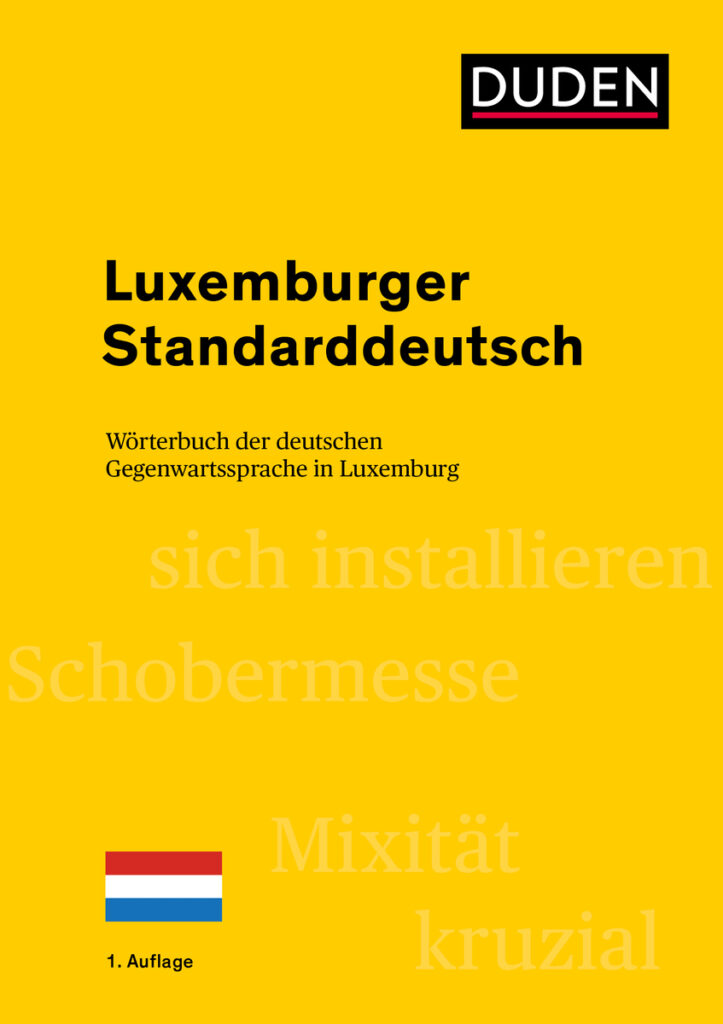
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
