- Suffizienz
Rationierung: Irr- oder Ausweg?
Potion magique nur noch mit Lebensmittelkarte
Die Idee einer notwendigen Rationierung des Konsums wird mittlerweile von der französischen Regierung befürwortet. Das Magazin Socialter hat sich kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt.
Für die französische Linke dürfte Präsident Emmanuel Macron derzeit der meistgehasste Mann im hexagone sein. Seine Rentenreform und vor allem sein Umgang mit der parlamentarischen und außerparlamentarischen Opposition haben zu einer dramatischen Polarisierung rund um die „soziale Frage“ geführt. Das könnte vergessen lassen, dass Macron im April 2022 zwar als Hüter von Fortschritt, Wohlstand und Stabilität gewählt wurde, vier Monate später aber schon das Ende des Überflusses, der Gewissheiten und der Sorglosigkeit („abondance, évidences, insouciance“) verkündete. Im Kontext der steigenden Energie- und Lebensmittelpreise und der großen Trockenheit richtete sich die Aufmerksamkeit vor allem darauf, wie der Präsident die Verknappung von Rohstoffen, Ackerland und Wasser thematisierte.
Sollte sich die politische Linke, die auch in Frankreich für ökologische und soziale Ideen einsteht, also freuen, dass der Zentrist Macron endlich die Grenzen des Wachstums anerkennt?
Der Staat als Retter?
Freudigen Beifall haben Macrons Aussagen nicht wirklich gefunden, aber sie waren ein Ansporn, die linken Positionen zu Überfluss und Verknappung zu überdenken. „Die Regierenden in Frankreich und anderswo drängen ihre Bevölkerungen dazu, den Gürtel enger zu schnallen und sich mit Resilienz gegen die kommende Verknappung zu wappnen“, steht in der Einleitung zum Dossier (S. 19) des linksgrünen Magazins Socialter. Das Magazin hatte seine Jahreswechsel-Ausgabe dem Thema „Rationierung“ gewidmet.
Interessant ist, dass sich das Dossier keineswegs auf das tröstliche Paradigma der Genügsamkeit konzentriert, sondern die Idee von unwillkommenen Einschränkungen akzeptiert. Thema sind eher die Regeln, nach denen die Ressourcen verteilt werden, und die Warnung vor Alibi-Lösungen wie der Spar-Kampagne der Regierung, bei der es um écogestes (Öko-Gesten) statt strukturellen Veränderungen geht. Hinzu kommt die Sorge, dass die Notwendigkeit von vorgegebenen Einschränkungen beim Konsum in eine grüne Technokratie oder gar in einer Ökodiktatur und einem Überwachungsstaat mündet.
Im Beitrag „Mode survie activé?“ (S. 21) hinterfragt der Autor das in der Umweltbewegung beliebte Paradigma der Resilienz. Er zitiert den Sozialwissenschaftler Thierry Ribault, der die unter Macron initiierten Untersuchungen und Strategien kritisch beleuchtet. Die anvisierte „Strategie der nationalen Resilienz“ der Regierung beruhe demnach auf drei Säulen: der „Fatalisierung“, der Individualisierung und der Angstmacherei. Es gehe darum, die Krisen als unausweichlich darzustellen und so nur ihre Auswirkungen, nicht aber ihre tieferen Ursachen zu bekämpfen – zum Beispiel, indem man auf Atomenergie statt auf Energiesparen setzt. Wichtig sei in diesem Narrativ auch, die Verantwortung auf die Individuen abzuwälzen, mit Aufrufen zu Öko-Gesten Schuldgefühle zu erzeugen und von einer Diskussion über die notwendigen Rahmenbedingungen einer Ökologisierung abzulenken. Schließlich zielten Aussagen wie die anfangs zitierte von Macron einerseits darauf ab, Ängste zu schüren; andererseits darauf, die Regierungspolitik als einzige Alternative darzustellen.
Spätestens hier wird die Parallele zur Covid-Krise deutlich. Socialter scheut sich nicht davor, ein Schreckensszenario neoliberaler Krisenverwaltung auszumalen (S. 26): Wie 2020 käme es darin zu massiven Einschränkungen und Kontrollen, flankiert von Aufrufen zum Zusammenhalt der Nation. Am Ende würde die Regierung die industrielle Landwirtschaft, die Atom- und die Kohleindustrie „gezwungenermaßen“ ausbauen. Die Grundrechte stünden in Frage, nicht aber das Wachstum und der Profit. Das Szenario illustriert Ribaults These, Neoliberalismus sei nur „mit Resilienz, nicht aber mit Resistenz“ vereinbar – also dem Widerstand gegen die Ursachen der Katastrophe. Wie Macron neoliberale Politik als Ergebnis von Sachzwängen alternativlos durchsetzen will, ist nach dem Erscheinen der Socialter-Nummer im Kontext der Rentenreform klarer geworden.
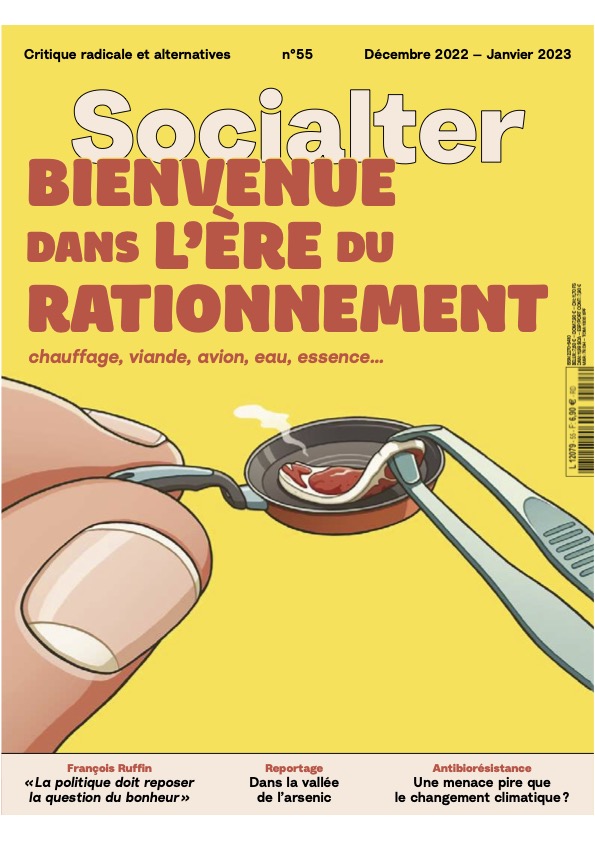
Die Art, wie Socialter die Covid-Restriktionen als Musterfall „neoliberaler sozialer Kontrolle“ aufgreift, erinnert daran, wie verschieden der Umgang der Linken mit der sanitären Krise von 2020 war. In Ländern wie Luxemburg und Deutschland brandmarkten große Teile des fortschrittlichen Lagers die Kritik an Lockdown, Pharmaindustrie und Impfpflicht als Verschwörungstheorien oder gar „faschistisch“, schlugen sich auf die Seite des „schützenden“ Staates oder forderten noch strengere Maßnahmen. In Frankreich dagegen gab es in der Linken ein breites Spektrum an kritischen Positionen gegenüber den Covid-Maßnahmen der Regierung. Dabei bildete der esprit gaulois – das kulturell valorisierte Rebellentum und das Misstrauen gegenüber den Mächtigen – die Grundlage für sowohl systemkritische als auch verschwörungstheoretische Ansätze – und für eine fruchtbare Auseinandersetzung innerhalb der Linken.
Freiheitsbeschränkungen oder Sozialismus?
Auch beim Thema Rationierung schafft es die ökosoziale Kritik nicht ohne innere Widersprüche, das macht eine aufmerksame Lektüre des Socialter-Dossiers deutlich. So steht der Furcht vor einer autoritären Mangelverwaltung das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Zwangsmaßnahmen gegenüber. „Angesichts der kommenden Katastrophen müssen auch wir das Instrument der Rationierung ernstnehmen“, heißt es etwa in der Einleitung. „Welche unserer Nutzungen und Konsumptionen könnte man rationieren, um den ökologischen Schaden zu begrenzen, und wie?“
Das Heft stellt anschließend sechs Bereiche vor, vom Autoverkehr bis hin zum Wohnen (S. 29). Die Zahlenangaben und Handlungsperspektiven sind interessant, allerdings unterscheidet es nicht zwischen direkten (Vor-Ort-Emissionen usw.) und indirekten (Fußabdruck) Auswirkungen auf die Umwelt. Gerade beim Thema Konsum ist die empreinte écologique allerdings ein wichtiges Paradigma.
Klar ist, dass die linke Version der Rationierung an erster Stelle „die Reichen“ treffen soll, die ja in der Tat einen besonders hohen Anteil an der Umweltzerstörung haben (insbesondere unter Berücksichtigung des Fußabdrucks). Im Gegenzug zeigt Socialter bemerkenswert viel Verständnis für diejenigen, die überdurchschnittlich viel Treibstoff benötigen, „weil sie keinen Anschluss an den öffentlichen Verkehr haben“ – wenig verwunderlich nach dem von der Linken unterstützten Aufstand der gilets jaunes von 2018.
Gleichsam sprechen sich mehrere Dossier-Artikel gegen eine „Rationierung über den Preis“, also gegen eine zentrale Rolle der Ökosteuern, aus. Dafür liefern Beispiele sozialer Verwerfungen gute Begründungen: Durch den Anstieg der Energiepreise seit Anfang 2022 – von Ökoliberalen als überfälliges Preissignal gefeiert – können manche Haushalte mit niedrigem Einkommen ihre Wohnung kaum noch heizen. Andere Beiträge, insbesondere jener zur Bedrohung der Freiheit durch die Rationierung (S. 37) favorisieren drastische Eingriffe in die „Konsumfreiheit“ bis hin zu Verboten. Dabei blenden sie aus, dass Geld- und Warenwirtschaft auch eine Form individueller Freiheit garantieren: Steigende Fleisch-, Soja- und Wasserpreise reduzieren den Verbrauch, lassen dem Individuum aber die Wahl zwischen einem Steak (oder Soja-Steak) und einem Vollbad.
Paradox ist, dass Socialter die Idee einer carte carbone, also eines individualisierten CO2-Budgets, wohlwollend aufgreift. Anstatt klimaschädliche Güter separat zu rationieren – zum Beispiel 20 Liter Benzin und 40 Kubikmeter Gas pro Kopf im Monat – würde jeder Person eine gewisse CO2-Quote zugeteilt, wie dies bereits für energieintensive Betriebe im Rahmen des EU-Emissionshandels (ETS) praktiziert wird. Diese können die Bürger und Bürgerinnen dann nach Belieben „ausgeben“: Bei jedem Kauf wird auch der CO2-Verbrauch des Produkts oder der Dienstleistung von der carte carbone abgebucht. Anders als bei Preismechanismen ist hier eine absolute Gleichheit zwischen den Individuen sichergestellt. Allerdings gehört zu diesem Modell – wie beim ETS – die Möglichkeit, Emissionsrechte zu verkaufen und hinzuzukaufen. Reichsein lohnt sich also immer noch. Das Modell hat prominente Befürworter*innen, darunter der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty und der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber. Der grüne Realo Robert Habeck hingegen hält nichts von der Idee und setzt als deutscher Wirtschafts- und Umweltminister auf Strukturwandel statt auf „individuelle Klima-Kontrolle“.
Klar ist, dass die linke Version der Rationierung an erster Stelle „die Reichen“ treffen soll, die ja in der Tat einen besonders hohen Anteil an der Umweltzerstörung haben.
Dieser Haltung entspricht auch die These des abschließenden Artikels im Socialter-Dossier (S. 44): Die Alternative zu einer autoritären Verteilung der Ressourcen von oben nach unten ist die „autolimitation démocratique des besoins“, also die demokratisch entschiedene Selbstbeschränkung. Der Artikel verweist auf die Wichtigkeit der linken Reflexion über Konsum, wie zum Beispiel beim Sozialphilosophen André Gorz. Dieser hatte die Forderung nach einer an den Bedürfnissen orientierten Produktion als politisch subversiv hervorgehoben und klargestellt, dass eine solche Reorientierung die Kontrolle über die Produktionsmittel und damit eine ökonomische Umorientierung voraussetze.
Erstrebenswert wäre in diesem Sinne eine selbstorganisierte, „konviviale“ Gesellschaft, in der, nach Ivan Illich, „der Mensch das Werkzeug kontrolliert“. Dabei steht Socialter eher für eine libertäre Linke, der sowohl die Auswüchse der sowjetischen Planwirtschaft als auch der französischen Nuklear-Technokratie bewusst sind. Im Wissen, dass der klimatische Wandel schneller verläuft als der politische, empfiehlt der Artikel schließlich, bei allen Risiken der Technokratisierung das Thema Rationierung aufzugreifen: Es könne demnach helfen, die Fragen der Bedürfnisse, der Verteilungslogik und der ökologischen Begrenzungen in die öffentliche Debatte zu tragen. Zusammenfassend lässt sich jedenfalls sagen, dass es dem Socialter-Team gelungen ist, einen vielseitigen und anregenden Einstieg in die Materie zusammenzustellen.
Raymond Klein arbeitet als Umwelt- und Wirtschaftsjournalist bei der woxx.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
