- Corona, Gesellschaft, Klima
Virus trifft Jugendkultur – ein Zeitzeugenbericht
Verlorene Jahre
Wer heute zwischen zwölf und 20 Jahre alt ist, hat durch die Corona-Pandemie entscheidende Jahre seiner Jugend verpasst. Sie sind einfach weg. Alles wurde anders. Wir sind 18 und 20 Jahre alt. Wo wir jetzt in unserer Persönlichkeitsentwicklung stehen, wissen wir nicht genau. Es fühlt sich aber so an, als ob wir richtig etwas verpasst hätten. Als wären wir nicht da, wo wir sein sollten. Innerlich. Äußerlich sieht alles normal aus. Ist es aber nicht.
Vor Covid hatten wir Sport, Auditionen, Konzerte, Museen, Straßenfeste, Theater, Tanzveranstaltungen, Workshops… Als Besucherinnen, als Teilnehmerinnen, als Künstlerinnen. Wir wuchsen in die Kultur hinein, hatten Spaß und jede Menge Kontakte zu Jung und Alt. Wir erlebten, wie andere Kultur machten. Wir lernten, selbst Kultur zu machen. Wir wussten gar nicht, wie besonders das war, wofür wir es brauchten. Es geschah ganz einfach: mit uns, in uns und um uns herum. Wir wuchsen an den Erfahrungen, an den Herausforderungen. Dann kam das Virus.
Nach zwei Jahren Pandemie fehlt in uns vieles
Angst. Krankheit. Tod. Ausgangssperren. Schulschließungen. Das Ende jedes kulturellen Inputs von außen. Keine positiven Gefühle, keine Ausbildung.
Das Ende der Leichtigkeit des jugendlichen Seins. Das Virus hat uns rausgekickt aus der Selbstverständlichkeit, etwas mit anderen zu tun, uns daraus zu entwickeln. Kulturelle Ausbildung benötigt Kontinuität, Spielwiesen. Zwei Jahre aufgezwungener Stillstand und verlorene Routinen haben uns massiv geblockt. Wir finden nur langsam einen Weg da raus, weil es ein Zurück im Kopf ja nicht gibt. In uns fehlen zwei Jahre Entwicklung von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Selbstvertrauen, Vertrauen in andere. Alles ist fragil geworden. Vieles blieb unvollendet. Andere Erfahrungen haben wir gar nicht erst gemacht.
Zwei Jahre aufgezwungener Stillstand und verlorene Routinen haben uns massiv geblockt.
Als Beispiel etwas, das uns beide und viele andere sehr konkret betroffen hat: Während Corona haben sich viele Jugend-orchester und -ensembles aufgelöst. Musikunterricht, Proben über Zoom, Skype und Co.: Natürlich wurde das probiert, aber es hat nicht funktioniert. Bilder passten nicht zum Ton, Töne nicht zum Bild. Versuche, mehr als zwei Instrumente ins Spiel zu bringen, scheiterten kläglich. Digitaler Laienmodus schafft sowas nicht. Auditionen fielen weg. Konzerte sowieso. Es war verboten sich zu treffen.
Um gut Musik machen zu können, muss man üben. Allein, mit anderen. Man braucht Lob, Tadel, Motivation. Der Gang zur Musikschule, die Konfrontation mit dem Lehrer, mit den anderen: Alles, was vorantreibt, entfiel. Wir haben noch geübt, aber viel weniger, lustloser, folgenloser. Unser Unterbewusstsein hat nicht mitgearbeitet. Die Leichtigkeit ging verloren. Stattdessen haben wir Schach gespielt, gekocht, Karaoke gesungen. Irgendwie ist die Zeit verschwunden.
Die Musik blieb stecken, ihr Anteil in unserem Leben ist sehr viel kleiner geworden. Hat uns das verändert? Ja. Ist das gut? Keine Ahnung. Aber Musik machen, besser werden, gemeinsam mit anderen, fehlt uns. Sehr.
Der feste Platz, den vorher die Musik einnahm, wurde vergeben. Wer hat ihn bekommen? Corona hat die sozialen Netzwerke gepusht. Wir waren vorher meist analog unterwegs, was Spaß gemacht und emotional gesättigt hat. Mit der Quarantäne übernahmen Facebook, Instagram und Co. unsere Leben. Ohne Social Media? Null Social Life. Einsamkeit, Langeweile, Schule, Uni, Kultur: Alles wurde digitalisiert, verzoomt. Qualität kam meilenweit nach Quantität.
Man hofft immer, dass irgendwo diese Gefühle von früher, aus dem echten Face-to-Face, wieder auftauchen.
Aber irgendwie kommt man davon nicht mehr los. Das Digitale hat sich reingebohrt in unsere Leben, in unsere Identität. Man scrollt immer weiter, man hofft immer, dass irgendwo diese Gefühle von früher, aus dem echten Face-to-Face, wieder auftauchen. Aber es ist nur ein Abklatsch davon. Es bleibt schal, etwas fehlt immer.
Mittlerweile wissen wir, dass einer der negativen Aspekte der Online-Welt die Vergleichswelt ist, die in ihr ersteht. Dauernd ist man mit Kunstfiguren konfrontiert, die weder im selben Lebensabschnitt sind wie man selbst noch unter den gleichen Umständen leben und auch sonst absolut nichts mit der eigenen Situation gemeinsam haben. Und doch… Man findet den ultimativen Vergleich. Er drückt einen nieder. Man kommt nur schwer auf eigene Beine.
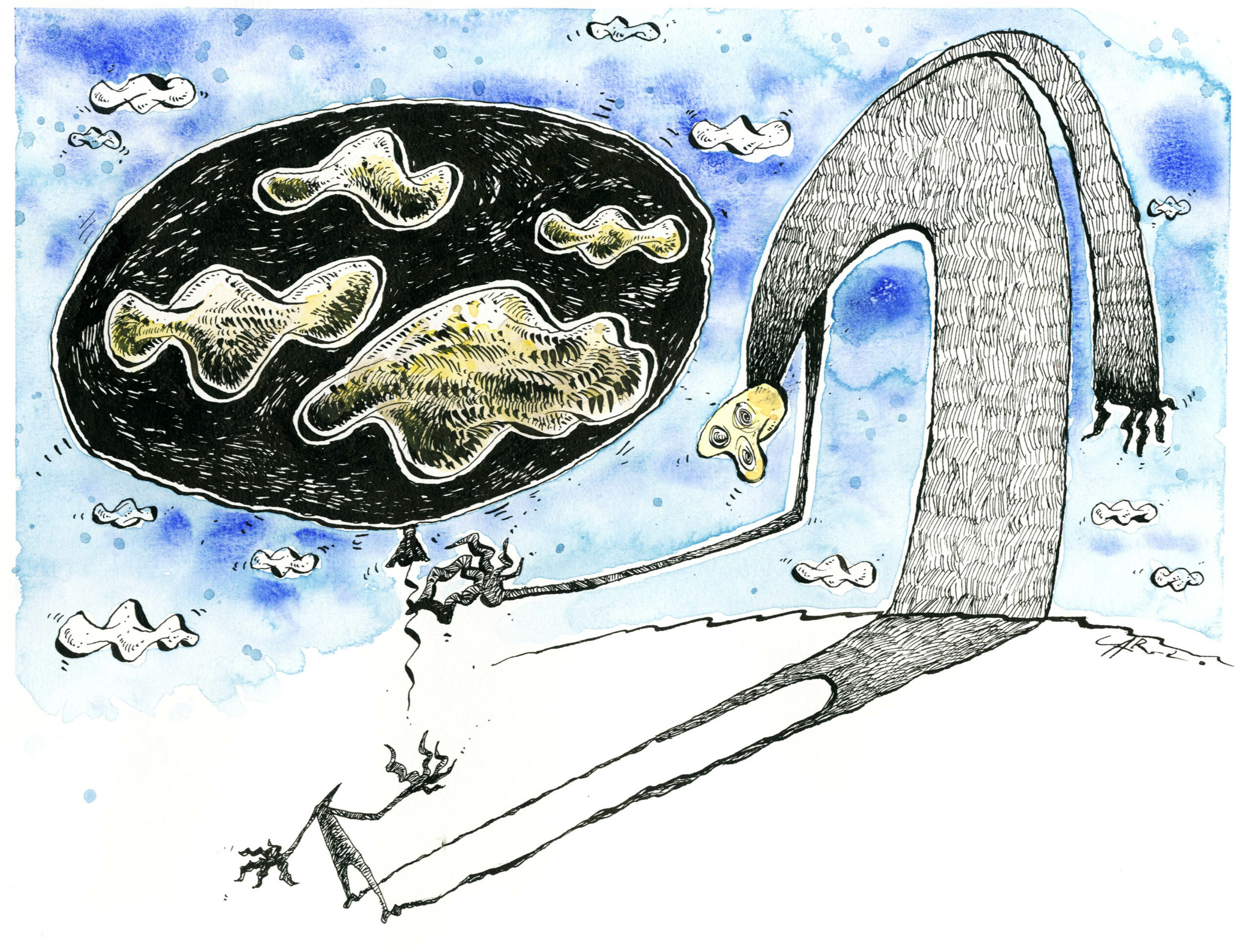
Wir sind sechs Geschwister, wir alle machen Musik. Wir konnten in der Quarantäne noch gemeinsam musizieren, zehrten von dem, was wir vorher erlebt hatten. Aber es kam nichts Neues hinzu. Wir wurden älter, unsere Schulzeit ging vorbei – im Covid-Modus. Wir hatten keine Abschlussfeiern. War die Schule zu Ende? Ja. Die Zeugnisse hatten wir in der Hand. Aber es gab keine große Party, es gab nichts. Es ging einfach weiter. Wir Ältesten gingen zur Uni. Online zunächst. Alles wie gehabt.
Ohne Abschlussfeiern und Partys wurde aus Schule irgendwann Uni
Schule war jetzt eben Uni. Der Bildschirmmodus blieb: sitzen, lesen, mitschreiben. Keine Lerngruppen, keine Diskussionen, kein Streit. Kein lustiges Studentenleben, kein Aufbruch. Alles blieb, wie es war. So fühlte es sich immer noch an: wie Schule. Als hätte sich nichts verändert. Dabei hätte sich alles verändern müssen!
Als Kinder haben wir uns vorgestellt, wie Uni sein würde. Wir hatten eine romantisierte Vorstellung davon, wie sich junge Leute auf dem Campus, in Foren, in Cafés, Studierendenwohnheimen treffen, um über große akademische Ideen aus der Vergangenheit und ihre eigenen, neuen zu diskutieren. Zu streiten, zu lachen. Das war und ist für uns auch Teil von Jugendkultur. Bildung halt. In den zwei Covid-Jahren? Danach? Fehlanzeige.
Lese- und Debattierclubs, Philosophiekreise, Spieleabende. Nach der ersten Paralyse gab man sich Mühe, die Wirklichkeit zu verzoomen, aber es hat für uns nicht funktioniert. Immer steht man gleich im Rampenlicht, wenn man etwas sagt. Viele haben ihre Kameras gar nicht erst eingeschaltet. Man redete in schwarze Felder hinein. Niemand stellte sich mehr namentlich vor. In den Wohnheimen verschwand jeder hinter seiner Zimmertür. Das ist bis heute so geblieben. Es ist ein bisschen unheimlich.
An der Eingangstür unseres Studierendenwohnheims ist ein Zettel aufgetaucht, anonym. Darauf steht: „Habt Ihr es auch satt? Lustiges Studentenleben – jetzt! Scannt den QR-Code und logged [sic] Euch auf [sic] der Facebookgruppe ein!“ Nur der Flur hinter der Tür, der bleibt weiterhin leer.
Zaza Stober ist 18 Jahre alt, studiert Archäologie und spielt Akkordeon und Bratsche. Ihre Schwester Zipora, 20, studiert Astrophysik und Philosophie und spielt Violine.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
