- Armut
Geld allein wird die Armut nicht besiegen
Die soziale Krise in Luxemburg und die Wege hinaus
Die Parteien haben Armut und wachsende Ungleichheit in den Wahlkämpfen zu den Kommunalwahlen auffallend wenig thematisiert. Wie es bei den nationalen Wahlen aussehen wird, steht zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels noch offen. Einige Parteiprogramme befassen sich etwas ausführlicher mit dem Thema, eine Priorität ist es allerdings noch nicht.1
Ob und wie breit wir Armut und soziale Ungleichheit in der Öffentlichkeit diskutieren, hängt aber auch von den Medien ab. Einfache Lösungen zur Bekämpfung der Probleme gibt es nicht. Es bedarf mutiger, multidimensionaler, kurz- und langfristiger Reformen, die die komplexen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen – vor allem, wenn sich diese in Not befinden.
Es ist eine Frage der Menschenrechte, die Person hinter der Armut in den Mittelpunkt zu stellen und ihr den Zugang zu Hilfen zu erleichtern. Langfristig müssen wir aber strukturelle Ungerechtigkeiten bekämpfen und eine sozial gerechte Transformation erreichen. Um zukunftsfähig zu sein, sollten wir soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit gleichzeitig anstreben. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die Großverbraucher ihren ökologischen Fußabdruck verringern.
Dieser Artikel wird sich auf eine Reihe von möglichen politischen Maßnahmen konzentrieren.2
Der tote Winkel
Die Politik scheint bislang nicht in der Lage gewesen zu sein, den seit den 1990er Jahren anhaltenden Trend wachsender Ungleichheit und steigender Armutsgefährdungsquoten zu bremsen – geschweige denn umzukehren. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird in Luxemburg immer größer, und das Armutsrisiko erreicht regelmäßig einen neuen Höchststand: 19,2 % der Haushalte waren im Jahr 2021 davon betroffen, also rund 116.000 Personen.
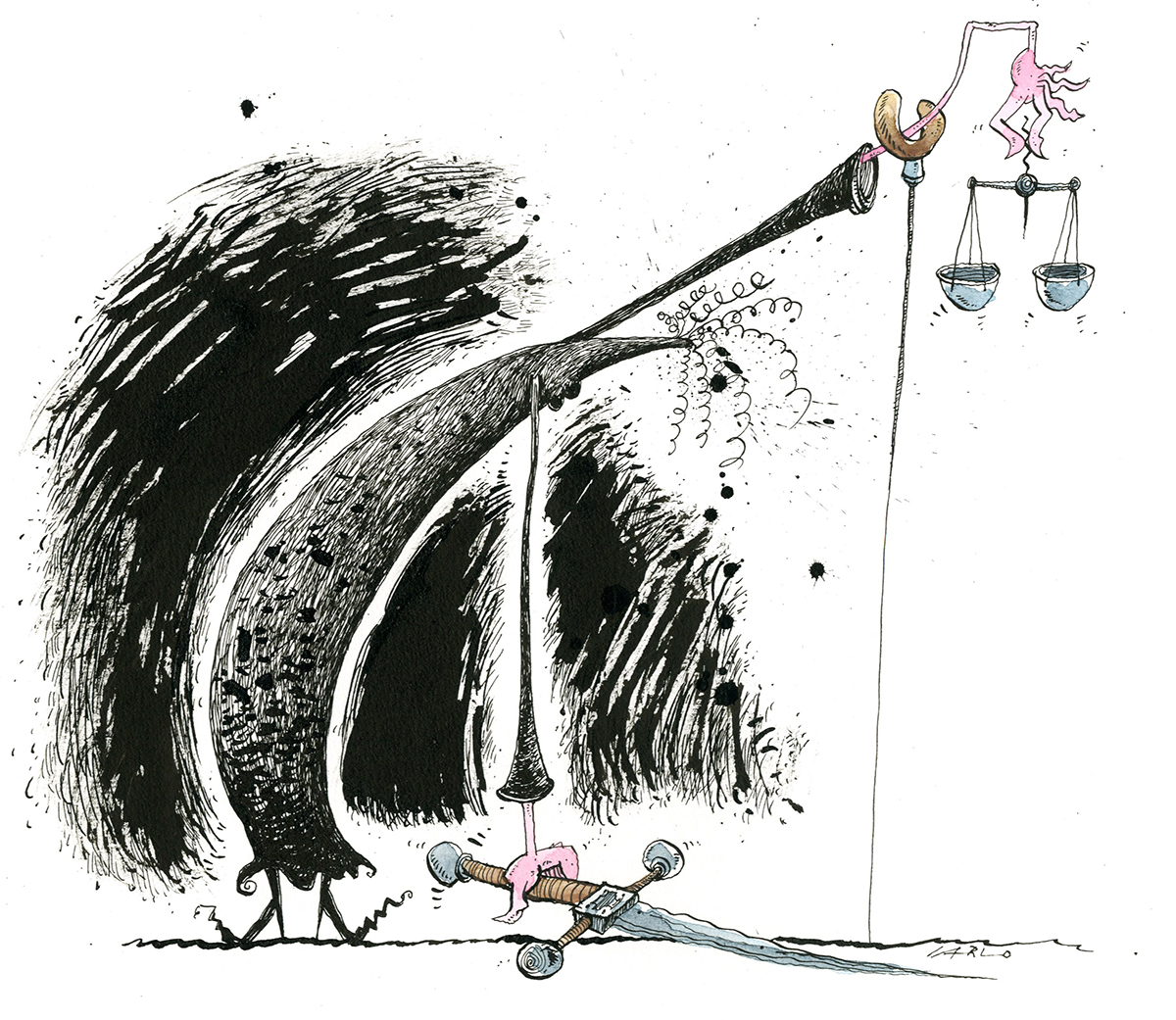
Das Risiko, arm zu sein, ist jedoch nicht in allen sozialen Schichten gleich hoch. Alleinerziehende Haushalte sind besonders betroffen (42,9 %). Auch für Kinder zwischen null und 17 Jahren ist das Risiko, in Armut aufzuwachsen, sehr hoch (28,6 %)3. Für Zuwanderer aus Nicht-EU-Ländern verschlechtern sich alle Indikatoren. Das Armutsrisiko dieser Haushalte liegt bei 46,6 % und ist damit 4,2 mal höher als bei in Luxemburg geborenen Personen. Zwischen 1960 und 2020 ist der Anteil der Zuwanderer in der luxemburgischen Bevölkerung von 13,1 % auf 47,1 % gestiegen. Im selben Zeitraum stieg der Anteil der Zuwanderer aus Entwicklungsländern von 1,3 % auf 10,4 %. Auch das beeinflusst die Armutsquote.
Seit Anfang 2000 gehört Luxemburg zu den Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die relativ gesehen die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Die Nachkommen von Nicht-EU-Bürgern haben erhebliche Schwierigkeiten, in der Schule oder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die Haushaltszusammensetzung und der Migrationshintergrund beeinflussen die Armutsprävalenz neben anderen Faktoren wie Bildungsniveau, Beschäftigungsstatus und Arbeitsintensität. Gleichzeitig haben mit Kindern und Nicht-EU-Bürgern ein großer Teil der am stärksten von Armut bedrohten Menschen kein Mitspracherecht bei der Festlegung der Prioritäten der nächsten Regierung. Die politischen Sonntagsreden über Inklusion werden durch die statistischen Fakten also schon seit Jahren widerlegt. Hier besteht großer Handlungsbedarf nach den Wahlen.
Als Gesellschaft muss uns interessieren, dass Ungleichheit krank macht. Nicht nur den Einzelnen, sondern die Gesellschaft als Ganzes. Professor Richard Wilkinson, emeritierter Professor für Epidemiologie, erklärte in seiner Eröffnungsrede beim ersten Caritas-Forum im Mai, der Zusammenhalt einer Gesellschaft verringere sich bei wachsender sozialer Ungleichheit. Je ungleicher eine Gesellschaft ist desto dysfunktionaler ist sie in allen Bereichen. In einer ungleichen Gesellschaft gibt es mehr Schwangerschaften im Teenageralter, mehr psychische Erkrankungen, mehr Gefängnisinsassen, mehr Morde, mehr Fettleibigkeit und weniger Lese- und Schreibkompetenz. Auch Kriminalität und Gewalt sind weiter verbreitet.
Der Gini-Koeffizient nach Steuern und Sozialtransfers, der eine solche Ungleichheit misst, steigt in Luxemburg kontinuierlich an. Dabei verpflichten wir uns in der neuen Verfassung dazu, die menschliche Würde zu achten und die Menschenrechte zu respektieren. Wenn die nächste Regierung Ungleichheit und wachsende Armut nicht endlich ernst nimmt, wäre das nicht nur fahrlässig, sondern ein Bruch dieser Verpflichtung.
Familienpolitik, Arbeitsrechte und Co.: den Menschen in den Mittelpunkt stellen
Mehr soziale Gerechtigkeit erfordert kurzfristig eine Steuerreform, die auf einer echten sozialen Umverteilung beruht. Dafür müssen Politik und Forschung untersuchen, welche Hebel sie für eine bessere Umverteilung des Reichtums betätigen müssen. Klar ist aber schon jetzt: Wir brauchen eine regelmäßige Anpassung des Steuertarifs an die Lebenshaltungskosten, eine Senkung der unteren und eine Anhebung der oberen Einkommenssteuersätze, und eine Anhebung des Spitzensteuersatzes. Auch Großkapital müsste stärker besteuert werden.
Der Conseil Supérieur pour un Développement Durable (CSDD) hat kürzlich darauf hingewiesen, dass die Besteuerung der Arbeit 47,3 % des Steueraufkommens ausmacht, die ökologische Besteuerung dagegen nur 3,8 %. Um dem Verursacherprinzip besser Rechnung zu tragen und eine Steuerpolitik zu betreiben, die sowohl auf die Reduktion der Treibhausgasemissionen als auch auf mehr soziale Gerechtigkeit abzielt, ist eine stärkere Besteuerung des Ressourcenverbrauchs notwendig. Für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen wäre diese dabei kostenneutral. Denn mit wenigen Ausnahmen sind es die Wohlhabenden, die in Europa und weltweit den größten ökologischen Fußabdruck hinterlassen.
Die Regierung muss die Energiewende also so schnell und effizient wie möglich vorantreiben und die soziale Dimension im Klimaschutz verankern. Andernfalls können Klima- und Umweltschutzmaßnahmen schnell wie ein Privileg, eine realitätsferne Entscheidung oder eine Lösung für Menschen mit eher hohem Lebensstandard aussehen. Ziel muss es sein, eine Wirtschaft zu fördern, die das Gemeinwohl berücksichtigt und die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft stärkt. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die Instrumente zur Messung der Lebensqualität zu institutionalisieren und systematischer zu nutzen (Luxembourg Index of Well-Being, PIB Well-Being). Gegenwärtig ist es schwierig zu verstehen, wie die Politik Instrumente über einen informativen Rahmen hinaus nutzt.
Die Berücksichtigung der verschiedenen Ausgangspunkte ist eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltig wirksame und gerechte Klima- und Sozialpolitik. Kurzfristig gilt es zudem, das erhöhte Armutsrisiko von Alleinerziehenden-Haushalten schnellstmöglich anzugehen und diese steuerlich stärker zu entlasten.
Wer familienfreundliche Politik macht, bekämpft auch die Armut
Die Steuerklasse 1a war ursprünglich als Abschreckungsmaßnahme gegen Scheintrennungen gedacht. Das Ergebnis ist jedoch, dass fast die Hälfte der Alleinerziehenden riskiert, in die Armut abzurutschen. Nicht der Familienstand, sondern das Einkommen und etwaige Kinder sollten die Grundlage für die Besteuerung bilden. Außerdem sollten alle Sozialleistungen, zum Beispiel die Geburtsbeihilfe oder die Teuerungszulage, automatisch indexiert werden. Die Obergrenzen für viele Sozialleistungen sind bei einer Vollzeitbeschäftigung und einem Gehalt knapp über dem Mindestlohn schnell erreicht. Viele Alleinerziehende und junge Erwachsene befinden sich dann in einer Situation, in der sie ein paar Euro zu viel verdienen, um Anspruch auf Beihilfen wie die Teuerungszulage zu haben. Die neue Regierung müsste die Anspruchsberechtigung daher nach oben anpassen.
Um die wachsende Kinderarmut zu bekämpfen, brauchen wir eine familienfreundlichere Politik. Das Ziel einer wirksamen und nachhaltigen Familienpolitik sollte dabei nicht nur die Bekämpfung der materiellen Armut sein, sondern auch eine angemessene Unterstützung der Eltern. Diese könnte ein gesundes familiäres und institutionelles Umfeld fördern und Zeit und Ressourcen für die Betreuung der Kinder schaffen. In Luxemburg wird es aufgrund der Lebenskosten immer schwieriger, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Dabei müsste jeder die Möglichkeit haben, seinen Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen und gleichzeitig seinen familiären Verpflichtungen nachzukommen. Auch wenn Bildung und Betreuung kostenlos werden: Es ist wichtig, dass Familien die Wahl haben, wie sie ihre Kinder betreuen lassen wollen – und es sich auch leisten können, dies selbst zu tun.

Zuletzt brauchen wir einen Mentalitätswandel in Bezug auf Niedriglöhne. In Luxemburg sind immer mehr Arbeitnehmer mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert. Und bezahlte Arbeit ist keine Garantie, der Armut zu entkommen. Das Risiko, in einem armutsgefährdeten Haushalt zu leben, ist mit 13,5 % der ansässigen Arbeitnehmer im Jahr 2021 das höchste in der Eurozone. Der EU-Durchschnitt liegt dagegen bei 8,9 % und ist seit 2012 unverändert.
Obwohl der soziale Mindestlohn in Luxemburg sowohl im europäischen Vergleich als auch in absoluten Zahlen sehr hoch ist, liegt sein Niveau nahe an der Armutsgrenze. Die zukünftige Regierung müsste das Arbeitsrecht und die Kontrollsysteme stärken, um die Gefahr des Missbrauchs zu verringern – etwa bei der Leiharbeit. Neue gesetzliche Regelungen könnten es außerdem den Beschäftigten von sogenannten Plattformunternehmen ermöglichen, von den bestehenden sozialrechtlichen Regelungen zu profitieren.
Geld allein wird nicht ausreichen
Armut kann nicht nur mit Geld bekämpft werden. Die Bekämpfung ihrer strukturellen Ursachen erfordert umfassende und mehrdimensionale Ansätze, die politische Veränderungen, institutionelle Reformen und gesellschaftliche Anstrengungen zur Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung, der Chancengleichheit und der sozialen Inklusion umfassen. Auch die demokratische Teilhabe muss in Luxemburg stärker werden. Die nächste Regierung muss den Anstieg der Ungleichheit verlangsamen und im besten Fall umkehren. Die Ärmsten in unserer Gesellschaft brauchen gezielte Unterstützung durch durchdachte und präzise Maßnahmen.
Auch die Wirtschaft trägt eine wichtige Rolle in der Armutsbekämpfung. Sie muss stärker handeln: Die Armutsrisikorate vor Auszahlung der Sozialtransferleistungen liegt bei 46 %. Fast die Hälfte der Bevölkerung wäre ohne die genannten Leistungen arm. Nun leistet die Wirtschaft sicherlich auch einen Beitrag zum sozialen Sicherungssystem. Fakt ist aber, dass die Gehälter vieler Menschen allein nicht ausreichen, um über der Armutsrisikogrenze leben zu können. Dass immer mehr Bürger sehr reich sind und andere immer ärmer werden, ist sozial ungerecht und nicht nachhaltig. Gleichzeitig befürchten viele wirtschaftliche Akteure einen Verlust der Konkurrenzfähigkeit bei einer Erhöhung der Gehälter. Das wäre nicht der Fall, wenn Gewinne und individueller Reichtum über eine sogenannte Sozialisierung der hohen Gewinne und extremen Vermögen stärker besteuert werden würden.
In den letzten Jahren agierte die luxemburgische Politik von Krise zu Krise und wendete ein ungenaues Gießkannenprinzip an. Nach wie vor bevorzugt sie Menschen mit Kapital. Doch wenn wir jetzt nicht reagieren und umsteuern, besteht die Gefahr, dass die Kluft zwischen Arm und Reich so groß wird, dass wir sie nicht mehr schließen können. Mutige, langfristige und substanzielle Reformen sind daher notwendig, wir dürfen die sozial Schwachen nicht mehr auf der Strecke lassen. Nur wer Umwelt, Wirtschaft und Soziales zusammendenkt und entsprechend integriert, schafft entsprechende Programme und Entwicklungen in der Gesellschaft. Mit diesem Ansatz sollten die Parteien die Nationalwahlen im Oktober angehen.
Zur Zeit der Abfassung des Artikels waren die Programme der CSV und der Piraten noch nicht veröffentlicht. Déi Gréng, Déi Lénk und LSAP befassen sich mit Lösungsansätzen zum Thema Armut und Ungleichheiten.
1 Basierend auf den Forderungen von Caritas Luxembourg: https://www.caritas.lu/ce-que-nous-disons (letzter Aufruf: 17. August 2023).
2 Statec, „Rapport travail et cohésion sociale : d’une crise à l’autre, La cohésion sociale sous pression“, 2022.
3 Liser, „L’intégration, un impératif économique et sociétal“, in: Lëtzebuerger Land vom 28. April 2023.
4 Ebenda.
5 https://csdd.public.lu/fr/actualites/2023/taxshift.html (letzter Aufruf: 17. August 2023).
Lesen Sie dazu auch unsere Dossiers 430 Armut (2023), 335 Jugend ohne Arbeit (2013) und 300 Reiches Land – armes Land (2010) im forum-Heft oder online auf www.forum.lu.
Carole Reckinger studierte Internationales Recht, Internationale Politik und Development Studies an der University of London und ist für die politische Arbeit bei Caritas Luxemburg verantwortlich.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
