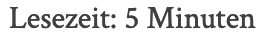
„Was also ist Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es; will ich es einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht.“1 Dieser Ausspruch von Augustinus (354-430) ist noch immer aktuell, für die Physiker bleibt (vorerst) die Zeit eines der Konzepte, die keine Definition erlauben. Für den Soziologen und Philosophen Hartmut Rosa ist Zeit eine existenzielle Dimension unseres Daseins, sie lässt sich als Faktor nicht isolieren.
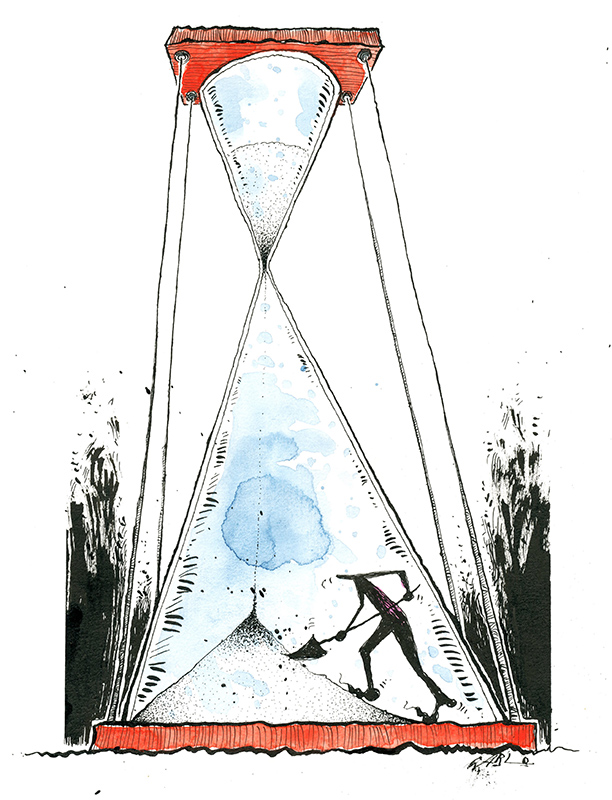
Die Zeit ist eine physikalische Größe und definiert ein „vorher“ und „nachher“. Die Menschen teilen sie in Einheiten, die man äußerst genau messen kann: Stunden, Minuten, Sekunden. Eine Sekunde entspricht 9.192.632.770 Perioden der Strahlung des Überganges zwischen den beiden Hyperfeinstruktur-Niveaus des Grundzustandes von Atomen des Cäsiums-133.
Für einen Nichtexperten scheint das ziemlich kompliziert, der große Einstein konnte es sehr einfach erklären: „Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.“ In seiner Relativitätstheorie verknüpft er die Zeit eng mit den räumlichen Dimensionen zur „Raumzeit“ und verdeutlicht diesen anspruchsvollen Begriff an einem schlichten Beispiel: Wenn zwei Leute sich treffen wollen, hilft es wenig, nur einen Treffpunkt oder eine Zeit auszumachen. Man braucht beides, um wirklich zur selben Zeit am selben Ort zu sein. An diesem Beispiel bleibt der obengenannte Zeitbegriff trotzdem relativ: Zwei westliche Geschäftsleute werden sich ganz bestimmt genau an ihrem verabredeten Termin treffen, zwei Bauern aus dem Globalen Süden sehen voraussichtlich relativ gelassen ihrer zeitlichen Verabredung entgegen und werden wahrscheinlich beide eher später am vereinbarten Ort ankommen.
Eine weitere verwirrende Eigenschaft der Zeit wird ebenfalls mit der Relativitätstheorie beschrieben: Die Zeit läuft nicht an allen Orten gleichmäßig schnell. Je schneller sich ein System, zum Beispiel ein fliegender Satellit bewegt, umso langsamer läuft dort die Zeit. Weil Raketen noch kein alltägliches Transportmittel darstellen, wird diese physikalische Eigenschaft so bald noch keinen Einfluss auf unser Leben nehmen. Dazu gibt es noch die „gefühlte Relativität“ der Zeit, eine Eigenheit, die wir sehr wohl in unserem Leben empfinden.
Gefühlte Zeit, gelebte Zeit
Wir setzen die Zeit, die wir erleben, ins Verhältnis zu der Zeit, die wir schon erlebt haben. Für einen Fünfjährigen ist ein Jahr ein Fünftel seiner gesamten Lebenszeit, für eine Sechzigjährige ist ein Jahr nur ein Sechzigstel. Für den Jungen fühlt sich ein Jahr länger an als für die ältere Dame. Hinzu kommt, dass die Zeit uns im Rückblick umso länger vorkommt, je mehr passiert ist, besonders, wenn es emotional besetzt ist.
Wegen diesem Zeitempfinden scheinen uns die ersten dreißig Jahre unseres Lebens viel länger als die nächsten dreißig Jahre. In jenem ersten Zeitintervall erleben wir viel Spannendes und vieles davon zum ersten Mal: Erwachsenwerden, Schule, Ausbildung, erste Liebe, erster Sex, erster Job, erste Wohnung … Die nächsten dreißig Jahre erscheinen uns viel kürzer, weil dieses Zeitintervall viel konstanter ist, unser Alltag ändert sich auf lange Zeit nur wenig.
„Das Problem ist, du glaubst, du hast Zeit“ Buddha
Ein zweiwöchiger, aufregender Urlaub auf der Seidenstraße mit vielen eindrucksvollen Erlebnissen verging gefühlt sehr schnell. Im Gedächtnis nehmen diese zwei Wochen aber viel mehr Raum ein, als wenn ich die gleiche Zeit an meinem Arbeitsplatz verbracht hätte. Umgekehrt, zwei Tage auf einer Reanimationsstation ohne Uhr, ohne Fenster und ohne Ablenkungsmöglichkeit, fühlten sich an wie eine Ewigkeit. In Erinnerung bleibt mir nur eine kleine Momentaufnahme. Die Lebenskunst besteht darin, die kurzweilige Zeit, die erfüllte Zeit, aufzusuchen und die langweilige Zeit auf ein Mindestmaß zu beschränken.
Wie lange dauert die Gegenwart?
Die Vergangenheit ist schon vorbei, die Zukunft kommt noch, und wenn ich das Wort „jetzt“ ausgesprochen habe, ist die Gegenwart auch schon vorüber. Die Lichtstrahlen der Sonne, die wir „jetzt“ sehen, haben sich bereits vor rund acht Minuten auf den Weg gemacht. Wir sehen nur in die Vergangenheit. Sogar wenn ich mich bei kürzester Distanz mit einem Menschen unterhalte, vergeht Zeit, und unser Gehirn braucht auch noch einmal 150 bis 200 Millisekunden für die Verarbeitung dieser Informationen. Was ist „jetzt“, was ist Gegenwart? Ein philosophisches Rätsel!
In der Neurobiologie lassen Studien vermuten, dass das Gehirn die Gegenwart in Einheiten zu etwa 2,7 Sekunden verarbeitet. Der alltagssprachliche Begriff „Augenblick“ stellt genau diesen Sachverhalt dar.
Zudem legen Untersuchungen nahe, dass 3-Sekunden-Einheiten auch in der Lyrik (wenn es etwa um die Erkennung von Reim und Rhythmus geht) und der Musik von Bedeutung sind2. Die Musik vermittelt uns eine sehr gute Vorstellung von der Zeit. Eine einzelne Note berührt sie nur, weil sie sich an die Vergangenheit erinnert und die nächste erwartet. Jede Note gewinnt ihren Sinn nur dadurch, dass sie in ein wenig Vergangenheit gehüllt ist und in ein wenig Zukunft.
In den östlichen Religionen, wie Buddhismus oder Hinduismus, wird als Ort des ewigen Lebens, anders als in den abrahamitischen Religionen, nicht ein in der Zukunft nach dem Tode folgender Himmel, sondern der gegenwärtige Augenblick angesehen. Die Ewigkeit ist jetzt und dauert länger als 3 Sekunden.
Zeitreichtum
Nach den forum-Dossiers über Armut, Renten und Reichtum war es irgendwie logisch, ein Dossier über die Zeit herauszugeben. Die vier Themen stehen in enger Verbindung: Arbeitszeit-Verdienst-Vermögen-Freizeit-Verteilungs- und Rentengerechtigkeit. Das Phänomen Zeit ist ein sehr vielfältiges Thema und in diesem Heft werden einige spannende Aspekte davon beleuchtet.
Michel Pauly kommentiert die Zeitmessung vom Mittelalter bis in die Neuzeit und den Einfluss der Eisenbahnerfindung auf die lokalen Zeitangaben.
Georges Engel plädiert dafür, über flexible Arbeitszeitmodelle und -verkürzungen nachzudenken, die wertvolle Vorteile liefern für den Arbeitnehmer und die, im Hinblick auf den europaweiten Fachkräftemangel, eine Lösung für den nationalen Arbeitsmarkt darstellen könnten.
Ist KI zeitsparend und hat sie Auswirkungen auf unser Zeitgefühl, fragt sich der Historiker Claude Ewert.
Yves Steichen unternimmt mit dem Leser in seinem Beitrag „Was wäre, wenn …? – Uchronien und kontrafaktisches Erzählen im Kino“ einen kleinen Exkurs durch die Filmgeschichte und zeigt, wie das Kino unser Verständnis von Zeit immer wieder auf die Probe stellt.
In seinem Artikel argumentiert Francis Schartz, dass die kommenden Generationen sich nicht mit „Apfelbäumchen pflanzen“ begnügen dürfen, und hofft, dass es ihnen gelingen wird, sich von den gegenwärtigen Verhaltensmustern und Abhängigkeiten zu lösen und die erforderliche Zeitenwende herbeizuführen. Wie geht man mit der Zeit um, die noch kommt?
„Zeiterleben und Zeitgefühl bei an Demenz erkrankten Personen – was heißt im ‚Hier und Jetzt‘?“ ist der Beitrag von Anja Leist betitelt, und sie erklärt, wie man mit Erinnerungen arbeiten kann, um das Wohlbefinden dieser Kranken zu verbessern.
Die Psychologin Martina Thill arbeitet in der Palliativpflege und schreibt über die kostbare Zeit, die einem Menschen nach der Diagnose einer schwerwiegenden Erkrankung bleibt, über Werte, neue Prioritäten und intensives Leben. Wie nutzen Menschen ihre verbleibende Zeit?
Unsere Aufmerksamkeit, als kostbare Ressource, wird von den attention merchants des 21. Jahrhunderts gekapert und gewinnbringend vermarktet, schreibt Johannes Pause, und die Digitalisierung riskiert, uns ein anderes Zeitgefühl vorzugaukeln: die Zukunft wird auf die Gegenwart reduziert.
Andreas König verdeutlicht, wie das Smartphone einen dominanten Einfluss auf unser Zeitmanagement ausübt und wie es jegliche Langeweile, deren kreative Potenziale nicht zu unterschätzen sind, aus unserem Leben verdrängen kann.
Christian Reidenbach argumentiert auf originelle Weise, dass es die Verzögerungskompetenz ist, die dem Menschen einen Evolutionsvorteil beschert.
In einem persönlichen Text beschreibe ich die Zeitbeschleunigung in unserer hektischen Gesellschaft und versuche, Möglichkeiten zu zeigen, wie man unversehrt aus diesem Hamsterrad aussteigen könnte.
forum wünscht Ihnen bei der Lektüre dieses Hefts ein intensives Zeiterlebnis und genießen Sie die dabei gefühlte Ewigkeit … Erinnerungen … jetzt … Erwartungen
1 Aurelius Augustinus, Was ist Zeit? Confessiones XI/Bekenntnisse 11. Eingel., übersetzt u. mit Anmerkungen versehen von Norbert Fischer, Lat.-dt., Hamburg, Felix Meiner Verlag, 2000.
2 https://tinyurl.com/ypm53dax (letzter Aufruf: 27. August 2024)
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
