- Politik
31 Vorschläge für eine Politik der Resilienz (Reaktion auf Vorschlag 1: Roby Biwer)
Vorschlag 1 der forum-Redaktion: Der Zustand der heimischen Biodiversität ist der beste Indikator für die langfristige Resilienz und Lebensfähigkeit eines Landes, und dieser Zustand hat sich mittlerweile dramatisch verschlechtert. Die Erhitzung der Landschaften und Städte muss großflächig aufgehalten werden durch die sorgsame Bewirtschaftung der Wälder und Parks, durch den Aufbau von grünen Korridoren, durch die großflächige Begrünung der Städte und urbanen Lebensräume, durch den Schutz, das Anlegen und die Ausweitung von Feuchtgebieten, durch die Anerkennung des Wassers als strategische, öffentliche Ressource, die auch Eingriffe in Privatrechte rechtfertigt, durch die Ausweisung weiterer Naturschutzzonen usw.
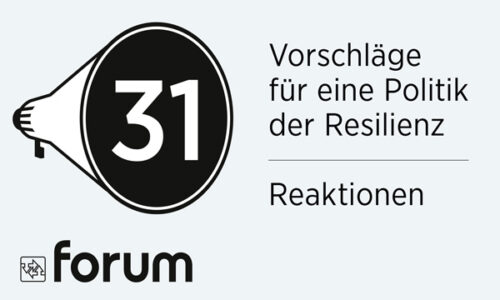
Reaktion 1 von Roby Biwer:
Wären Sie empört zu hören, dass ein kleiner Regenwurm wichtiger ist als Sie – weil der Regenwurm ohne den Menschen leben kann, der Mensch jedoch nicht ohne Wurm? Oder irritiert es Sie, dass falls die Bienen aussterben, den Menschen höchstens vier Jahre später dasselbe Schicksal droht? Haben Sie sich schon gefragt, was Naturschützer*innen gegen Monokulturen haben?
All diese Fragen haben einen gemeinsamen Ursprung: die Artenvielfalt. Und diese geht uns alle an. Ohne sie kann der Mensch nicht existieren, denn die biologische Vielfalt sichert unser Leben auf dieser Erde. Biodiversität zu schützen, bedeutet, unseren Lebensraum zu schützen.
Der Begriff Biodiversität umfasst die Vielfalt sämtlicher Organismen (Tiere, Pilze, Pflanzen, Bakterien), die auf unserer Erde leben: erstens auf Ebene der Gene (und somit Unterschiede) innerhalb einer Art, zweitens zwischen den Arten (also der eigentlichen Artenvielfalt) und drittens auf Ebene der verschiedenen Ökosysteme. Auf dieser Vielfalt beruht ein Netz aus ökologischen Prozessen, welche die Grundlage für unser Leben bilden: sogenannte Ökosystemdienstleistungen. Eine intakt funktionierende Natur garantiert die Bereitstellung überlebenswichtiger Grundressourcen (saubere Luft, Sauerstoff, Trinkwasser, Nahrung …) und die Regulierung natürlicher Prozesse (Hochwasser, Abkühleffekt der Vegetation …) für alle Lebewesen. Die Biodiversität ermöglicht widerstandsfähige Ökosysteme, die Klimaextreme abfedern können und das Aufkommen von Krankheitserregern in Schach halten. Sie ist also ein effektives und unentbehrliches Instrument im Kampf gegen den Klimawandel oder weitere Pandemien.
Die Gewährleistung dieser Dienstleistungen ist durch die dramatischen Verluste der Artenvielfalt in den letzten Jahrzehnten in Gefahr geraten. Die Rote Liste gefährdeter Arten, das wissenschaftliche Fachgutachten der Weltnaturschutzunion (IUCN) zum Aussterberisiko von Tier-, Pilz- und Pflanzenarten, füllt sich jährlich mit neuen Spezies, während manche bereits ausgestorben sind. Die rezente Rote Liste der Brutvögel Luxemburgs, welche alle fünf Jahre von der Centrale Ornithologique verfasst wird, bestätigt auch hierzulande eine negative Tendenz. Daraus geht hervor, dass das Braunkehlchen als national ausgestorben gilt, während die nationalen Bestände anderer Vogelarten, wie z. B. dem Raubwürger, nur noch aus vereinzelten Brutpaaren bestehen.
Dieser Megatrend ist in erster Linie auf den Menschen und seine wirtschaftliche Aktivität zurückzuführen. Unser Konsum, unsere Ernährungsgewohnheiten, wie wir wohnen und uns fortbewegen – alles, was wir tun, hat einen Einfluss (sowohl positiv als auch negativ) auf unsere natürliche Umwelt. So führen beispielsweise die Zersiedelung der Landschaft mit fortschreitender Versiegelung der Böden, die Trockenlegung von Feuchtgebieten sowie die Produktionsmethoden der Landwirtschaft (Einsatz synthetischer Dünger und Pestizide, Ausräumung des Offenlandes …) zum Rückgang der Biodiversität.
Um den Verlust der Biodiversität aufzuhalten, muss an vielen Fronten gehandelt werden. Kleinräumig kann die Artenvielfalt durch die Schaffung von Habitaten, insbesondere in Form eines Mosaiks an Strukturen in der Landschaft, gefördert werden: durch Blumenwiesen und Brachflächen, Krautsäume und Ackerrandstreifen, Hecken und Solitärbäume, Totholzhaufen und Trockenmauern oder Wasserflächen sowohl in Privatgärten als auch auf öffentlichen Flächen und in der Landwirtschaft. Vor allem aber bedarf es gezielter Schritte auf politischer Ebene, durch Gesetze und Verordnungen durch die EU oder auf nationaler Ebene, um den Verlust der Biodiversität zu stoppen: Eine weitere Fragmentierung der Landschaft muss verhindert werden, Lebensräume müssen renaturiert und wieder verbunden werden. Die Steigerung der strukturellen Vielfalt muss in Städten (Baumalleen, Grüngürtel und Parks, Reduktion versiegelter Flächen …) ebenso verpflichtend sein wie in der Landwirtschaft. Bei letzterer muss der biologische und biodynamische Anbau gefördert werden. Ein Verzicht auf synthetische Düngemittel und Pestizide ist darüber hinaus auch für den Privatgebrauch nötig. Des Weiteren muss besonders der Wasserschutz konsequenter vorangetrieben werden.
Alle Lebewesen auf der Erde, auch wir Menschen, sind mit der Natur zu einem Netz verstrickt. Wir haben Einfluss auf andere Arten und deren Existenz, umgekehrt sind wir aber auch von diesen abhängig. Das prominenteste Beispiel hierfür ist die Bestäubung durch Insekten, von der der Großteil unserer Nahrungsmittelproduktion abhängt. Aber auch alle anderen Organismen sind Teil eines Kartenhauses, das zusammenfällt, wenn man eine Karte herausnimmt.
Biodiversität darf kein abstrakter, unverständlicher Begriff bleiben und ihr Schutz nicht als Schikane durch Entscheidungsträger*innen aufgefasst werden. Die natürlichen Ressourcen unserer Erde sind nicht unendlich, und unsere Umwelt wird früher oder später an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gelangen, wenn wir nicht aufhören, sie auszubeuten und beginnen, nachhaltiger zu wirtschaften.
Unumgänglich ist dennoch der politische Mut, den Naturschutz in allen öffentlichen Entscheidungen zu priorisieren, Landschaftsrenaturierungen voranzutreiben und eine natur- und umweltverträgliche Landwirtschaft zu fördern, damit wir uns als Land nachhaltig entwickeln können. Wir alle müssen endlich begreifen, dass wir Teil dieser Vielfalt sind und ihr Schutz nicht nur einzelnen Arten zugutekommt, sondern unser (Über-)Leben auf diesem Planeten sichert. Dafür lohnt sich der Einsatz jedes Einzelnen.
Roby Biwer ist Präsident von natur&ëmwelt.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
