- Politik
31 Vorschläge für eine Politik der Resilienz (Reaktion auf Vorschlag 2: Jean Stoll)
Vorschlag 2 der forum-Redaktion: Die Agrar(förder)- und Ernährungspolitik sollte unter strategischen, ökologischen und energetischen Gesichtspunkten völlig neu aufgestellt werden. Eine Jahrhundertaufgabe, die im Rahmen des neu zu schaffenden Ernährungsrates diskutiert werden kann.
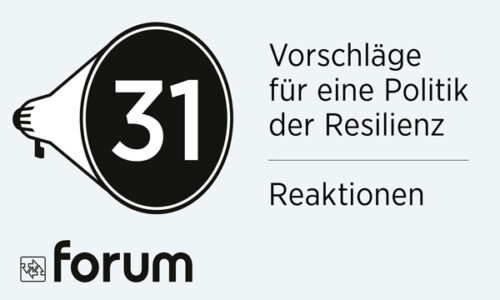
Reaktion 2 von Jean Stoll:
Richtig! Die Lebensmittelerzeugung muss flächendeckend nachhaltig werden. Zu dieser neuen Ausrichtung sind für den gesamten Agrarsektor folgende Rahmenbedingungen unabdingbar:
- obligatorische, international anerkannte Nachhaltigkeitsprüfung,
- Grundeinkommen für alle Nahrungsmittelproduzent*innen,
- keine finanziellen Zuschüsse orientiert an Fläche, Produkt oder Service, sondern ausschließlich Investitionsbeihilfen,
- völlig offener, freier Lebensmittelmarkt,
- Absicherung der Agrarflächen und ihre Bereitstellung an geprüfte Erzeuger*innen (siehe Vorschlag Nr. 3).
Alle Landwirt*innen, Winzer*innen und Gärtner*innen unterziehen ihre Betriebe fortan einem Nachhaltigkeitscheck, der die Bereiche Ökologie, Ökonomie, Soziales und Management umfasst.1 Parallel dazu offenbaren sie die biologische Effizienz ihres Schaffens mittels einer Hoftorbilanz: Die Stoff- und Energieflüsse, die C-Fixierung sowie die Emissionen an Treibhausgasen werden jährlich im Sinn einer Lebenszyklusanalyse bilanziert2 und stetig optimiert.
Das Grundeinkommen wird unabhängig von den angewandten Methoden, der erzeugten Mengen, der bewirtschafteten Flächen und der erzielten Gewinne bzw. Verluste gewährt. So wird die Entscheidungsfreiheit der Betriebsleiter*innen garantiert und ihre Existenzangst minimiert. Sie werden frei von jeglichen externen Zwängen dazu befähigt, ihren äußerst komplexen Beruf so auszuführen, um biologisch-agronomisch effizient mit der Natur – und nicht gegen sie – zu produzieren. Die Einsparung der bestehenden Zuschüsse und die Minimierung der Kollateralschäden der jetzigen Produktionsweisen ermöglichen die Finanzierung dazu.
Der Markt deckt die Hauptkosten. Die Verbraucher*innen regeln mit ihrem Einkaufsverhalten Vielfalt und Art der erstellten Produkte. Die anstehende Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) mit dem erweiterten Subsidiaritätsprinzip erlaubt die dazu eigenständige Umsetzung.
Talent, Mut zur Innovation und die korrekte Aus- und Fortbildung zur Optimierung der Stoffflüsse ersetzen schrittweise die Anwendung chemisch-synthetischer Dünger und Pestizide durch die Nutzung der in der Natur so reichhaltig und vollkommen aufeinander abgestimmten Prozesse. Die biologische Aktivität der Böden wird durch variationsreichere Nutzpflanzengemengen, u. a. mit Leguminosen, dem Ausbau der Direktsaat (weniger Pflügen) und mit längeren Rotationen reaktiviert. Die natürlichen Kreisläufe der Fotosynthese werden innovativer und effektiver genutzt: weniger Nährstoffverluste, geringerer Fossilenergieeinsatz, vermehrter Anbau an Humus aufbauenden Pflanzen. Die Landwirtschaft wird fremdmittelfreier und klimaresilienter. Luft, Wasser und Böden werden mit weniger Schadstoffen und Stickstoffverbindungen (Nitrat, Ammoniak, Lachgas) belastet.
Die Wiederkäuer Rind, Schaf und Ziege erzeugen aus den sortenreicheren Wiesen und Weiden Milch, Fleisch, Leder, Wolle, Gelatine, Mineralien und Kleber, und liefern dabei den unabdingbaren Dung für die Ackerflächen. Die wiederbelebten Böden speichern hohe Mengen an Karbon und nehmen größere Mengen an Regenwasser auf, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Extremen Trocken- und Regenperioden wird so auf natürlichem Weg begegnet. Die um 75 % geschrumpfte Population an Fluginsekten und die bis zu 80 % vernichtete Bodenfauna vermehren sich wieder und fixieren ihrerseits Kohlendioxid.
Durch die grünlandbasierte Fütterung der Wiederkäuer sinkt das Angebot an Feld- und Importfutter. Die Zahl an Kühen und deren Produkte Milch und Rindfleisch schrumpfen. So werden hier vor Ort 200.000 Tonnen CO2eq. an Emissionen eingespart. Ackerflächen stehen vermehrt für den An- und Ausbau an Getreide, Körnermais, Sojabohnen, Feldgemüse und Rohstoffen zur direkten Nutzung durch uns Menschen bereit. Mit den notwendigen Hygienemaßnahmen verwerten die heute vegan gefütterten Allesfresser Schweine und Geflügel fortan unsere enormen Küchenabfälle. Aus diesem systembedingten Bioabfall entstehen dem Menschen zugängliche Eiweiße und Fette.
Quereinsteiger*innen wird der Eintritt in den Gemüsebau mittels eines Grundgehalts erleichtert: consumer supported qgriculture, urban gardening und permaculture werden dort angewandt, wo diese Methoden sich sinnvoll anbieten.
Biogas und Kompost werden nur noch aus nicht mehr anders zu verwertenden, hiesigen Abfällen gewonnen. Der Agrarsektor wird wieder zur echten Zirkularökonomie.
Der angedachte Ernährungsrat muss die Umsetzung dieser Neuausrichtung der Landwirtschaft eng begleiten. Er muss auch dafür Sorge tragen, dass die Politik ihm wesentlich mehr Aufmerksamkeit schenkt als dem Nachhaltigkeitsrat: Im neuen „Label-Regelwerk“ der Regierung wurde kein einziger Vorschlag zu seinen vielen strategischen, ökologischen und energetischen Gesichtspunkten für diese Jahrhundertaufgabe der Agrarpolitik zurückbehalten.
Jean Stoll ist Diplom-Agraringenieur.
- Das Forschungsinstitut IBLA wendet die im Agrar- und Lebensmittelsektor international anerkannte Nachhaltigkeitsprüfung SMART seit 2018 an, welche auf den SAFA-Richtlinien (Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems) der FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) basiert.
- Die Kooperative CONVIS tätigt seit 1992 Nährstoff-, Energie-, Humus (C)- und Treibhausgasbilanzen.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
