- Politik
31 Vorschläge für eine Politik der Resilienz (Reaktion auf Vorschlag 3: Guy Feyder)
Vorschlag 3 der forum-Redaktion: Ackerland muss geschützt werden. Zum Verkauf stehende Ackerböden sollten soweit wie möglich vom Staat aufgekauft, in einen Fonds überführt (vgl. die Aufgaben der SAFER in Frankreich) und den Landwirten unter Umweltauflagen zugänglich gemacht werden.
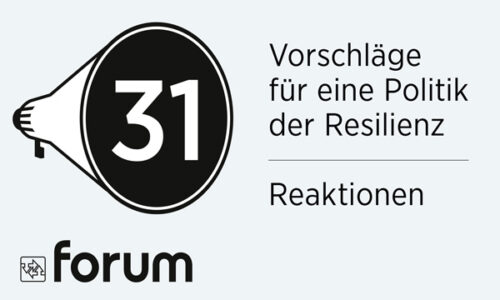
Reaktion 3 von Guy Feyder:
Steigende Kauf- und Pachtpreise für Ackerboden – die Landwirtschaft badet die Folgen unseres Wirtschaftswachstums in vollem Umfang aus. Landwirtschaftliche Fläche ist zurzeit ungeschützt und zum Objekt der Begierde für Spekulanten, Immobilienhaie, Staat, Gemeinden und Gemeindesyndikate geworden.
Das in Luxemburg als gottgegeben und unantastbar angesehene Wirtschaftswachstum fordert seinen Tribut: Die inhärenten Begleiterscheinungen der ausufernden Bauwut und der damit einhergehenden Landversiegelung entladen sich auf dem Rücken der Natur und damit der Landwirtschaft.
Politisch wurde bereits reagiert: Das aktuelle Naturschutzgesetz verlangt nach Kompensationsmaßnahmen für bauliche Eingriffe in der Grünzone. Dies jedoch verschärft den Druck auf den landwirtschaftlich genutzten Boden zusätzlich, da hierfür, neben der eigentlichen Landversiegelung, weitere Fläche beansprucht wird. Diesbezügliche Sorgenfalten der Branche wurden bisher mit müdem bis gleichgültigem Achselzucken seitens der Politik quittiert.
Die Landwirtschaft sieht klaren Handlungsbedarf in existenziellem Zusammenhang: Der Schutz des Ackerbodens als Grundlage zur eigenständigen Lebensmittelerzeugung drängt sich auf!
Gut gefüllte Regale im Supermarkt haben uns lange im Irrglauben gelassen, freie Märkte seien eine Art Allroundversicherung für sorgenfreies Leben! Die Coronakrise hat uns auf einen Schlag die Bedeutung der gesicherten, lokalen Lebensmittelversorgung vor Augen geführt. In den westlichen Industrienationen, und in Luxemburg im Besonderen, werden die Wechselwirkungen von Wirtschaftswachstum, Wohlstands- und Kaufkraftvermehrung, billigen Lebensmitteln und Landversiegelung von Gesellschaft und Politik gerne verdrängt oder bleiben im günstigsten Fall unbeleuchtet. Wenngleich anerkannt werden muss, dass der freie Zugang zum Boden zu Spekulationszwecken einer Regulierung bedarf, so sieht die Bauernwelt den oben angedachten staatlichen Landaufkauf doch als bedenklich an. Warum?
Bereits jetzt bedienen sich Staat und Gemeinden nach Herzenslust am verfügbaren Boden. Mal zum Zweck des Wohnungsbaus, mal für den Naturschutz, für Aktivitätszonen sowie Infrastrukturprojekte aller Art (Schulgebäude, Krankenhäuser usw.). Damit heizen sie den Teufelskreis der Landverknappung an.
Um urbaren Boden für landwirtschaftliche Nutzung zu erhalten, braucht es keinen staatlichen Erwerb. Die Landwirtschaft braucht einen prioritären Zugang zum Boden für dessen Nutzung. Eine entsprechende Schutzzone, dem Schutz der Waldgebiete ähnlich, hebt die Landwirtschaft auf Augenhöhe im Wettbewerb um die verfügbare Fläche.
Es ist naheliegend, dass je nach politischer Konstellation die Urfunktion der Landwirtschaft anderen Begehrlichkeiten untergeordnet wird. Die Idee, staatlich aufgekauften Boden „unter Umweltauflagen“ zur Verfügung zu stellen, ist vielleicht gut gemeint, greift jedoch viel zu kurz! Von Regulierungswut hat die Bauernwelt die Nase voll, nicht wegen der Auflagen, sondern weil dafür niemand bezahlen will!
Gerade der rasante Strukturwandel der letzten Jahrzehnte legt diese zentrale Problematik schonungslos offen. Landwirtschaftliche Betriebe bleiben oft ohne Nachfolge, weil es an ökonomischen Perspektiven fehlt. Die freiwerdende Fläche begründet die Entwicklung der verbleibenden Betriebe, diese stemmen hohe Investitionen und müssen ihre Effizienz steigern, um bei steigenden Produktionskosten die Schuldenlast zu begleichen.
Gerne wird die moderne Landwirtschaft mit Umweltbelastungen und Biodiversitätsverlust in Verbindung gebracht. Die seit Jahrzehnten (!) stagnierenden Erzeugerpreise für Milch, Fleisch, Eier, Obst und Gemüse, aber auch Wein dagegen bleiben wissentlich unerwähnt. Die Behauptung, dass unsere Lebensmittel mittlerweile viel zu billig sind, muss erlaubt sein!
Offizielle Statistiken belegen, dass die Kosten der Lebensmittelversorgung einen Anteil am durchschnittlichen Einkommen von weniger als 10 % erreicht haben, Tendenz fallend! Selbst davon erreicht nur ein kleiner Bruchteil den Produzenten. Da dies (fast) jeden arrangiert, reden weder die Politik noch die Gesellschaft darüber! (Allenfalls die skandalöse Lebensmittelverschwendung wird sporadisch zum Thema erklärt)
Der Landwirtschaft muss unter den beschriebenen Verhältnissen der Zugang zum urbaren Boden erleichtert und nicht erschwert werden. Lebensmittel zu produzieren, gehört zur Souveränität jeder Nation. Den verbleibenden Produzenten steht neben kostendeckendem Wirtschaften ein vergleichbares Einkommen zu. Schon die Römischen Verträge von 1957 berücksichtigen diesen Aspekt. Wie die jüngere Vergangenheit uns zeigt, können selbst öffentliche Zuwendungen weder Ausgleich noch Allheilmittel für fehlende Markterlöse sein!
Es muss ein für allemal erkannt werden, dass auskömmliche Erzeugerpreise eine Voraussetzung darstellen, um den nötigen Optimismus in der Landwirtschaft und damit langfristig die Absicherung der Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Landwirtschaft ist längst viel kostengetriebener denn gewinnbezogen! Ökonomische Entspannung bei den Betrieben, ohne Regulierungswut, käme nahezu von selbst dem Naturschutz, Wasserschutz usw. entgegen.
Nachhaltigkeit beinhaltet das Gleichgewicht zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialen Aspekten. Ökonomische Entspannung in der Landwirtschaft, d. h. eine korrekte Bezahlung der erbrachten Arbeit, nutzt gleichzeitig der Ökologie und dem sozialen Umfeld. Wenn nach der Coronakrise fundamentale Neuausrichtungen nötig erscheinen, dann werden nach Empfinden der Landwirtschaft die Fragen „Was sind uns unsere Lebensmittel wert?“ und „Wieviel davon steht dem Produzenten zu“ zu den brennendsten zählen. Wird dies gesellschaftlich anerkannt werden und damit gar politisch gewollt sein?
Guy Feyder führt einen Milchviehbetrieb als Familienunternehmen in dreizehnter Generation und ist seit Januar 2019 Präsident der Landwirtschaftskammer.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
