- Religion
Žižek: Ohne Christentum kein wahrer Materialismus
Wie verstehen wir uns? – und warum ist diese Frage so wichtig?
Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek betitelt sein neuestes Buch Christian Atheism – How to be a real Materialist1. Damit befindet er sich in guter Gesellschaft mit Ernst Bloch, der bereits vor fünfzig Jahren schrieb: „Nur ein Atheist kann ein guter Christ sein, nur ein Christ kann ein guter Atheist sein.“2 Und so behauptet Žižek, dass der Mensch durch das Christentum hindurch gehen muss, um ein wahrer Materialist zu werden.
Es reicht nicht, die Existenz Gottes zu verneinen
Um seine politische Theologie zu begründen, rekurriert Žižek sowohl auf Hegel als auch auf zentrale neutestamentliche Schriften und nicht zuletzt auf Paulus.3 Und wie gewohnt, illustriert er seine Argumentation mit Filmen wie hier The Rapture (1991) von Michael Tolkin.
Žižek ist der Meinung, dass Atheisten sich nicht damit begnügen sollten, die Existenz Gottes einfach zu verneinen. In diesem Sinn folgt er der Überlegung Nietzsches, dass derjenige, der noch an die Grammatik glaube, an Gott glaube4. Der Atheist müsse sich vielmehr fragen, wie es mit seinem Glauben an etwas Stabiles, Unumstößliches, also einen „Big Other“, stehe. Darin folgt Žižek Lacan, der seine revoltierenden Pariser Studenten von 68 darauf aufmerksam machte, dass sie als Hysteriker eigentlich nach einem neuen Gott suchten, um sich ihm in Übertragung zu unterwerfen. Der eigentliche Atheist aber ist für Lacan derjenige, der sich bewusst ist, dass er immer noch unbewusst nach einem Meister sucht, dem er das Wissen um das Sein unterstellt.5
Jesus Christus als Sinnbild des Rätselhaften und Exzessiven
Das Christentum hat, wie alle Religionen, einen subversiven Kern. Gott steht dabei für den Exzess von Bedeutungs- und Reizüberschüssen. So wird im Hinduismus die Göttlichkeit Vishnu durch zahlreiche Arme symbolisiert. Bei den Juden ist Gott ein radikal jenseitiges Wesen, ein Anderes hinter den Phänomenen, von dem man sich allerdings kein Bild machen darf. Im christlichen Verständnis entäußert sich Gott nach Žižeks Lektüre von Paulus. Er wird ein einfacher Mensch, ein Sklave. Für den Christen ist Gott somit nicht das Perfekte an sich, sondern das Niedrige. Er hat etwas Unsichtbares an sich, eben ein Nichts. So leuchtet in ihm etwas Exzessives auf. „Christus ist also nicht ‚Mensch PLUS Gott‘: Was in ihm sichtbar wird, ist einfach die exzessive oder transzendierende Dimension im Menschen ‚als solchem‘. Also, weit entfernt davon, das Höchste im Menschen zu sein, die rein geistige Dimension, nach der alle Menschen streben, ist diese ‚Göttlichkeit‘ eher eine Art Hindernis. Der Punkt ist nicht, dass der Mensch aufgrund der Begrenzung seiner sterblichen sündigen Natur niemals vollständig göttlich werden kann, sondern dass der Mensch aufgrund seiner Unergründlichkeit, des Exzessiven in ihm, niemals vollständig Mensch werden kann.“6 Christus als Mensch Gott zu nennen, bezeichnet also das Exzessive, das extime Wesen des Menschen, das sich in ihm samt Rätselhaftigkeit und Zweifel zeigt. So konnte Pontius Pilatus sein „ecce homo“ gegenüber dem Mob, der den Lynchmord von Christus fordert, aussprechen.
Žižek ist der Meinung, dass Atheisten sich nicht damit begnügen sollten, die Existenz Gottes einfach zu verneinen.
Gott zweifelt an sich selbst
Dass Gott an sich selbst zweifelt, offenbart sich in den Worten Jesu Christi am Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Matthäus, 27,46) Wenn Jesus im Narrativ der Sohn Gottes ist, dann muss man sagen, dass Gott für einen kurzen Moment angesichts des grausamen Kreuzestodes nicht mehr an sich selbst glaubt. Dazu zitiert Žižek die emphatischen Worte von G. K. Chesterton: „Als die Erde erbebte und die Sonne am Himmel erlosch, geschah es nicht wegen der Kreuzigung, sondern wegen des Schreis, der vom Kreuz kam und der bekannte, daß Gott von Gott verlassen war. Und nun mögen sich die Anhänger der Revolution unter den Religionen einen Glauben und unter den Göttern einen Gott aussuchen, sie mögen alle Götter, deren Wiederkehr unausweichlich und deren Macht unwandelbar ist, sorgsam vergleichen. Sie werden keinen zweiten Gott finden, der selbst ein Rebell war. Mehr noch (und hier wird es zu schwer für die menschliche Sprache), auch die Atheisten mögen sich einen Gott aussuchen. Sie werden nur einen Einzigen finden, der ihre Einsamkeit in Worte gefasst hat, nur eine einzige Religion, in der Gott eine Sekunde lang Atheist zu sein schien.“7
Darüber hinaus verzichtet Gott auf seine Allmacht.8 Die Identifikation des Christen mit Christus bedeutet von daher, dass er nicht auf einen vom Übel erlösenden allmächtigen Gott wartet und diesen Fehl akzeptiert. So bleibt dem Christen nach dem Tod Jesu nur der Geist Christi als dem Geist der Entäußerung, der mit der Ohnmacht, dem Verschwinden des großen Anderen leben kann und will. Diese Art zu leben ist für Žižek ein Leben mit dem rätselhaften X, das wir Heiliger Geist nennen. Damit ist der Mensch in die Freiheit entlassen, in die Treue zum eigenen Begehren und die Liebe als „loving attachment to the Other’s imperfection“.9
Christentum als Ideologiekritik
Für Žižek ist die jüdisch-christliche Tradition in ihrem Ursprung Ideologiekritik. Dies zeigt schon das hebräische Buch Hiob. Christen erkennen sich im leidenden Hiob wieder und identifizieren sich mit Christus als der von seinem Vater Verlassene.
Am Kreuz offenbart sich für Žižek nicht nur die Ferne Gottes,sondern dass es nichts gibt, das die Konsistenz und Stabilität einer letztgültigen Bedeutung garantiert. Der Glaube an den allmächtigen Gott, den „großen Anderen“, wird hier in sein Gegenteil verkehrt. Der Kern des Christentums ist die Leere, die Nicht-Identität Gottes mit sich selbst. Von daher wird Paulus „als erster historischer Materialist bezeichnet, der seine Gemeinden um die metaphysische Leerstelle im Zentrum des messianischen Versprechens gruppiert und dadurch in einen Bereich jenseits ideologischer Weltbilder vordringt.“10 Der wahre Glaube ist somit der Sprung ins Nichts.
Gott als das Böse
Eine Antwort auf den Sinn des Leidens und des Bösen kommt nicht von Gott. Somit steht dieser selbst für das Böse. Die wahre Formel des Atheismus ist nicht „Gott existiert nicht“, sondern „er ist auch dumm, gleichgültig und vielleicht sogar geradezu böse“.11
Einem solchen Gott, wenn es ihn denn gäbe, dient man nicht, schreibt Žižek. Das zeigt die letzte Geste der Heldin im Film The Rapture: Selbst wenn sie sich direkt mit der göttlichen exzessiven Dimension konfrontiert, weigert sie sich, ihm zu dienen. Wenn sich Sharon im letzten Moment des Films umdrehte, hätte sie den sterbenden Christus, der nicht mehr an den Vater glaubt, an ihrer Seite gesehen.
Occupy Bewegung: Hier ist der Heilige Geist
Für Žižek kann die christliche Gemeinde nach dem Tod Gottes am Kreuz nicht zurück zu einem „transzendenten Einen“. Sie ist vom Heiligen Geist in den Abgrund der Freiheit geworfen. Deshalb sagte Lacan, dass „der Heilige Geist ein Begriff ist, der unendlich weniger dumm ist als der des Subjekts, dem Wissen unterstellt wird“, also dem Lehrer, Politiker, Analysten.12 Das Wort „Heiliger Geist“ bezeichnet, dass die christliche Gemeinschaft sich nicht auf ein vermeintliches Wissen verlassen muss. Sie versteht sich als eine egalitäre Gemeinschaft von Gläubigen, die durch ihre Liebe zueinander verbunden sind, sich exzesshaft herausgefordert sehen, und die nur ihre eigene Freiheit und Verantwortung haben, dies zu tun: So interpretiert Žižek auch das Wort von 1 Joh 4,12: „Niemand hat Gott je geschaut; wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet.“
Christlicher Atheismus versteht sich als bedingungsloses Engagement, das auf letzte Ziele wie ein ewiges Leben und damit auf teleologische Visionen verzichtet.
Mit anderen Worten: Der Heilige Geist ist eine atheistische Kategorie, der Begriff einer emanzipatorischen Gemeinschaft, befreit vom Diktat des Gesetzes, ohne Unterstützung eines großen Anderen.13 Hiermit überwindet Religion sich selbst. Der atheistische Akt gehört schon zum Christentum. Die wahre christliche Ethik kommt dann zum Vorschein, wenn man den Tod Gottes akzeptiert, diesen Punkt der unendlichen Resignation, den Nullpunkt, der zur Kreativität und Verantwortung auffordert. Dies verkörperte die Occupy Wall Street Bewegung, vor der Žižek 2011 sprach.
Politische Theologie oder: Was lernt der Atheist vom Christentum?
Es wird viel von politischer Theologie gesprochen. Aber was ist damit genau gemeint?
Für Žižek wird eine Theorie theologisch, wenn sie von einem vollen politischen Engagement eines Einzelnen getragen wird. Dieses Engagement fußt ja auf einer Entscheidung und einem Glauben, der sich erst im Nachhinein verifiziert, wie es Kierkegaard gezeigt hat. Die Entscheidung, der Glaube des Christen wie der des Marxisten, misst sich somit an der Qualität seines Engagements in der Welt.14
Radikal ethisch ist eine Position, wenn das Subjekt des Rückhalts in einem großen Anderen (die Familie, die Partei, der Staat oder eine Religionsgemeinschaft) beraubt ist, sodass es eine Entscheidung im Abgrund seiner Freiheit treffen muss. Eine solche Entscheidung steht für den Moment, in dem die Ethik politisch wird, d. h., wenn das Subjekt sich fragt, wie es seine Prinzipien in der Gesellschaft umsetzen kann.15
Von hier aus versteht man, dass jede Theologie politisch ist, da es um die Positionierung zum sozialen Engagement geht. Der Narrativ des christlichen Atheismus geht vom Riss in Gott, im Sein und gibt der Negativität, der Leere einen Platz. Christen wie Atheisten lassen sich so bis zum Nullpunkt führen. Aus der Leere entwickeln sie dann kreativ Neues.
Christlicher Atheismus versteht sich als bedingungsloses Engagement, das auf letzte Ziele wie ein ewiges Leben und damit auf teleologische Visionen verzichtet.16
Der buddhistische Rückzug unter Ideologieverdacht
Von seiner Idee der Leere aus schlägt Žižek einen Bogen zum Buddhismus, wo das Leerwerden anvisiert wird. Dabei weist er nicht nur darauf hin, dass die innere Leere, das zur Ruhe kommen, parallel und „in Distanz“ zur Ausbeutung oder sogar zur Ausradierung des Anderen bestehen kann. So war etwa Heinrich Himmler bekanntlich ein Anhänger des Buddhismus und Hinduismus. Die Bhagavadgita war eines seiner bevorzugten Bücher. Žižeks Kritik am Buddhismus fußt darauf, dass das erleuchtete Bewusstsein keine Selbstbewusstheit mehr ist: Ich erfahre mich nicht länger als wirkende Kraft hinter meinen Gedanken; mein „Bewusstsein ist das unmittelbare Bewusstsein eines selbstlosen Systems, eines Wissens ohne Selbst.“17
Künstliche Intelligenz als Big Other oder als idiotisches Wissen
Die Kluft, in der wir leben, ist die Unmöglichkeit, eins mit sich selbst zu sein. Die Leere ist nichts anderes als die Unmöglichkeit ganz Einer/Eine zu sein.18 Damit umzugehen ist schwierig. Deshalb setzen wir heute unsere Hoffnung trotz mancher Befürchtungen auf digitale Maschinen, die uns das Leben erleichtern sollen. Žižek fragt jedoch, ob die digitale Maschine nicht eine der letzten Verkörperungen des großen Anderen ist, der, wenn nicht Wahrheit, dann jedoch zumindest Wissen unterstellt wird.19 Damit einhergehend entwickelt sich der Glaube, das Exzessive, das Monsterhafte des Nachbarn wie der eigenen Existenz in den Griff zu bekommen. Die Konsequenz wäre dann, dass es kein Unbewusstes mehr gibt. Wir brauchen also keine Verantwortung für unseren Bezug zum Unbewussten zu übernehmen. Dies wird jedoch nicht geschehen, denn digitale Maschinen besitzen Wissen, aber das Entscheiden können sie uns eigentlich nicht abnehmen. Verantwortung und Schuld können wir nicht auf sie abwälzen.
Die Bedeutung der Leere
Das Narrativ vom Tod Gottes am Kreuz symbolisieren das Loch in der Realität, den fundamentalen Riss, den wir Menschen nicht flicken können. Transzendenz ist damit nicht völlig abgeschafft. Sie zeigt sich in der Liebe des unbeholfenen und miserablen Wesens Mensch.20 Damit betont Žižek aber auch, dass selbst ein dialektischer Materialist sich nicht mit reiner Immanenz begnügen kann. Wir sind fundamental mit einem irreduziblen Bruch in der Immanenz konfrontiert. „Gott“ ist der Name für die Tatsache, dass der Mensch nicht ganz Mensch ist, dass es in seinem Kern eine unmenschliche, exzessive Dimension gibt. Wir wollen ein Mehr an Genießen, mehrdeutig ausgedrückt, ein „plus d‘homme“ sein.
Eine Theologie, die alles zu wissen vorgibt und die Welt so konstruiert, wie es ihr politisch gefällt, erscheint heute als ideologisch durchsichtig und kontraproduktiv.
So gründet unser Unbewusstes in der traumatischen Begegnung mit der Andersheit, dessen Intrusion alles Kausale, Berechenbare stört. Die Symptome sind unsere Mittel, um damit fertig zu werden. Das Phantasma gebrauchen wir, um den Bruch zuzudecken.21 Gerade die Erzählungen von Wunderheilungen in den Evangelien berichten von Illusionen, Phantasmen, die erkannt werden müssen, d. h., wo die Leere, bzw. die Lücke von Sinn akzeptiert werden muss, damit man neu anfangen kann zu leben. Das ist die frohe Botschaft Jesu. Dementprechend ist es die Aufgabe der Psychoanalyse, gerade in allen fundamentalistischen Strömungen oder Ideologien den libidinösen und phantasmatischen Einsatz zu erkennen.22 Insofern ist Christentum kein Opium für das Volk.
Was kann die Theologie von Žižeks hegelianisch-lacanianischer Lektüre des Christentums lernen? Seine Überlegungen können die Theologie und die Kirchenleitungen ermutigen, ihre eigenen Versteinerungen zur Lehre (doxa), ihre Missverständnisse, Lügen und Symptome (wie Missbrauch, Austritte, Frauenbild, Machtstrukturen, Angst vor echtem Dialog …) zu reflektieren; und der sich immer entziehenden Wahrheit und „Gott“ auch als Signifikant für Leere einen Platz zu geben. Eine Theologie, die alles zu wissen vorgibt und die Welt so konstruiert, wie es ihr politisch gefällt, erscheint heute als ideologisch durchsichtig und kontraproduktiv.
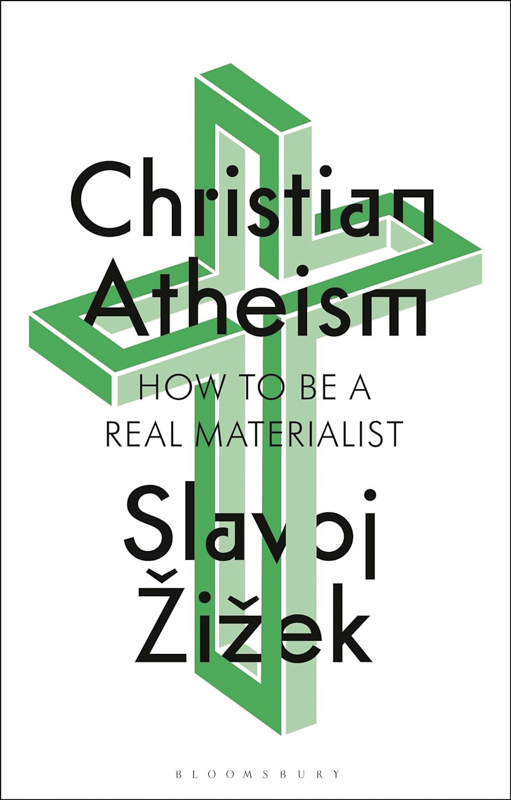
Jean-Marie Weber, Theologe und Psychoanalytiker, ist Dozent an der Universität Luxemburg.
1 Slavoj Žižek, Christian Atheism. How to be a real Materialist. London, New York, Bloomsbury, 2024.
2 Ernst Bloch, Atheismus im Christentum, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1973, S. 6.
3 Stellvertretend seien hier folgende Schriften genannt: Das fragile Absolute, Die gnadenlose Liebe, Die Puppe und der Zwerg.
4 Friedrich Nietzsche, Götzendämmerung, S. 78 KSA.
5 Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XVI, D’un Autre à l’autre , Paris, Seuil, 2006, S. 281.
6 Slavoj Žižek, On Belief, London, New York, Routledge, 2001, S. 90ff.
7 Gilbert K. Chesterton, Orthodoxie. Eine Handreichung für den Ungläubigen, Frankfurt am Main, Eichborn, 2000, S. 259.
8 Žižek, Christian Atheism, S. 1.
9 Žižek, On Belief, S. 147.
10 Dominik Finkelde, Politische Eschatologie nach Paulus – Badiou – Agamben – Žižek – Santner, Wien, Turia + Kant, 2007, S. 16.
11 Žižek, Christian Atheism, S. 46.
12 Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XV, L’acte psychanalytique, Paris, Seuil, 2024, S. 165.
13 Žižek, Christian Atheism, S. 45ff.
14 Idem, S. 199ff.
15 Idem, S. 211.
16 Idem, S. 266.
17 Idem, S. 81.
18 Žižek, Christian Atheism, S. 89.
19 Idem, S. 190.
20 Žižek, On Belief, S. 90.
21 Slavoj Žižek, Freedom a disease without cure, London, New York, Bloomsbury Academic, 2023, S. 55.
22 Idem, S. 251.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
