- Philosophie, Politik
Sag, wie hältst du es mit der Würde?
Es gibt etwas, das den Menschen auszeichnet, das weder Körper noch Geist ist. Wir finden es so wichtig, dass es sogar im ersten Satz der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erscheint: die Würde des Menschen.
Dieses Würde-Etwas findet auch institutionell Erwähnung: im deutschen Grundgesetz, im französischen Code Civil, auch in der neuen luxemburgischen Verfassung, allerdings erst in Artikel 12. Im Alltag scheint diese Würde schnell in Gefahr. Es muss an sie erinnert, ausdrücklich an sie appelliert werden. Besonders im Falle von Schwächeren, vielleicht Alten, aber auch von Kindern wird mahnend der Finger gehoben – ein würdevolles Leben muss für jeden möglich sein! Da stimmt man schnell zu, weil moralisch nachvollziehbar – aber was versteht man überhaupt unter Würde? Wird dieses Ideal in unserer Gesellschaft verwirklicht? Bei der aktuellen Debatte um die Armut in Luxemburg zeigt sich, dass „Würde“ zwar oft erwähnt, aber keineswegs eindeutig bestimmt ist und noch weniger universell gilt. Zudem wird der Begriff inflationär benutzt und dadurch verwässert: Wissen wir noch, was wir meinen, wenn wir von Würde sprechen?
„Die Würde“ – unmöglich zu definieren?
Der Versuch, die Würde des Menschen begrifflich zu fassen, ist zum Scheitern verurteilt. Es scheint weder etwas Materielles zu sein noch lediglich eine Idee. Viel eher geht es um ein Gefühl. Dieses Gefühl ist aber nicht sinnlich ausgelöst, es kommt irgendwie aus unserm Innersten. Es scheint demnach eine Art Intuition dafür zu geben, dass dem Menschen etwas Besonderes zukommt, etwas, das wir zu achten haben, ohne genau zu wissen, was es ist oder wo es herkommt.
Ohne die Ideengeschichte des Würdebegriffs aufarbeiten zu wollen (siehe dazu z. B. die Werke von Arnd Pollmann), ist ein kurzer Blick in dessen Entwicklung dennoch interessant. Träger der Würde waren früher, z. B. im alten Rom, diejenigen, die ein besonderes Amt innehatten, etwa wegen ihrer besonderen Fähigkeiten oder Taten. Würde stellte sich ein, wenn der Person eine Besonderheit zukam – man trat ihr dann wohl ehrfürchtiger, respektvoller gegenüber.
In einem schwierigen sozialen Umfeld, mitsamt negativen Erfahrungen, ist das Selbstwertgefühl schwerer nachhaltig aufzubauen.
Die griechische Stoa versuchte hingegen, den Begriff allgemeiner zu fassen. Allen Menschen kommt Würde zu und weil sie durch das sich Besinnen ein tugendhaftes Leben führen können, kann das würdevolle Leben so verwirklicht werden. Auch hier ist die Würde an ein Handeln gebunden. Würde weist in beiden Fällen auf das Innerste des Menschen, das sich im Realen beweisen muss.
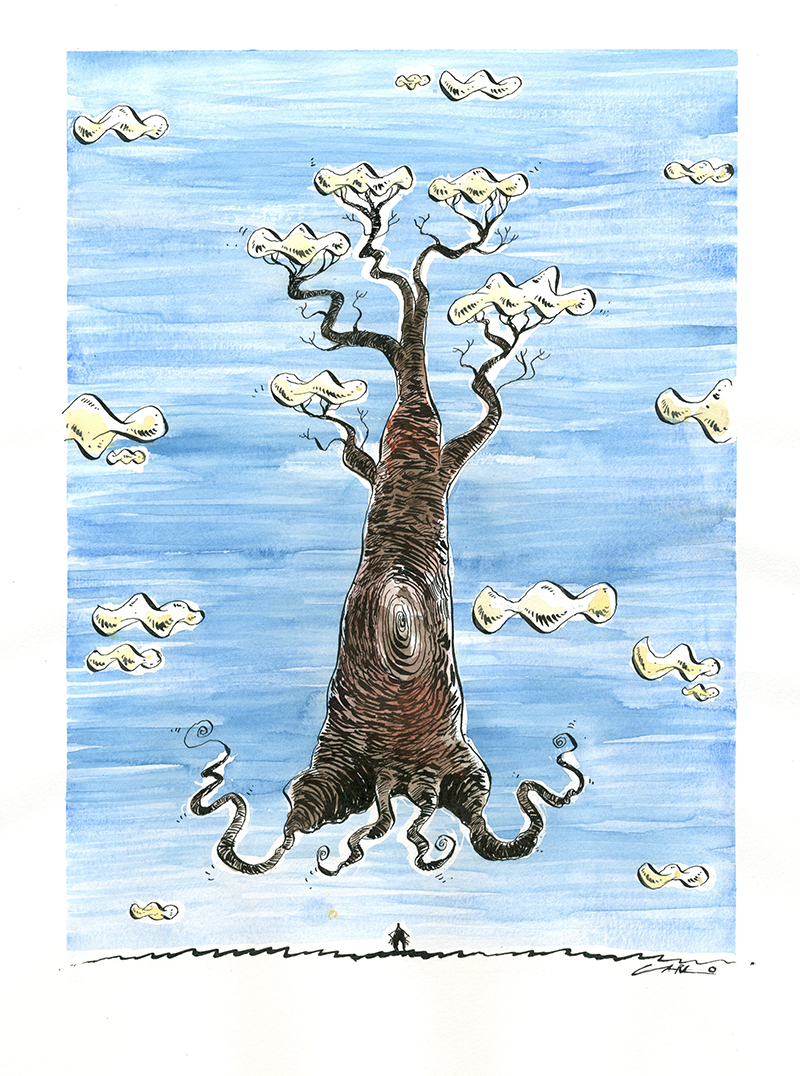
Würde ist hier nun etwas, das durch eine Fähigkeit erworben wird und das an Bedingungen geknüpft ist. Dies beantwortet vielleicht, wo die Würde herkommt. Wenn Würde aber lediglich Menschen zukommen kann, die sich durch besonderes oder moralisches Denken und Handeln auszeichnen, dann muss die Frage gestellt werden, ob Menschen, die nicht autonom denken und handeln können, keine Würde zukommt? Autonomie ist nämlich, vor allem bei Immanuel Kant, die Fähigkeit der vernünftigen Person, selbstbestimmt zu leben. Die vorher angesprochene Achtung kommt in diesem Kontext intuitiv auf. Welch eine Kraft wir durch unsere Vernunft haben: Wir können uns sittlich verhalten, sinnlichen Trieben entsagen und uns entgegen jeglichen Neigungen und Interessen für das Vernünftig-Gute entscheiden. Sich aus sich selbst heraus für die vernünftige Handlung entschließen, das macht den Menschen aus, das verleiht ihm Würde. Interessant ist, dass sich Würde auf ein Potenzial richtet, auf eine Fähigkeit, sich so zu verhalten. Ist es Menschen, die sich nicht derart korrekt verhalten können, unmöglich, Würde zu empfinden? Das scheint mit der heutigen Menschenwürde in Konflikt zu geraten: Muss nicht jeder gleichermaßen gemeint sein?
Cicero weist zwar darauf hin, dass jedem diese Achtung entgegenzubringen ist; dabei gehörten Sklaverei und politische Unterdrückung im alten Rom dennoch zum Alltag.
Sich über eine entsprechende Fähigkeit oder korrektes Verhalten für die Würde zu qualifizieren, scheint also nicht haltbar. Kann die jüdische oder christliche Tradition dieses Problem umgehen? Da es hier Gott ist, der dem irdischen Bewohner die Würde verleiht – bedingt dadurch, dass er den Menschen schöpft – kann jeder davon profitieren, ganz gleich seiner Fähigkeiten. Allerdings kann man hier einige Fragen aufwerfen: Wenn es Gott ist, der die Würde verleiht, wird dieser dann nicht der Eigenwert genommen? Ist Menschenwürde nicht oberstes Gut, das an sich unbedingt sein muss, und nicht auf ein weiteres Höchstes zurückgeführt werden darf? Verfügen wir nur über Würde, weil Gott es so wollte? Die Autonomie des Menschen, seines Denkens und Handelns scheint nicht mehr im Vordergrund zu stehen. Ein weiterer Einwand: Ist diese Position an eine religiöse Einstellung gebunden? Kann ein areligiöser Mensch Würde empfinden? Oder versteht dieser es nicht, sich und die Person des anderen zu achten?
Man kann auch, wie anfangs angedeutet, intuitiv davon ausgehen, dass dem Menschen dadurch, dass er Mensch ist, Würde zugesprochen wird. Dies bedeutet aber nicht, dass jeder jederzeit diese Würde empfinden oder ausleben kann. Es scheint also eine zweischneidige Universalität zu geben: Zum einen kann a priori jedem Würde zukommen, und hier ist wirklich jeder gemeint, zum anderen ist diese Würde aber nicht dauernde Realität.
Würde versteht sich in diesem Fall als „Einstimmung“ des Subjekts. Das englische attunement trifft es dabei etwas genauer. Also eine Gemütshaltung: Erst dann, wenn ich der grundlegenden Überzeugung bin, dass mir ein innerer Wert zukommt, und dies ebenso für alle anderen Menschen gilt, dann nehme ich eine Haltung ein, der Würde entspricht. Weil nur dann gehe ich intuitiv und bedingungslos davon aus, dass die Person als solche absolut achtenswert und zu respektieren ist.
Würde durch (Be)-Achtung und Selbstachtung
Mein attunement ist in diesem Fall jedoch mehrseitig beeinflusst. Pollmann und Menke haben in der Philosophie der Menschenrechte darauf hingewiesen: Zum einen hängt es natürlich von meinem Charakter selbst ab, wie auch von der sozialen Prägung und Erziehung. Wer als Kind geschätzt und ernst genommen wurde und wer früh lernte, dass uns alle etwas Gleiches verbindet, und zwar das Menschsein, das stärker ist als jeder Unterschied, hat es später wahrscheinlich leichter, sich selbst und den anderen mit Achtung zu begegnen. Dies schützt einen in den Momenten, in denen man ungleich behandelt wird – man steht dann vielleicht eher für sich ein. In einem schwierigen sozialen Umfeld, mitsamt negativen Erfahrungen, ist das Selbstwertgefühl schwerer nachhaltig aufzubauen. Eine Haltung in Selbstachtung oder eine, in der auch der Mitmensch als gleicher angesehen wird, stellt sich nicht so leicht ein.
Es scheint demnach eine Art Intuition dafür zu geben, dass dem Menschen etwas Besonderes zukommt, etwas, das wir zu achten haben, ohne genau zu wissen, was es ist oder wo es herkommt.
Dies spricht zwei Settings an, die das Potenzial, Würde zu empfinden und zu leben, bestimmen: erstens, meine Fähigkeit zur Selbstachtung, zweitens, das Umfeld, das mir Achtung entgegenbringt oder nicht. Wer sich nicht in einer Gruppe austauschen kann, weil ihm Häme oder Vorurteile begegnen, dem fehlt die Wechselwirkung durch andere: Selbstachtung wird davon beeinflusst, dass einem Achtung auch von außen zukommt.
Soweit die These. Empfindet aber etwa Robinson Crusoe (ohne Freitag), sein Leben als würdevoll, wenn niemand anders da ist, der ihm (Be-)Achtung schenkt? Wahrscheinlich schon, denn durch sein früheres Leben ist ihm bekannt, was Achtung und Beachtung bedeuten. Seine Selbstachtung hat sich vor dem Schiffbruch aufgebaut. Wie sähe es mit dem Menschen aus, der ganz allein, ohne jeglichen Kontakt zu Mitmenschen aufgewachsen ist? Empfindet der Würde? Oder ist die Spiegelung der Achtung notwendig, um Selbstachtung zu empfinden? Die Frage kann nicht beantwortet werden, ein Experiment ist aus ethischen Gründen ausgeschlossen; es würde die Würde des Menschen verletzten, da er als Mittel zum Zweck herhalten müsste.
Das dritte Setting, neben dem persönlichen und dem zwischenmenschlichen, ist der institutionelle Rahmen, der das Leben in Selbstachtung und ohne Fremdbestimmtheit möglich machen soll. Der Staat scheint hierfür Verantwortung übernehmen zu wollen, so lautet es zumindest in der Verfassung: die Unverletzlichkeit der Würde, die Wahrung der Würde und Freiheit des Menschen, wie auch, dass der Staat darüber wacht, dass jeder in Würde leben können muss. Es ist Aufgabe des Staates, den Bürgern hierfür bestimmte Bedingungen zu bieten. Dazu gehören etwa Modalitäten für Sicherheit und Freiheit. Sie merken schnell, dass wir uns thematisch den Menschenrechten nähern. Die, so auch hier in Pollmanns Buch Menschenrechte und Menschenwürde, als staatliche Garantie für den Schutz der Menschenwürde zuständig sind.
Doch bleiben wir bei der Würde, die der Staat zu achten hat. Die erwähnten Bedingungen müss(t)en darauf abzielen, jedem Bürger ein Leben zu ermöglichen, in dem er Würde gegenüber sich selbst, durch und für seine Mitmenschen empfinden kann. Dies impliziert wiederum, dass der Staat jeden Bürger als gleich ansieht, der gleiches Recht auf die Verwirklichung des Lebens in Würde hat. Dies betrifft genauso die bettelnde Person wie die Reichsten der Reichen. Und hier fängt es scheinbar an, ein wenig schwierig zu werden.
Das Bettelverbot und die Menschenwürde
In Bezug auf das aktuelle Bettelverbot wird klar, dass Würde nicht von jedem als universal angesehen wird. Verbiete ich einer Person, sich in der Öffentlichkeit bettelnd zu zeigen, dann achte ich die Person als solche nicht. Ich trete ihr nicht mit Respekt gegenüber, denn ich verfüge darüber, wo sie sich aufzuhalten und wie sie ihren Platz in der Gesellschaft zu verstehen hat. In diesem Fall geht sie zwar keiner Straftat nach, aber dennoch ist ihr Sosein unerwünscht und sie wird dazu gebracht, nicht mehr an dem von ihr gewählten Platz zu sitzen.
Da wir über das Setting diskutieren, in dem ein Leben in Würde möglich ist oder nicht, muss Folgendes beachtet werden: Wenn ich institutionell bestimme, dass ein Dasein einer Person so nicht wünschenswert ist, dann säge ich an einem Pfeiler, der für das Würde-Empfinden der Person tragend ist (und beeinflusse implizit die beiden anderen) – nämlich die Akzeptanz als Gleicher unter Gleichen, der gleich behandelt und geachtet wird. Demnach verletzt in diesem bestimmten Fall eine Wegweisung nicht nur die Würde der Person, sondern verhindert auch, dass Bedingungen erfüllt sind, um in Würde, nämlich in gegenseitiger Achtung, leben zu können.
Wie sähe es mit dem Menschen aus, der ganz allein, ohne jeglichen Kontakt zu Mitmenschen aufgewachsen ist?
Es geht aber noch viel weiter. Wenn wir all denen, die über das Image-schädigende Bild der Bettler klagen, entgegenkommen und die Bettler aus dem Sichtfeld streichen, dann nehmen wir den Klagenden die Grundlage dafür, um Würde empfinden zu können. Ich erinnere daran: Erst dann, wenn ich wahrhaft aus dem Innersten heraus der Überzeugung bin, dass jedem Menschen Achtung, Gleichheit und Freiheit zukommen muss, im gleichen Ausmaß als auch mir selbst, dann erkenne ich den Wert der Menschheit an. Klammere ich auch nur eine Person hier aus, dann bricht die Erhabenheit dieses Gefühls und Würde verliert ihre Würde.
In der Fähigkeit, so ein attunement einzunehmen, besteht aber nun mal das Potenzial überhaupt, Würde zu empfinden. Romantisieren wir unser Stadtbild und mit ihm das Weltbild einiger Leute, indem arme Leute ausgeklammert, nicht geachtet werden, dann ist dies auf institutioneller Ebene eine Absage an das Potenzial, Gleichheit, Respekt und Freiheit universal denken und leben zu können.
Nicht nur erschwert das den Verbannten die Bedingungen, Achtung für sich und andere empfinden zu können, sondern auch für die Wegweisenden, da es sie in ihrer Illusion bestärkt, über andere als Mittel zum Zweck verfügen zu können. Es hindert sie daran, den Anderen als gleichwertigen Anderen anzuerkennen: Universalität der Würde wird so unmöglich. Ihnen selbst ist das authentische und selbstbestimmte Leben erschwert, wenn man diese Ideen bedient und am Leben hält; ein Leben in Selbsttäuschung ist kein Leben in Würde.
Es sagt demnach sehr viel über Menschen, Gesellschaften und Regierungen aus, wenn man die Universalität der Würde genauer betrachtet und fragt, wer denn eigentlich entscheiden darf, wem wann, wo und wieviel Würde zukommt. Die Gretchenfrage ist aktueller denn je: Sag, wie hältst du es mit der Würde?
Nora Schleich ist in der Philosophievermittlung tätig. Nachdem sie in Mainz zu Immanuel Kant promovierte, arbeitet sie freiberuflich in Luxemburg. Sie beschäftigt sich mit Fragen zu Kultur und Gemeinschaft, Gerechtigkeit und Wissenschaft, und interessiert sich für die existenziellen Probleme und Phänomene, die sich aus dem Verhältnis zwischen Mensch und Lebenswelt ergeben. Außerdem ist Nora Schleich Programmkoordinatorin der EwB asbl.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
