- Politik
Bitte aufwachen: Unser demokratisches, liberales Gesellschaftsmodell ist keine Selbstverständlichkeit mehr!
Einleitung ins Dossier
Demokratie stirbt nicht erst, wenn es keine Wahlen mehr gibt. Denn Demokratie ist mehr als allgemeines Wahlrecht. Zur liberalen, parlamentarischen Demokratie gehören folgende Grundsätze als wesentliche Bestandteile, die gleichzeitig erfüllt sein müssen:
- die Mehrheit der Betroffenen entscheidet, ist aber eingeschränkt durch Verfassung und Rechtsstaat und kann von Wahl zu Wahl ändern;
- die gesetzgebende, die ausführende und die richterliche Gewalt sind getrennt, d. h. werden jeweils von Personen ausgeübt, die nur an einer der drei Staatsgewalten beteiligt sind;
- der Rechtsstaat wird von allen, inklusive der an den Staatsgewalten beteiligten Personen respektiert;
- die Menschenrechte gelten für alle BewohnerInnen des Staatsterritoriums, Minderheiten sind also ausdrücklich vor dem Willen der Mehrheit geschützt.
In den entwickelten parlamentarischen Demokratien wird der Wille der Mehrheit von Personen ausgeführt, die von der Mehrheit des Staatsvolkes gewählt wurden. Das setzt einen ehrlichen, fairen, inklusiven Meinungsbildungsprozess voraus, bei dem alle BürgerInnen dieselben Chancen haben und die Optionen klar erkennbar sind. Die Mehrheit der Gewählten stimmt über die Gesetze ab und spricht einer Regierung das Vertrauen aus, die in der Regel neue Gesetze vorbereitet und für die Ausführung und Einhaltung der Gesetze sorgt, deren Nicht-Einhaltung von unabhängigen Gerichten geahndet wird.
Diese für die meisten EinwohnerInnen Luxemburgs selbstverständliche Staatsform ist weltweit in Gefahr. Dem seit 2006 von The Economist erstellten Demokratieindex zufolge leben nur noch 15 % der Weltbevölkerung in vollständigen Demokratien.1 In diesem Ranking belegt Luxemburg 2024 mit 8,88 von 10 Punkten den zehnten Platz. Spitzenreiter ist Norwegen mit 9,81 Punkten. Nur 25 Staaten erhalten das Label „vollständige Demokratie“.
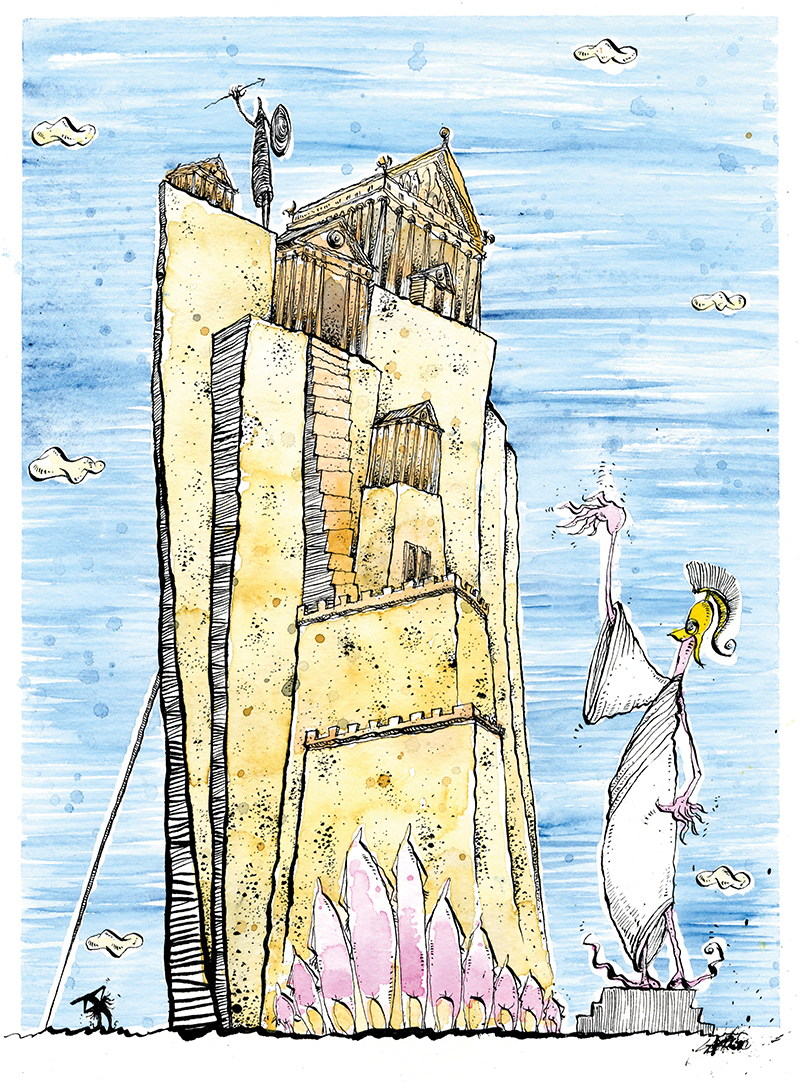
In den USA ist ein mit knapper Mehrheit der Wahlmänner gewählter Präsident dabei, ohne vom Kongress gebilligte Gesetze seinen persönlichen Willen durchzusetzen und die Gerichte mit GesinnungsgenossInnen zu besetzen, sodass sie die Regierung nicht mehr unabhängig kontrollieren. Zudem sollen seine Parteifreunde in den Bundesstaaten die Wahlbezirksgrenzen so abändern, dass den Republikanern mehr Sitze zufallen. Die Gewaltenteilung ist de facto weitgehend aufgehoben und der Rechtsstaat, d. h. die seit langem bestehenden Gesetze zum Schutz des Volkes vor den Regierenden, wird nicht mehr respektiert. Trump wie Orbán in Ungarn tun alles, um bei zukünftigen Wahlgängen den Sieg einer Alternative zu verhindern. Ähnliche Tendenzen gibt es mit mehr oder weniger dauerhaftem Erfolg in Europa auch in der Slowakei, Italien, der Türkei, aber auch in Israel, während in Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien und den Niederlanden Parteien an Stimmen gewinnen, die die Menschenrechte einschränken und den Rechtsstaat eingrenzen wollen. In den Augen der forum-Redaktion hat die Lage der Demokratie in der Welt eine Alarmstufe erreicht, die unbedingt ein Gegensteuern verlangt. Diesem Anliegen fühlt sich die Redaktion in ihrer fast 50-jährigen Tradition verpflichtet.2
Tendenzen zur sogenannten „illiberalen Demokratie“ sind durchaus auch in Luxemburg zu erkennen, auch wenn die dafür am ehesten in Betracht kommende Partei bislang vor allem in von den traditionellen Parteien vernachlässigten, ländlichen Gegenden einen gewissen Erfolg hat. Aber das ist nicht die größte Gefahr. Diese besteht eher darin, dass traditionelle, demokratische Parteien, aus Angst, WählerInnen an rechtsextreme Konkurrenten zu verlieren, deren Diskurs und deren Pseudolösungsansätze übernehmen. Einen rezenten Beweis für diese Versuchung lieferte CSV-Innenminister Léon Gloden im Lëtzebuerger Land vom 8. August 2025: Auf die offenbar die öffentliche Ordnung störenden Obdachlosen hinweisend gebrauchte er zuerst das bei Populisten sehr beliebte, rhetorische Argument: „Est-ce que vous trouvez ça normal?“, um die ZuhörerInnen für seine Position zu vereinnahmen. Dann antwortete er dem Journalisten, der ihm die Kritik vieler zivilgesellschaftlicher Vereinigungen an den von ihm geplanten und zum Teil schon durchgesetzten Maßnahmen gegen das Betteln im öffentlichen Raum entgegenhielt: „Ce sont toujours les mêmes associations qui trouvent que ce n’est pas bien. Mais je vous le dis: La majorité silencieuse est d’accord.“ Wegen solcher missbräuchlichen Berufungen auf die angebliche Mehrheit im Volk ist es wichtig zu betonen, dass die Demokratie nicht nur aus Wahlen besteht, sondern auch aus einem Rechtsstaat, dessen Regeln auch für die Mehrheit gelten und der Minderheiten schützt. Die Berufung auf den vermeintlichen Volkswillen ist umso heuchlerischer, als etwa in Sachen Wohnungsbaupolitik nur die Interessen der Eigentümerelite berücksichtigt werden, nicht aber jene der immer breiteren Schicht an Haushalten, die sich weder eine Eigentumswohnung noch die steigenden Mieten leisten können, ohne dass das ehrlich eingestanden würde.
Die aus dem Nazismus-, Faschismus- und Stalinismus-Terror erwachsene Abschreckung funktioniert nicht mehr.
Zudem ist historisch nachweisbar, dass die meisten Demokratien nicht infolge eines Staatsstreichs oder einer Revolution untergingen, sondern schleichend, von innen zersetzt. Wahlen kann man in der Tat missbrauchen, wie Josef Goebbels, Hitlers Propagandaminister, uns lehrt:
„Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen. Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre eigene Sache. Uns ist jedes gesetzliche Mittel recht, den Zustand von heute zu revolutionieren. […] Wir kommen nicht als Freunde, auch nicht als Neutrale. Wir kommen als Feinde! Wie der Wolf in die Schafherde einbricht, so kommen wir!“3
Wir haben in forum schon öfters darauf hingewiesen, dass die NSDAP, die Nazi-Partei Hitlers, auch auf der Grundlage von Wahlen erfolgreich war: Sie erreichte am 14. September 1930 18 % der Wählerstimmen, am 31. Juli 1932 37 %, und erlebte dann mit 34 % am 6. November 1932 einen leichten Rückschlag. Trotzdem übertrug Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler am 30. Januar 1933 das Amt des Reichskanzlers und ein Politiker wie Franz von Papen, Mitglied der Zentrumspartei, Vorgänger der CDU, trat in die Regierung ein, in der Absicht, „ihn [Hitler] in die Ecke zu drücken bis er quietscht“. Die Erfahrung dieses für Millionen Menschen tödlichen Irrtums ist heute leider nicht mehr Allgemeingut. Die aus dem Nazismus-, Faschismus- und Stalinismus-Terror erwachsene Abschreckung funktioniert nicht mehr. Auch in Luxemburg verharmlost eine Rechtspartei das Tragen von Nazisymbolen als Kinderspiel. Daher wird im forum-Dossier stärker juristisch und politisch, weniger historisch argumentiert.
Das forum-Dossier versucht, aus luxemburgischer Perspektive die Frage nach der Resilienz unseres politischen Systems aufzugreifen. Es beinhaltet drei Teile:
a) Wie funktioniert zurzeit der Rechtsstaat in Luxemburg? b) Welche Gefahren drohen der Demokratie? Wovon gehen diese Gefahren aus? c) Wie können wir diesen Gefahren begegnen?
Zuerst teilt Chamber-Präsident Claude Wiseler im Interview seine Einschätzung der Lage in Luxemburg. Dabei stellt er auch den von ihm auf Wunsch der VertreterInnen von vier Jugendparteien (CSJ, JDL, JSL, Jonk Gréng) initiierten Stresstest vor, dem in den nächsten Monaten die luxemburgische Demokratie unterzogen werden soll, um herauszufinden, ob sie in der Lage ist, einem potenziellen Wahlerfolg einer rechtsextremen Partei standzuhalten. Anschließend gibt der Historiker Fabio Spirinelli einen Überblick über die Entwicklung der Demokratie in Luxemburg.
Den belgischen Politikwissenschaftler François Debras, der vor wenigen Monaten beim Institut Pierre Werner zu Gast war, baten wir um Beantwortung der Frage, wie Demokratien sterben. Revolutionäre Umstürze oder militärische Staatsstreiche sind nur in Ausnahmefällen der Grund. Demokratien mutieren heute oftmals von innen heraus zu „illiberalen Demokratien“, wie er am Beispiel der USA, aber auch Polens, darstellt. Anschließend weist Michel Cames auf die wirtschaftlichen und steuerpolitischen Hintergründe hin, die zu Ressentiments und sozialer Ungleichheit und damit zur Infragestellung der Demokratie4 führen. Jürgen Stoldt stellt eine Publikation über das politische System Luxemburgs aus der Feder des LSAP-Politikers Alex Bodry vor, in der der Autor nicht nur die juristischen Grundlagen, sondern auch die Stärken und Schwächen der Luxemburger Demokratie aus der Perspektive der Praxis erläutert. Fernand Fehlen zeigt die formellen Hürden und Ungleichheiten, denen die EinwohnerInnen des Großherzogtums bei der Ausübung des Wahlrechts ausgesetzt sind, während Stefan Braum am Gegenbeispiel der USA und Polens die Bedeutung eines unabhängigen Justizapparates für eine funktionierende Demokratie unterstreicht.
Es kommt aber nicht nur auf die Institutionen an. Frank Wies betont die Rolle der Zivilgesellschaft und mahnt deren Organisationen, sich nicht vom Staat ihre Unabhängigkeit stehlen zu lassen, damit sie ihre Rolle als demokratische Wächter weiterhin ausüben können. Diese Aufgabe kommt natürlich auch der Presse zu, deren Rolle der Presserat in seinem Beitrag herausstellt. Die Pressefreiheit und ihre Unabhängigkeit von den Regierenden und mächtigen Interessengruppen sind in der Tat eine wesentliche Voraussetzung für die Gestaltung einer demokratischen Meinungsbildung. Die AutorInnen sehen die Lage in Luxemburg eher positiv und möchten den Medienpluralismus insbesondere durch staatliche Zuwendungen weiter garantiert wissen. Sie vergessen allerdings darauf hinzuweisen, dass BerufsjournalistInnen regelmäßig von PolitikerInnen angerufen und unter Druck gesetzt werden. Bedeutender ist tatsächlich die Gefahr, die von der „Diktatur des Algorithmus“ der sogenannten neuen sozialen (eher: unsozialen) Medien ausgeht, wie Georg Mein erklärt. Dabei ist nicht zu vergessen, dass die Algorithmen von Menschen im Auftrag von Kapitalgebern geschrieben werden, wie jüngst Elon Musk mit seiner politischen Einflussnahme auf X für alle (wirklich alle?) offenkundig machte.
Sich gegen eine schleichende Zersetzung der Demokratie zur Wehr zu setzen und junge Menschen in die Funktionsweise der Demokratie einzuführen ist die Aufgabe des Zentrums fir politesch Bildung (ZpB). Deren Direktoren Michèle Schilt und Marc Schoentgen stellen ihr Aufgabengebiet sowie die Methodenvielfalt vor, während ZpB-Mitarbeiter Ken Nilles spezifisch auf die Medienbildung eingeht, um die Handlungsfreiheit der zukünftigen BürgerInnen sicherzustellen. Auch Esin Göksoy (CID | Fraen an Gender) plädiert für Bildungsarbeit, weil das Geschlechterverhältnis jede menschliche Gesellschaft strukturiert und somit auch auf die Gesetzgebung einwirkt. Im selben Sinn ist das Plädoyer von Luis Santiago zu verstehen, der für eine Demokratisierung des Zugangs zur Kultur eintritt, um allen BürgerInnen die Teilnahme an kulturellen Ereignissen und damit am gesellschaftlichen Dialog zu ermöglichen. Viviane Thill stellt Filme und Serien vor, die das demokratische Defizit auf Ebene der Europäischen Union teilweise sarkastisch thematisieren, und ein Interview mit Bastian Drumm vom Kuseler Festival „Kein Bock auf Nazis“ zeigt eindrücklich, dass gerade die Musikszene einen populären Beitrag zur politischen Bewusstseinsbildung leisten kann.
Angesichts der autoritären Tendenzen, die in den USA wie in Europa um sich greifen, müssen die ehrlichen demokratischen Parteien zusammenstehen und ihren Konkurrenzkampf ausnahmsweise überwinden. Die vier Jungendparteien haben es in den letzten Monaten zu verschiedenen Themen wie Wohnungsbau oder eben Demokratiestress vorgemacht. Michel Cames zitiert den deutschen Verfassungsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde, der das Verschwinden einer Wertegemeinschaft bedauert, die über allen Dissens im Detail hinaus die Gesellschaft zusammenhielt. Dazu gehörte in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg die Verteidigung und Verbreitung der Menschenrechte, die Demokratisierung aller staatlichen Entscheidungen, natürlich auch der Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit. Dieser Konsens riskiert zurzeit unter dem Druck von Politikern, die nicht zögern, wirtschaftliche Partikularinteressen über das Gemeinwohl zu stellen, verloren zu gehen. forum wird 2026 in einem Dossier am Beispiel des Klimaschutzes und der Artenvielfalt zeigen, welche gemeinsamen Ziele zum Überleben der Menschheit dringend notwendig sind, auch in Luxemburg, gegen die Ansichten gewisser PolitikerInnen, die aus elektoralen Gründen die Problematik kleinreden und den Rechtspopulisten recht geben wollen. Statt den Populisten nachzulaufen, gilt es, ihre Argumente zu kontern. Ehrlich zu sein. Konkrete Lösungen und ihre Finanzierung vorzuschlagen. Die WählerInnen sind nicht dumm.5
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratieindex_(The_Economist) (letzter Aufruf am 16. August 2025)
2 Siehe die Zusammenstellung von forum-Beiträgen zum Thema Demokratie auf forum.lu.
3 Völkischer Beobachter, 30. April 1928.
4 Siehe dazu auch: Michel Pauly, „Thesen zur Demokratie“, in: forum 30 und 31 (1979).
5 Leseempfehlung: Mark Schieritz, Zu dumm für die Demokratie?, München, Droemer Verlag, 2025, 159 Seiten.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
